- Das Haus
- Newsletter
- Service
- Publikationen
- Veranstaltungen
- NEU Livestream
- Livestream-Archiv
- Ausstellungen
- Buchmagazin & AutorInnen
- AutorInnen
- AUFTRITTE
- Rezensionen Buch
- Rezensionen 2019
- Rezensionen 2018
- Rezensionen 2017
- Rezensionen 2016
- Rezensionen 2015
- Rezensionen 2014
- Rezensionen 2013
- Pressespiegel 2000-2010
- AutorInnen A
- AutorInnen B
- AutorInnen C
- AutorInnen D
- Autorinnen E
- AutorInnen F
- AutorInnen G
- AutorInnen H
- AutorInnen I
- AutorInnen J
- AutorInnen K
- AutorInnen L
- AutorInnen M
- AutorInnen N
- AutorInnen O
- AutorInnen P
- AutorInnen Q
- AutorInnen R
- AutorInnen S
- AutorInnen T
- AutorInnen U
- AutorInnen V
- AutorInnen W
- AutorInnen Z
- Rezensionen Sachbuch
- Verlage
- Dank an Verlage
- Impressum
- Incentives
- Bibliothek & Sammlungen
- Katalogsuche
- Partnerinstitutionen

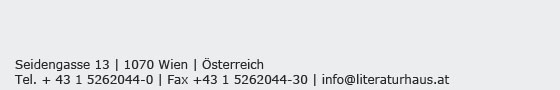
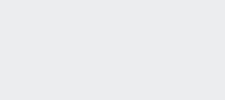


FÖRDERGEBER
PARTNER/INNEN

Peter Handke: Die Obstdiebin Oder Einfache Fahrt ins Landesinnere.Leseprobe
Ich räumte in Haus und Garten auf, was aufzuräumen war, ließ dies und das auch eigens, wo es stand oder lag, bügelte die zwei, drei alten Hemden – kaum im Gras getrocknet –, an denen mir besonders gelegen war, packte, steckte die Schlüssel für das Land ein, die so viel schwereren als die für das Vorstadthaus. Und nicht zum ersten Mal kurz vor einem Aufbruch riß mir beim Knüpfen der knöchelhohen Schuhe ein Schnürband, fand ich nicht und nicht die Socken, die zueinanderpaßten, gerieten mir drei Dutzend von Detaillandkarten zwischen die Finger, bis auf die eine, auf die ich aus war, mit dem Unterschied dieses Mal, daß mir alle zwei Schuhbänder rissen – bei deren viertelstündigem Aufknoten vorher mir ein Daumennagel abbrach –, daß ich zuletzt die unzugehörigen Socken paarweise zusammenstülpte – fast einzig solche –, und daß es mir auf einmal recht war, ohne jede Landkarte unterwegs zu sein. S. 12 So sitzend, wachend, zugleich wie in einem Schlaf, einem anderen Schlaf, bin ich auf einmal angeflogen worden von einer Stimme, nah – näher nicht möglich – am Ohr. Das war die Stimme der Obstdiebin, eine fragende, so zarte wie bestimmte – zarter und bestimmender nicht möglich. Und was fragte sie mich? Wenn ich mich recht erinnere (unsere Geschichte ist ja schon wieder lang her), nichts irgendwie Besonderes; etwas zum Beispiel wie »Wie geht’s dir?«, »Wann fährst du?« (oder nein, jetzt kommt es mir, das Gedächtnis). Sie hat mich gefragt: »Was fehlt Ihnen, mein Herr? Worüber sorgen Sie sich denn so? Qu’est-ce qu’il vous manque, monsieur? C’est quoi, souci?« Und das ist dann auch in der Geschichte das einzige Mal geblieben, daß die Obstdiebin mich in Person angeredet hat. S. 16 Einsinken ins Land, das war seit jeher einer meiner Tagträume gewesen. Und der hatte sich bisher, noch ein jedes Mal, den einen, einen einzigen Sommermoment lang, erfüllt, zumindest während der mehr als fünfundzwanzig Jahre meines Daseins an ein und demselben Ort. S. 20 © Suhrkamp, Berlin 2017.
|
| Veranstaltungen |
|
Sehr geehrte Veranstaltungsbesucher
/innen! Wir wünschen Ihnen einen schönen und erholsamen Sommer und freuen uns, wenn wir Sie im September... |
| Ausstellung |
| Tipp |
|
OUT NOW: flugschrift Nr. 35 von Bettina Landl
Die aktuelle flugschrift Nr. 35 konstruiert : beschreibt : reflektiert : entdeckt den Raum [der... |
|
INCENTIVES - AUSTRIAN LITERATURE IN TRANSLATION
Neue Buchtipps zu Ljuba Arnautovic, Eva Schörkhuber und Daniel Wisser auf Deutsch, Englisch,... |