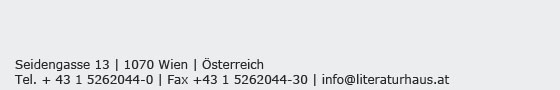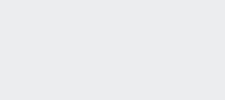Wieder daheim
Das Haus stand fensterlos da, verwaist. Die Türe war offen. Jeder konnte hinein. Es gab kein Hindernis, keinen Riegel. Alles war zerstört oder beschädigt. Die Fenster und einige andere Dinge hatten die Partisanen für ihre Erdbunker mitgenommen. Einiges war von den Nachbarn auf die Seite geschafft worden. Nur die Schränke standen noch auf dem Dachboden. Im Keller waren noch ein paar Schaffel und hölzerne Bottiche vorhanden, im Getreidespeicher leere Kästen, ohne Korn oder Nahrung. Einige hölzerne Schmalztiegel standen auf den Regalen und stanken nach altem Verhackertem. Im Stall roch es nicht einmal mehr nach Mist, die Verschläge waren leer. In den Futtertrögen lag verschimmeltes, verfaultes Futter. Keine Hühner waren zu sehen, nicht einmal Mäuse, selbst die Fliegen hatten den Stall verlassen.
So kehrten wir am 13. Mai 1945 nach Hause zurück. Als erstes stellten wir in der bajta, die Vater gebaut hatte, ein paar Stühle und einen Tisch auf. Dann machten wir uns aus den alten Betten behelfsmäßige Lager zum Schlafen. Wir hatten gelernt, bescheiden und anspruchslos zu leben. Doch der Hunger setzte uns zu. Die Nachbarn brachten uns ein wenig zu essen, Milch und Brot und auch Kartoffeln. Unsere Hühner, die ihre Eier bis dahin für die Nachbarn gelegt hatten, bekamen wir zurück. Schon am nächsten Morgen schenkte uns eine Henne ein Ei zum Frühstück. In der Scheune lagerte noch ein bisschen Getreide vom Herbst, das wir unter dem Dach verstaut hatten, um es zu dreschen. Zunächst aber mussten die Maschinen instand gesetzt werden, um dreschen und mahlen zu können.
Vater war sehr krank. Er litt an Magengeschwüren. Er war im Krankenhaus in Kappl gewesen und musste immer wieder den Arzt im Ort aufsuchen. Mehrfach wurden wir auch von Ustaschas belästigt und bedrängt, die unsere Täler belagerten, die Bauern heimsuchten und zwangen, ihnen Nahrung zu überlassen und andere Gefallen zu erweisen. Meinen Vater wollten sie erschießen, weil er ihnen keine Lebensmittel geben konnte. Wir hatten doch selber nichts. Die Situation war sehr ernst. Eine ganze Bande gut bewaffneter Nazisoldaten und Angehörige anderer Einheiten bedrohten ihn, weil er ihnen nichts zu essen geben konnte. Erst nach langem Hin und Her zogen sie ab. Sie wollten wissen, wo sie zu den Engländern gelangen konnten; nach Jugoslawien wollten sie auf gar keinen Fall zurück.
Ein paar Tage später kam meine Cousine Zofka zu uns und berichtete, dass unsere Kuh Liska beim Holar in Lobnig stand. Wir gingen sie holen und brachten sie nach Hause. Alle waren wir glücklich, unsere Kuh wiederzuhaben, weil sie viel Milch gab. Schon 1943 hatte ich die Kühe gemolken, auch Liska. Sie hatte ein so weiches Euter, dass die Milch im Strahl hervorschoss und im Sechter schäumte. Wie früher übernahm ich das Melken und die Sorge für die Kuh. Innerhalb kurzer Zeit kaufte Vater, ich weiß nicht von wem, zwei weitere Kühe, wahrscheinlich von Bauern, die Kontakte zu den Nachbarn in Slowenien hatten. Von dort jedenfalls brachten sie das Vieh, das wir in Raten abbezahlten. Auf dem Feld musste gepflügt und gesät werden. Vater brachte aus Kappl drei Pferde: eine große Stute, eine zweite, noch stärkere und ein Fohlen. Alle drei Pferde hatten neues Geschirr, zwei trugen sogar einen Sattel. Ich bewunderte die Sättel, die schön verziert waren. Mit diesen Pferden begannen wir zu arbeiten, zu pflügen und die Äcker zu bestellen, Brennholz zu führen und Baumstämme aus dem Wald zu holen.
Mit jedem Tag wurde die Arbeit mehr. In kurzer Zeit gelang es Vater, alle notwendigen Anschaffungen zu tätigen. Sein Kamerad Folti Kelih – Kolja, ein Mitstreiter aus der Zeit, als sie gemeinsam den Bau des Erdbunkers für die politischen Aktivisten des Bezirkskommandos Völkermarkt im Gebiet der Ojstra und der Topica organisiert hatten, versprach meinem Vater, neue Fenster für das ganze Haus zu beschaffen. Nur Rahmen konnte man nirgends kaufen. Doch der Tischlermeister Tauber würde ihm alle Maschinen zur Verfügung stellen, damit er sie selber zuschneiden könne. So kamen wir auch zu neuen Fenstern.
Nachdem sie eingesetzt waren, bezogen wir wieder unser Haus. Nach und nach wurde alles in Ordnung gebracht. Es gab sehr viel zu tun. Alle häuslichen Arbeiten verrichteten wir Männer allein. Vater kochte, die Stallarbeit übernahm ich. Zdravko verstand sich gut auf den Haushalt. Er kehrte die Zimmer und spülte das Geschirr. Als die Essensvorräte knapp wurden, beschlossen mein Bruder und ich, im Bach Forellen zu fangen. Und wirklich gelang es uns, gut dreißig große Fische zu fangen. Zwei Tage lang aßen wir nichts als Forellen. Sie schmeckten uns vorzüglich. Wir aßen sie gedünstet, gebacken mit Ei und köstlich in Butter gebraten.
Eines Abends im Mai, als die Sonne schon unterging, beschlossen Vater und ich, einen Rehbock zu jagen. Als Waldarbeiter getarnt machten wir uns in den Osenca-Wald auf. Dort, wo wir zwei Jahre zuvor Neuland gerodet und Roggen gesät hatten, beschlossen wir, auf den Bock zu passen, der dort gewöhnlich in der Dämmerung äste. Wir erreichten die Lichtung und legten uns hinter einem Baumstumpf auf die Lauer. Der Sonnenuntergang überzog die Gegend mit Goldglanz, die Schatten breiteten sich aus, und die Spannung wuchs. Aus dem Fichtenjungwald lugte der Kopf eines Rehs. Es trug schon Bastgeweih, sein Fell glänzte, eine abendliche Idylle. Die Flinte in den Händen des Vaters war schussbereit. Es knallte, der Bock blieb auf der Stelle liegen und rührte sich nicht mehr. Wir brachen ihn auf und trugen ihn nach Hause. Wir hatten wieder Fleisch. Daheim schmeckte es ganz besonders.
Als ich in der ersten Woche nach meiner Heimkehr am Sonntagmorgen zur Messe nach Kappl ging, erlebte ich eine schmerzliche Enttäuschung. Ich begegnete einem ehemaligen Schulfreund. Seinerzeit hatte er die schwarze HJ-Uniform getragen, nun war er ein abgehalfterter Nazi. Das erste, was er mich fragte, war, was ich denn hier noch wolle, wieso ich nicht mit den 'Banditen' nach Jugoslawien gegangen sei, ich hätte kein Recht, im Tal und in der Heimat zu bleiben. Ich war verstört und eingeschüchtert. Ich wusste nicht, was ich ihm antworten sollte. Wir gingen auseinander und begegneten einander nicht wieder. Auch später traf ich immer wieder auf Leute, die verschreckt, beleidigt und enttäuscht von den Freiheitskämpfern waren. Auch nach der Befreiung blieben die Partisanen die 'Banditen'.
Die Toten wurden begraben. Das Weinen der Mütter hörte nicht auf. Es ist bis heute nicht verstummt. Viele Lügen wurden verbreitet, und Unrecht wurde getan. Rechtlos waren wir, nach dem Krieg wurden wir von der Heimat empfangen, als wären wir Fremde. Unsere Jugend und unser Zuhause hatten wir für die Freiheit und für ein besseres Leben geopfert. Doch wir wurden verhöhnt, geprellt und beschämt, weil wir uns gegen die Okkupanten zur Wehr gesetzt hatten. Weil ich während des Krieges ein ordentliches Stück gewachsen war, brauchte ich neues Gewand. Ich hatte einen kaum getragenen Ustascha-Mantel. Aus ihm sollte mir der Schneider Vihar eine neue Hose und vielleicht auch einen Rock nähen. Er wohnte und arbeitete im Prepotnik-Haus am Hauptplatz. Ich brachte den Mantel in seine Werkstatt. Er trennte ihn auf und nähte mir daraus einen Anzug. Ich freute mich darüber und bewahrte ihn im Schrank auf dem Dachboden auf. Als englische Soldaten unser Haus nach Waffen und militärischer Ausrüstung durchsuchten, fanden sie im Schrank meinen Anzug, trugen ihn in den Hof und verbrannten ihn dort. Da half kein Bitten, auch von den Befreiern gab es kein Verständnis für uns junge Kämpfer. Unsere Waffen hatten wir in Erdlöchern vergraben, einige Militärwaffen auch in den Felsen. Dort waren unsere besten Verstecke. Doch alles, was wir dort versteckt hatten, war von Einheimischen gestohlen worden, die davon wussten. Viele Waffen waren auch verrostet und in einem schlechten Zustand. Schade darum, man hätte sie später zu Jagdwaffen umfunktionieren können. Damals kam Tante Leni wieder zu uns. Sie übersiedelte mit ihrer ganzen Familie zum zweiten Mal zu uns, denn ihr Haus war nicht mehr bewohnbar. Alles war zerschossen und zerstört. Sie half uns im Haushalt, kochte, nähte und wusch die Wäsche. Eine neue Familie entstand, bis Leni im Sommer wieder in ihr Haus zurückkehren konnte. Ihre Familie musste von so gut wie nichts leben. Wir halfen einander als Nachbarn, jeder steuerte seinen Teil zum Überleben der Verwandtschaft bei.
Nach und nach kehrten die überlebenden Vertriebenen und Deportierten aus den Lagern zurück, wo viele von ihnen jahrelang gelitten hatten. Nur von meiner Mutter gab es keine Nachrichten. Wir wussten nicht, ob sie das Ende des Krieges erlebt hatte. Niemand wusste etwas von ihr: Wie sie das KZ Ravensbrück überstanden hatte – ob sie es überhaupt überstanden hatte, ob sie sich auf einem der Transporte durch Europa befand oder ob sie sie noch im letzten Moment getötet hatten. Seit mehr als einem Jahr hatten wir keine Nachricht von ihr. Der Sommer kam. Wir hatten uns viel Arbeit vorgenommen. Mahd und Ernte standen bevor. Bald kam der Herbst auf unsere Felder. Wir brachten das Getreide ein, das seit dem Frühjahr gewachsen war. Im Speicher sammelten sich langsam die Vorräte. Wieder waren wir ohne Frau im Haus und warteten weiter auf die Mutter. Dann meldeten sich Vertriebene, die berichteten, dass sie noch am Leben sei und dass sie wahrscheinlich bald nach Hause kommen würde. Unsere Ungeduld wuchs. Auch Nachbarinnen besuchten uns, die die ganze Zeit über im KZ, auf dem Todesmarsch und in verschiedenen Sammellagern mit ihr zusammen gewesen waren.
Schon seit 1943 hatten wir ohne Mutter leben müssen. Während des bangen Wartens wurde sie für mich zu einer fast unwirklichen Erscheinung. Ich konnte mir überhaupt nicht mehr vorstellen, eine Mutter zu haben, wusste nicht, wie sie jetzt aussehen mochte oder auch nur, wie sie ausgesehen hatte, als wir Abschied hatten nehmen müssen. All das ging mir durch den Kopf, während ich ungeduldig darauf wartete, die Mutter wieder zu sehen. Es kam der Abend des 3. September 1945. [...]
(S. 169-173)
© 2008 Drava Verlag, Klagenfurt/Celovec.