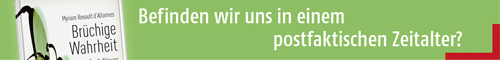Berichte von der Schulfront
Ein Essay zur Rolle der Germanistik für das Schulfach Deutsch
Von Martin Euringer
Die Tätigkeit an einer Schule stellt eines der größten Arbeitsfelder für Germanisten dar. Bayern veröffentlicht jährlich eine Prognose zum Lehrerbedarf, die Auskunft über die Einstellungschancen gibt. Folgt man den Informationen dieser Broschüre[1] gibt es augenblicklich einen deutlichen Bewerberüberhang, und erst mittel- und langfristig gesehen eine Aussicht auf einen höheren Bedarf – mit Ausnahme für das Fach Deutsch, wo es einen sehr großen Bewerberüberschuss gibt. Dabei muss man diese Aussage nach Schularten (Einstellungsbedarf an Grund- und Mittelschulen sehr gut, an Realschulen ähnlich, an Gymnasien in den kommenden Jahren eher schlecht bis mittelmäßig) und eben Fächern unterscheiden. Mehrfach wird in der Broschüre darauf hingewiesen, dass man alles Mögliche braucht, nur nicht Deutschlehrer. Davon hat man genügend zum Saufuttern, wie man in Bayern sagt…
Es wäre schon interessant darüber nachzudenken, warum ausgerechnet so viele Menschen Deutschlehrer werden wollen. Wenn man sich bei Schülern umhört, ist das nämlich keineswegs eines der beliebtesten Fächer; erst recht nicht, nachdem Deutsch zum verpflichtenden schriftlichen Abiturfach geworden ist. Es soll nun nicht psychologisiert und über mögliche Motive für die Studienwahl spekuliert werden. Es soll ja um die Zukunft der Germanistik gehen und deshalb gilt es vielmehr die Frage aufzuwerfen, ob die Germanistik etwas dazu tun muss, damit ihre Absolventen in dem späteren Beruf als Deutschlehrer erfolgreich tätig sein können. Eigentlich ist das eine wissenschaftstheoretische Frage: Muss eine Wissenschaft in ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit, Rücksicht auf die spätere Berufswelt ihrer Studierenden nehmen? Stellt man die Frage in dieser Gestalt ist die Antwort klar: Nein, muss sie nicht. Wissenschaft will die Wirklichkeit erforschen, Aussagen über Seins- oder Geltungszusammenhänge erstellen, im Fall der Germanistik, mit Dilthey gesprochen, Verstehensprozesse ermöglichen. Das mag zuerst einmal unbefriedigend sein, aber hier soll sich dagegen verwehrt werden, ein Hochschulstudium, wissenschaftliches Arbeiten allgemein in einen genuinen Zusammenhang mit Erwerbsarbeit zu bringen. Man betreibt Wissenschaft nicht in erster Linie als Beruf, und auch wenn es anders klingen mag, ist diese Überzeugung nicht weit von Max Weber weg. Andererseits wäre es naiv zu glauben, dass solche pragmatischen Erwägungen keine Rolle für die Wissenschaft spielten; Thomas S. Kuhn hat bereits in den siebziger Jahren klargemacht, dass das normale Arbeiten innerhalb eines wissenschaftlichen Paradigmas von derartigen Überlegungen geprägt ist. Aber sowohl Weber als auch Kuhn bezogen sich auf die berufliche Tätigkeit eines Wissenschaftlers an der Universität. Muss die Germanistik als universitäre Disziplin sich von den Fragestellungen beeinflussen lassen, in denen ihre späteren Absolventen arbeiten werden? Also von journalistischen, wirtschaftlichen oder im Fall der Schule eben pädagogischen Problemen? Denn eine akademische Laufbahn im engeren Sinne werden nur die wenigsten einschlagen.
Die Germanistik als Grundlagenwissenschaft muss sich von solchen anwendungsorientierten Fragestellungen nicht beeinflussen lassen; Wissenschaftler sollen das erforschen, was sie interessant finden. Es kann jedoch ein anekdotenhafter Einblick gegeben werden, mit welchen Problemen im weiteren Sinne germanistischer Natur man in der Tätigkeit als Gymnasiallehrer konfrontiert ist. Daraus werden im Folgenden zwar bestimmte Konsequenzen für die Zukunft der Germanistik gezogen, jedoch ganz sicher kein Anspruch auf Allgemeingültigkeit erhoben. Vielmehr wird ein heuristischer Wert für das Nachdenken über die Zukunft der Germanistik erhofft.
So als kleiner Frontsoldat sieht man schon das eine oder andere, das einen zum Grübeln bringt, das sollen die folgenden drei Anekdoten zeigen. Die ersten beiden Anekdoten hat der Verfasser erst kürzlich erlebt: Siebte Klasse Ethikunterricht. Die 12- bis 13-jährigen Schüler denken übers Erwachsenwerden nach. Es wird gefragt, wie sie sich ihr Leben so in vier bis fünf Jahren vorstellen. Eren, erste Reihe: „Isch geh Immobilienmakler!“ „Eren, wir sprechen Deutsch. Ich möchte gerne Immobilienmakler werden.“ Rezon, zwei Reihen weiter: „HaHa, Eren kann kein Deutsch!“ „Rezon, ergänze bitte folgenden Satz: Wer im Glashaus sitzt,…“ „Häh? Ist im Vorteil?“
Unterricht am Gymnasium. Vielleicht noch erweitert um eine zweite Anekdote, diesmal 12. Klasse, ein halbes Jahr vor dem Abitur. Es wird die bekannte Parabel von Kafka, in der der Erzähler einen Schutzmann nach dem Weg fragt und von diesem ausgelacht wird, besprochen, ohnehin keine leichte Kost. Die Schüler versuchen sich an möglichen Deutungen und Erklärungen, bis ein Schüler die Frage stellt: „Herr Euringer, was ist eigentlich ein Schutzmann?“ Da schluckt man dann schon erst einmal, zumal klar wird, dass der Schüler ja nicht nur von Beginn der Stunde an nichts verstanden hat. Sondern es ist leicht hochzurechnen, wenn so einfacher Wortschatz Schüler vor Schwierigkeiten stellt, was hat der Mensch dann vom Wortschatz eines Goethe oder Schiller, von Eichendorff oder Thomas Mann verstanden, die ja die eineinhalb Jahre lang zuvor Unterrichtsgegenstand in der Oberstufe waren.
Klassischer Bildungswortschatz geht verloren. Germanisten braucht man nicht zu erklären, dass sich Sprache wandelt. Aber die Verlustmasse innerhalb weniger Jahrzehnte erscheint doch erschreckend groß. Nochmals: Was hier erzählt wird, sind Anekdoten. Sie sollen keinen statistischen, sondern nur heuristischen Wert haben. Natürlich gibt es auch Schüler, die weiterhin über einen umfangreichen Wortschatz verfügen, bei denen in den Familien viel gelesen, vorgelesen oder wenigstens geredet wird. Es ist jedoch nicht mehr davon auszugehen, dass dies die Regel ist; vielmehr häuft sich das, was im Fachjargon „bildungsfern“ genannt wird. Die dritte Anekdote hat eine Kollegin an der Nachbarschule, im Übrigen eines der wenigen noch verbleibenden humanistischen Gymnasien, erlebt. In ihre Sprechstunde kommt ein Vater, gekleidet in Jogginganzug und mit Goldkettchen ausstaffiert. Anliegen seines Besuches: „Wieso muss der Bub jetzt schon wieder eine Lektüre kaufen? Der muss keine Bücher lesen!“. Wenn in Familien dergestalt mit Bildung umgegangen wird, kann das kein Schulunterricht der Welt retten.
Wenn studierte Germanisten also auf das Berufsfeld Schule treffen, machen sie Erfahrungen, die mit ihrer akademischen Ausbildung nur wenig zu tun haben. Diese Ausführungen sollen nicht falsch verstanden werden: Lehrer brauchen eine fundierte germanistische Ausbildung, unbedingt sogar. Je besser man sich in Literatur und Sprache auskennt, umso besserer Unterricht kann gelingen, umso leichter fällt die tägliche Vorbereitung, umso eher kann ein gelingendes Unterrichtsgespräch geführt werden. Und Schüler merken sofort, ob jemand etwas kann oder nur ein „Dampfplauderer“ ist – und benehmen sich entsprechend. Man braucht Fachleute an den Schulen – aber: Das große „Aber“ besteht darin, dass die eigentliche germanistische Tätigkeit eine Voraussetzung bildet und gleichsam nur nebenbei ablaufen wird. Man ist damit beschäftigt, selbst erwachsenen Schülern Begriffe zu erklären, die Germanisten selbstverständlich erscheinen. Auf einmal wird klar, dass es vorteilhaft gewesen wäre, neben der Vorlesung zur Lyrik Goethes vielleicht auch einmal eine Veranstaltung aus dem Bereich DaF – Deutsch als Fremdsprache besucht zu haben. Das mag wie ein Scherz klingen, ist jedoch völlig ernst gemeint. Der Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund, Familien in denen zu Hause kein Wort Deutsch gesprochen wird, steigt rapide. Zudem ist es politischer Wille, dem man sich als Beamter kaum widersetzen kann, dass so viele Schüler wie möglich das Abitur erreichen. Das bedeutet ganz konkret, dass gut ausgebildete Fachwissenschaftler zusehen, wie das Anforderungsniveau der Prüfungsaufgaben sinkt. Dem könnte nun entgegengehalten werden, dass dies das typische Lamentieren eines konservativen Lehrers ist, das empirisch nicht belegbar sei. Nur so als kleiner Hinweis: Nachweislich wurden in den letzten Jahren Aufgabenformate „entschärft“. Die früher verpflichtende Gliederung darf nicht mehr bewertet werden. Es genügt als Aufsatzform, Informationen zusammenzustellen, anstatt sie zu erörtern. Sprachliche Analysen bei Sachtextdiskussionen gelten als überflüssig… Germanisten muss man nicht erklären, weshalb das von der Sache her ein Fiasko ist. Es ist sehr wahrscheinlich, dass eine vergleichende Studie, die Abituraufgaben nachkorrigieren würde von den 50er Jahren angefangen bis in die Gegenwart ein deutliches Absinken der intellektuellen Leistung zeigen würde – ohne dass sich das in den Noten spiegelt. Auch der Vorwurf, dass diese Kritik doch letztlich nur ein alter Topos sei, der schon bei Sokrates zu finden ist, geht an der Sache vorbei. Natürlich kann in diesem Rahmen keine tragfähige Kulturkritik formuliert werden, aber die Behauptung wäre: Nicht bei allen, aber in der Masse der Schülerschaft sinkt das intellektuelle Niveau – zumindest am Gymnasium. Geleugnet wird dies überraschend häufig von Leuten, die selbst gerne Essays und wissenschaftliche Aufsätze schreiben und lesen; und damit genau nicht zu der angesprochenen Gruppe gehören. Im täglichen Schulunterricht sieht man sie allerdings eher selten…
Ich fasse kurz zusammen. Um als Deutschlehrer arbeiten zu können, brauchen man ein germanistisches Fachstudium, ganz ohne Zweifel. Aber vorbereitet auf den Beruf wird man durch das Studium nicht. Muss sich also etwas in der Germanistik, in der Linguistik, der älteren oder neueren Literaturwissenschaft ändern? Aber nein, warum denn? Soll man Mediävistik aus dem Kanon der Germanistik streichen, nur weil es im Schulunterricht so gut wie nicht vorkommt? Soll man die linguistische Forschung auf Probleme der Rechtschreibung und des Satzbaus beschränken? Soll man in der Literaturwissenschaft nur noch Leseforschung betreiben? Oder sie am besten durch Filmwissenschaft auswechseln, da Jugendliche ja immer weniger lesen und demzufolge im neuen Lehrplan die Lektüre eines literarischen Werkes durch eine Filmanalyse ersetzt wird. (Filmanalysen im Unterricht sind nichts Schlechtes. Auch die Rede vom erweiterten Textbegriff leuchtet durchaus ein. Aber man sieht, wohin der Hase läuft. Er läuft Richtung Vereinfachung, Kommerzialisierung und Ökonomisierung.) Eine solche Kastration der Germanistik wäre abwegig: Wissenschaft ist so viel mehr als das, was in der Anwendung dann gebraucht wird. Wo bliebe denn die ganze Freude am Forschen und Entdecken, der ganze Kosmos des Denkens, der sich ja gerade dadurch erst öffnet, dass man sich selber nicht beschränkt. Selbstverständlich wird das auch heißen, sich zu spezialisieren. Selbst wenn es etwas Abwegiges, Extravagantes ist. Wenn es klug gemacht ist, wird es den Horizont des Wissenschaftlers und seiner Leser erweitern.
Hier ist ein Wort zu dem Spiegel-Artikel von Martin Doerry angebracht[2], der ja eine Art Auslöser mit für diese Tagung gewesen zu sein scheint. Hierbei soll noch ein wenig auf den Zusammenhang Germanistik und Berufswelt eingegangen werden, der in dem Artikel ja eine zentrale Rolle spielt. Es fällt eine Passage auf, die sehr interessant ist und ein grundsätzliches Problem darstellt. Leider überliest man sie leicht; Doerry schreibt, dass Germanistik auf Platz sieben der beliebtesten Studienfächer steht. In der Rangliste vor ihr befinden sich BWL, Maschinenbau, Jura, Medizin, Wirtschaftswissenschaften und Informatik. Und jetzt wird es wissenschaftstheoretisch und spannend: Eines ist doch auffallend an allen Studienfächern, die direkt vor Germanistik genannt werden. Es handelt sich allesamt um sogenannte Anwendungswissenschaften. Wissenschaftstheoretisch kann man zwischen Anwendungswissenschaften und Grundlagenwissenschaften unterscheiden. Grundlagenwissenschaften wie die Geistes- aber auch die Naturwissenschaften forschen um des Gegenstandes selbst willen, sie wollen die menschliche Neugier, das, mit Aristoteles gesprochen, Wundern und Wissenwollen befriedigen. Die Ergebnisse solcher Grundlagenwissenschaften werden in Anwendungswissenschaften weiterverarbeitet. Das ist leicht zu sehen, dass Forschungen aus der Physik oder der Mathematik, dann etwa in Ingenieurswissenschaften weitergedacht werden. Ergebnisse aus der Biologie werden für die Medizin fruchtbar gemacht und so fort. Anwendungswissenschaften zielen in erster Linie darauf ab, für einen Beruf auszubilden, ihre eigenen Forschungen – die es ja durchaus gibt, man denke nur an die medizinische Forschung – konkret in der Alltagswirklichkeit zu nutzen. Der entscheidende Unterschied dürfte der sein, dass Anwendungswissenschaften ihre Erkenntnisse nicht primär um ihrer selbst willen suchen, sondern eben der Anwendung halber. Diese Wissenschaften wollen ihre Studenten weniger zu „Forschern“ als vielmehr zu „Praktikern“ ausbilden. Es ist ein ganz zentrales Anliegen dieser Differenzierung darauf hinzuweisen, dass damit keine Wertung verbunden ist. Anwendungswissenschaften sind nicht mehr oder weniger wert als Grundlagenwissenschaften! Sie sind lediglich anders! Sie tun etwas anderes, mit anderen Zielen. Aber kein vernünftiger Mensch wird etwa einer Anwendungswissenschaft wie Medizin ihr Renommee oder gar ihren Wert absprechen. Und ganz sicher ist das Betreiben solcher Anwendungswissenschaften ebenso lustvoll und befriedigend, wie das Arbeiten in den Grundlagenwissenschaften – wenn sich die Anwendungswissenschaften bewusst sind, was sie tun. Und hier kommt der große Knackpunkt: Von den vielen Germanistikstudenten schließen laut dem Spiegel-Artikel über 60% ihr Studium als Lehramtsstudenten ab. Der Verdacht ist naheliegend, dass sie eben vornehmlich am Lehramt, weniger an germanistischen Forschungen interessiert sind. Germanistik ist aber eben eine Grundlagen-, keine Anwendungswissenschaft. Gibt es denn keine Anwendungswissenschaft für Lehrer? Doch die gibt es, natürlich. Ganz klar, Aufgabe der Lehrerausbildung obliegt der allgemeinen Didaktik, der Schulpädagogik und insbesondere eben den Fachdidaktiken. Und ich höre jetzt schon einen Aufschrei und zwar zu Recht. Nein, nicht dieses Fachdidaktikzeugs! Bislang hat der Verfasser tatsächlich nur sehr wenige Kollegen erlebt, die von einer wirklich guten und gewinnbringenden fachdidaktischen Ausbildung berichtet haben. Und er hat über 10 Jahre lang immer wieder nachgefragt. Dennoch, es wäre die Aufgabe von Fachdidaktiken als Anwendungswissenschaften Studenten zu Fachlehrern auszubilden. Das Problem ist, Fachdidaktiker wissen gar nicht, dass Sie Anwendungswissenschaftler sind. Sie wollen es aus verschiedenen Gründen, etwa Renommee, Budgetaustattung usf., auch gar nicht sein. Man versteht sich als eigenständiges Fachgebiet der Bezugswissenschaft, statt sauber einer Berufsausbildung der Studenten nachzukommen. Dies hat zur Folge, dass jeder Fachdidaktiker nach eigenem Gusto herumforscht und tut, was ihm gerade gefällt. Und wenn das etwas ist, das einer Grundlagenwissenschaft vielleicht noch angehen mag, so geht das in einer Anwendungswissenschaft eben nicht – zumindest nicht in diesem Maße. In den Fachdidaktiken müsste man sich auf entsprechende konkrete, berufsbezogene Inhalte konzentrieren und dazu ein verpflichtendes Curriculum für Lehrkräfte entwerfen. Dieses müsste von entwicklungspsychologischen Grundlagen angefangen, über die Fähigkeit, ein Tafelbild zu gestalten oder den Lehrplan zu lesen, über die Entwicklung von Unterrichtsmaterialien bis hin zur Diskussion der Lehrerrolle und was es sonst noch alles an relevanten Problemen gibt, eben konkret auf den Beruf vorbereiten. Die einzelnen Inhalte können dann immer noch je nach dem Verständnis des jeweiligen fachdidaktischen Forschers an der Universität unterrichtet werden; aber das gleicht dann eher folgenden Bild: Mediziner A bevorzugt, einen Armbruch auf die eine Weise zu richten, Mediziner B auf eine andere. Aber dass das Richten von Knochenbrüchen Teil der medizinischen Ausbildung sein muss, kann doch nicht ernsthaft angezweifelt werden. Die ausbildenden Hochschullehrer einer Fachdidaktik müssten, neben einer wissenschaftlichen Qualifikation, mindestens über eine zehnjährige Unterrichtserfahrung an Schulen verfügen. Oder wäre es wünschenswert, dass jemand Chirurgen ausbildet, der selber nie operiert hat? Und wenn wir gerade dabei sind, einen Wunschzettel zu schreiben, so wäre es das Sinnvollste das Studium aufzuteilen: Wie lange dauert ein Germanistikstudium 12, 14 Semester? Wenn man dafür brennt, ist ein Hochschulstudium auch ohne ein „Überflieger“ zu sein, nach acht Semestern abzuschließen. Das sollten alle Germanistikstudenten absolvieren; wer danach Lehrer werden möchte, sattelt die restlichen sechs Semester als ein zweites Studium der Anwendungswissenschaften oben drauf. Und hier wird er dann auf den konkreten Beruf vorbereitet; in Bayern könnte man das vielleicht sogar nahtlos mit der Referendarsausbildung verknüpfen. Es ist klar, dass das hier Vorgestellte ein Wunschkonzert ist. Es gibt unendlich viele Widerstände politischer und finanzieller Art. Martin Doerry hat in seinem Artikel darauf hingewiesen. Und natürlich gibt es erst recht Bedenken, die etwas mit dem Selbstverständnis der Fachdidaktiker zu tun haben. Bildungspolitisch läuft das auf einen Umbau zahlreicher Fakultäten hinaus; wie das politisch umzusetzen sein soll, ist nicht die Aufgabe dieses Essays.
Es ging hier ja vielmehr um die Frage nach der Zukunft der Germanistik und darum, ob die Germanistik etwas für die berufliche Zukunft Ihrer Studenten unternehmen muss. Aus der Sicht der Schule, einem der größten Arbeitgeber für Germanisten, würde der Verfasser die Frage mit einem Ja und einem Nein beantworten. Nein, die Germanistik muss als Grundlagenwissenschaft nichts für die berufliche Zukunft ihrer Studenten tun. Fragen Sie einmal einen Philosophen nach dessen Berufsaussichten und sie erhalten nur ein müdes Lächeln zur Antwort. Aber das tut für die Philosophie als solche ja nichts zur Sache und in der Germanistik verhält es sich ähnlich. Andererseits ist ein lautes Ja zu sagen: Die Ausbildung von Lehrern müsste deutlich professionalisiert werden. Dazu gehört, dass man mit der jahrzehntelangen Verschleierungstaktik aufhört, nach dem Motto „Studier nur Germanistik. Deutschlehrer kannst allemal noch werden.“ Man muss für eine Fachdidaktik als sauber ausgearbeiteter Anwendungswissenschaft plädieren, die die Berufsausbildung von Germanisten unternimmt. Das Fazit lautet also: Man studiere Germanistik, wenn man neugierig auf Sprache und Denken ist, wenn man verstehen will, wie Literatur einen Menschen weiterentwickelt. Man studiere Germanistik, wenn man Kunst und einen zentralen Teil der menschlichen Kultur erleben und reflektieren will. Aber man sehe dieses Studium nicht als etwas, das zu einem Brotberuf verhilft. Stattdessen ist von Politikern und Dozenten eine konkrete Ausbildung zum Lehrer als ein zweiter Schritt zu fordern, wenn man denn diesen Beruf ergreifen möchten. Man muss darauf bestehen, doppelt ausgebildet zu werden, und zwar von einer strukturierten und sich ihrer selbst bewussten Fachdidaktik, die sich als eigenständige Anwendungswissenschaft versteht. Nur dann kann man den Lehrerberuf sinnvoll ergreifen, der wahrlich anstrengend genug ist, aber seine reizvollen Seiten hat. Wenn man also letztlich die hier vorgeschlagene Differenzierung in Grundlagen- und Anwendungswissenschaften ernst nimmt, steht zu vermuten, dass sich einige der als krisenhaft empfundenen Befunde der Germanistik auflösen werden.
Anmerkungen
Der vorliegende Text stellt die Überarbeitung eines Vortrages im Rahmen der studentischen Tagung zur Zukunft der Germanistik dar. Als Essay folgt er nicht der strengen Zitations- und Belegkultur, die einem wissenschaftlichen Text anstünde. Möchte der Leser wissen, woher bestimmte Gedanken und Informationen stammen, sei er verwiesen auf Euringer, Martin: Vernunft und Argumentation. Metatheoretische Analysen zur Fachdidaktik Philosophie. Darmstadt: WBG 2008.
[1] Prognose zum Lehrerbedarf 2018. Eine Information des bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus. München 2018,6,15,17,21.
[2] Martin Doerry: Wer war Goethe? Keine Ahnung, irgendso’n Toter. In: Der Spiegel. 6/2017.