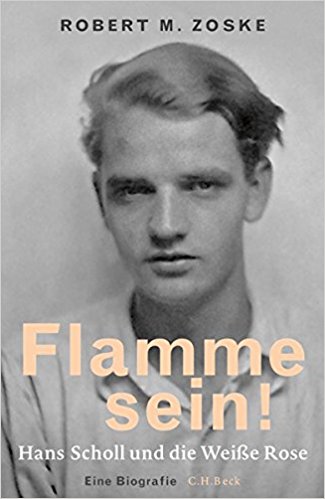IX
Hoch auf strebte mein Geist, aber die Liebe zog
Schön ihn nieder; das Leid beugt ihn gewaltiger;
So durchlauf ich des Lebens
Bogen und kehre, woher ich kam.
Friedrich Hölderlin
(Lebenslauf)
Das verschneite Tübingen. Der Neckar – hier bedeutend kleiner – gibt sich sehr viel bescheidener, als er euch vertraut ist. „Kennst du seine Quelle?“ Dein Philosophenfreund kennt sie nicht, jedoch werden viele diese Frage nicht eindeutig beantworten können. Wohl existiert in Schwenningen im östlichen Schwarzwald eine als Quelle bezeichnete Einfassung, aber ihr Name ist irreführend; der eigentliche Ursprung liegt weiter oberhalb in einem Moorseengebiet. „Das Quellmoor. Eine faszinierende Gegend! Sollten wir auch mal hin!“ Bei Plochingen hattet ihr die Stelle passiert, bis zu der der Fluss mit Schiffen befahrbar ist. Hier, viel weiter oberhalb, ist das Wasser bedeutend flacher, gibt es stattdessen die legendären Stocherkähne, die sommers für großes Spektakel auf dem Wasser sorgen.
Jetzt allerdings bietet sich ein stilles Bild von der Brücke aus: Über dem Fluss die Ufermauern und die terrassenartigen Gärtchen am Zwinger im Winterkleid. Dahinter die eng aneinandergebauten Wohnhäuser, hoch, schmal zumeist, ein Stockwerk vorkragend über das jeweils darunterliegende, das Fachwerk bis auf wenige Ausnahmen unter Verputz und dieser wiederum mit unterschiedlich farbigen Anstrichen versehen. Die Dächer dieser so bunten Häuserkulisse und auch die Haube des Turmes der dahinterliegenden Stiftskirche mit der Galerie für die sonntäglichen Turmbläser: vom Schnee weiß überzuckert. Geradezu ein Motiv für eine verspätete Weihnachtspostkarte!
Links vor der Häuserzeile, direkt am Ufer gelegen: ein gelb gestrichenes Haus mit ebenso gelb gestrichenem Turm. Dieser war einst Teil der Stadtbefestigung, sein Sockel wurde in das später erbaute Wohnhaus integriert, dem er so zu dessen markantem Aussehen verhalf. Dort verbrachte euer Dichter die zweite Hälfte seines Lebens in der Obhut des Schreinermeisters Ernst Friedrich Zimmer. Von dessen Familie hochgeachtet und fürsorglich betreut. Auch als der Hausherr, den er schließlich sogar um einige Jahre überleben sollte, starb und die Pflege daraufhin mit großer Selbstverständlichkeit und Hingabe von dessen Tochter Lotte übernommen wurde. Immerhin dies Glück im Unglück. Aber welch tragisches Schicksal!
Wahnsinn. Geistige Umnachtung. Unheilbar. Solches bescheinigte man ihm zu jener Zeit. Wie würde man es heute nennen, wie seinen Zustand einordnen? In Biographien werden ihm bereits in jungen Jahren Phasen des In-Sich-Zurückziehens, des Auf-Andere-Sonderbar-Wirkens zugeschrieben. Schwermut? Depression? Dir als im selben Monat Geborene ist dies nicht ganz fremd. Seid ihr März-Kinder anfälliger als andere? Gefahr – oder Chance? Beides? Schwer zu sagen. Tritt solches bereits in der Kindheit und Jugend auf, kann es sich manchmal mit dem Erwachsenwerden zunächst verlieren, um dann in späteren Jahren oder infolge von Lebenskrisen wieder zutage zu treten. Dies könnte manches erklären, aber es scheint dir aus gewissen Gründen kein allzu beruhigender Gedanke. Nun haben die spätesten Gedichte, die in der Turm-Zeit entstanden und von denen leider nur wenige erhalten sind, gewiss ihre Merkwürdigkeiten. Sie sprechen in der Klarheit ihrer Form jedoch gegen die Annahme, der Mann habe sechsunddreißig Jahre in Umnachtung und Wahnsinn zugebracht. War es vielmehr Flucht? Ins Innere? Vor einer Welt, die er nicht mehr verstand? Die ihn nicht verstand?
Erst sehr viel später, lange nach euren ersten Erkundungen vor Ort, wirst du auf die biografischen Nachforschungen des französischen Literaturwissenschaftlers Pierre Bertaux stoßen, die dich in deinen Mutmaßungen bestärken werden.
Es ist leider Montag: Der Turm hat geschlossen. Ihr müsst die Begegnung mit dem alten Dichter vertagen und euch zunächst dem jungen zuwenden. Ihr steigt also die schmalen Gassen hinauf, schaut euch den Marktplatz an, nehmt die Stimmung in euch auf. „Diese Ruhe erlebst du im Sommer nicht“, sagst du, „der Winter hat durchaus sein Gutes.“ Dann das Stift. Wieder einige Treppen hinunter. Eisglätte. Eine Frau vor euch stürzt, tut sich zum Glück nichts Ernstes. Du selbst gerätst einige Male ins Schliddern, fängst dich aber jedes Mal noch rechtzeitig ab. „Das mache ich immer so“, behauptest du, „es ist symbolisch für meine Lebenshaltung!“
Im Innenhof des Stifts: Tiefe Stille in dem kleinen Viereck zwischen den hohen Mauern. Ein Schweigen, das euch mit erfasst. Einfach nur dort stehen, es auf sich wirken lassen. Eng! So wird es auch vom jungen Dichter und seinen Kommilitonen erlebt. Erstarrte Formen. Statuten, die einem die Luft zum Atmen nehmen. Freies Denken wird unterbunden statt gefördert, umso mehr aus gegebenem Anlass: Es ist die Zeit der Französischen Revolution, die Kunde davon verbreitet sich auch hier. Schnell, angesichts der wenigen Medien, die man zur Verfügung hat. Flugschriften gibt es. Und natürlich die Presse, diese üblicherweise zensiert. Die Herrschenden befürchten ein Übergreifen der Unruhen und haben ihre eigenen Gründe, dies mit aller Macht verhindern zu wollen. Druck allerdings erzeugt Gegendruck: Junge Menschen voller Ideale lassen sich in ihrem Bestreben nach Freiheit das Denken nicht verbieten. Sie lesen erst recht und mit noch größerer Aufmerksamkeit in den unerlaubten Schriften, sie reden, diskutieren nächtelang, inspirieren sich gegenseitig, entzünden sich aneinander.
Am herzoglichen Hof versteht man auf derlei zu reagieren: Allzu unliebsame Zeitgenossen verschwinden kurzerhand hinter Gittern. Festungshaft auf dem Hohenasperg bei Ludwigsburg. Die „Schwäbische Bastille“ wird dieser in jenen Tagen genannt. Auf eurer Bahnreise, die unmittelbar darunter entlangführte, hattet ihr Gelegenheit, den imposanten Bergkegel mit der Burg zu bestaunen. Unter ihren einstigen Insassen finden sich bekannte Namen: Christian Friedrich Daniel Schubart, Friedrich List und später auch Isaac Sinclair, ein bedeutender Freund im Leben eures Dichters.
Euer Dichter, auch er – wie könnte es anders sein – ein Anhänger und Verfechter der neuen Gedanken, schreibt sehr bald leidenschaftlich für die neuen Freiheitsideale. Was ihn, den Hochsensiblen, jedoch erschreckt und nachdenklich macht, ist die Welle der Gewalt, die alsbald mit dem Versuch, diese Ideale umzusetzen, einhergehen wird. Die, einmal ins Rollen gebracht, nicht mehr aufzuhalten ist, alles mit sich reißt. Was zu der Frage führt: Ist der Mensch überhaupt reif zur Freiheit? Und wenn er sie denn erlangt hat: Was macht er daraus?
Wurde diese Frage je hinreichend beantwortet? Ihr als Nachgeborene seid mit selbstverständlichen Freiheiten aufgewachsen, die sich Menschen vorangegangener Generationen hart erstritten hatten, oft unter Aufbietung großer Opfer, die euch erspart geblieben sind – und hoffentlich bleiben. Aber nimmst du dies noch wahr? Was bedeutet dir Freiheit? Und wie hoch würdest du dieses Ideal der Freiheit über deine gewohnte Bequemlichkeit setzen? Und wie viel Mut wärest du bereit aufzubringen, wenn wirklicher Mut erforderlich würde, wenn es ans sprichwörtliche Eingemachte ginge? Spannende Frage, sobald du dich ihr stellst; möglich wäre es immerhin, dass du schlecht abschneiden würdest!
Tröstlich allemal, dass es wohl zu gewissen Zeiten zwar immer wieder gelingen mag, Menschen in Ketten zu legen, jedoch nie jemand den Geist und die Gedanken auf Dauer zu fesseln vermochte. Zu keiner Zeit. Sie mögen sich vielleicht durch Repressalien vorübergehend lahmlegen lassen, in schlimmen Fällen für Jahre und Jahrzehnte. Jedoch, sie überleben, gelangen aus der Finsternis so manchen Kerkers unversehens wieder ans Tageslicht, werden weitergetragen, von nachfolgenden Generationen wieder hervorgeholt, neu erfunden, weiterentwickelt. Vermeintliches Scheitern legt den Grund für spätere neue Entwicklungen, der biblische Stein des Anstoßes wird zum Eckstein. Nur der einzelne Mensch selbst, der den Gedanken dachte, bleibt eingeschränkt in seinen irdischen Möglichkeiten. Sein Leben und die Zeit seines Wirkens ist begrenzt, sein Mühen hilft ihm nichts. Im Geistigen fortwirken – einzige Chance, die eigene Endlichkeit zu überwinden.
„Und es bleibt ein historisches Gedächtnis“, sagt dein Philosophenfreund, „eine geschichtliche Fortentwicklung der Menschheit. Rückfälle mögen eine andere Sprache sprechen, aber die Idee lebt im Geiste fort, bleibt im Gedächtnis, wird von späteren Generationen wieder aufgegriffen und kann so nicht mehr völlig verlorengehen. Kant sprach in diesem Zusammenhang von ‚Geschichtszeichen‘.“
Solchermaßen nachdenklich verlasst ihr den Stiftshof wieder – und seht in einem Schaukasten an der Pforte einen höchst merkwürdigen grünlichen Knochen ausgestellt. Beim verwunderten näheren Hinsehen und Lesen der Beschriftung erfahrt ihr: Es handelt sich um ein Schlüsselbein des Dichters Mörike – mit Danksagung an den Spender, den Prag-Friedhof Stuttgart. „Seit wann sammelt ihr als schwäbische Pietisten denn Reliquien?“, spottet dein Philosophenfreund vom römisch-katholischen Rhein. Eure Beklommenheit, die euch angesichts der Schatten der Vergangenheit befallen hatte, löst sich in befreiendem Gelächter auf.
Sehr irdisch und sehr diesseitig jetzt auch dein Bedürfnis nach Kaffee und Apfelkuchen – „mit einem Haufen Schlagsahne!“ Du gibst ein weiteres Mal Einführungen in die Feinheiten des Schwäbischen, während ihr das nächstbeste Café unsicher macht. „Die Dinge sind hier nicht immer das, was sie beim Klang des Wortes zu sein scheinen. Übrigens, mein Lieber: Als ich dich zum allerersten Mal sah, in jenem idyllisch anmutenden Restaurant mit Rheinpanorama, lautstark mit Mobiltelefon zugange, weißt du was mein erster Gedanke war?“ – „Nee?“ – „So ein Dackel!“ – „Wirklich?“ – „Ja! Seitdem gebe ich endgültig nichts mehr auf erste Eindrücke. Nebenbei: Es gibt im Schwäbischen eine ganze Menge „Dackel“ in verschiedensten Ausführungen. Ohne Vorsilbe ist es eher noch eine liebevolle Bezeichnung. Du kommst also noch gut weg!“ – „Tatsächlich?“ – „Ja.“ – „Und was ist dir noch aufgefallen?“ – „Deine Augen. Unsere tiefen Blicke gleich zu Beginn. Sie hatten mich verwirrt. Ich hätte schwören können, dass mir so etwas nicht mehr passiert. Ich hatte mich zu dieser Zeit anders eingerichtet. In einer Rolle, die eigentlich ganz gut zu mir passte. Die gut war für mich und mein Selbstvertrauen. Endlich eine, mit der ich klarzukommen glaubte. Und du kommst einfach und wirfst das alles einmal mehr über den Haufen!“ – „Schlimm?“ – „Ja!“ – „Und noch?“ – „Du willst es ja ganz genau wissen: Deine schönen Hände! Der Gedanke, sich ihnen auszuliefern, der hatte etwas…“
„Sollen wir eines Tages unsere Geschichte aufschreiben?“ Diese Frage beschäftigt euch. Das Leben schreibt keine Geschichten, wie sie in Lehrbüchern stehen. Was euch zustößt, passiert in Bruchstücken, die nur allzu oft nicht zueinander passen. Ursache und Wirkung geraten durcheinander, vermeintliche Gesetzmäßigkeiten werden auf den Kopf gestellt. Geschichten – Ge-schichten. Schichten. Geschichtet auf verschiedenen Ebenen. Fäden, ineinander verwoben, unentwirrbar verflochten. Äußeres Handeln, inneres Empfinden, Erinnerungen – eigene und die anderer. Ideen, Erwartungen, Sehnsüchte, Hoffnungen, die sichtbar oder unsichtbar teils übereinander lagern, teils ineinandergreifen, einander beeinflussen, bewusst oder unbewusst – und wiederum stets in Beziehung verlaufen zu den Fäden anderer Menschen. Menschen, die jeweils – wie du – eines Tages durch ihre Geburt in diese Welt kommen und beginnen, ihre Lebensfäden in dieses Gewebe zu schlagen, ohne zuvor gefragt zu werden, ob sie daran mitwirken wollen, um es irgendwann ebenso ungefragt durch ihr Sterben wieder zu verlassen. Bei Hannah Arendt wirst du später mehr darüber lesen. In der „Vita Activa“. Aber so weit bist du noch nicht. Längst nicht.
Schreibend versuchen, Ordnung in das Chaos zu bringen? Das haben Unzählige vor dir versucht. Mancher ist daran scheinbar gescheitert. Doch wer legt denn fest, wann ein Versuch als gescheitert zu gelten hat? Und wer sagt, dass eben nicht auch gerade im Scheitern ein Weiterkommen ist?
Da ist euer Dichter, dessen späteste Gedichte euch einen ganz anderen zeigen als einen Wahnsinnigen. Einen Umnachteten gar! Festzumachen woran? Dass er diese Gedichte mit „Scardanelli“ unterzeichnete, sie weit zurück in Tage datierte, die vor seiner eigenen Lebenszeit lagen, andere Male weit voraus in künftige Zeiten? Ein Kennzeichen für sein Aus-der-Zeit-gefallen-sein? Oder war es am Ende vielleicht nur Spiel? Wie womöglich auch seine Art, Besucher auf merkwürdige Weise anzureden, durch übertriebene Höflichkeitsbekundungen Distanz schaffend, in dem Wissen, dass sich viele von ihnen rein aus Neugier, zum Begaffen seines Zustandes eingefunden hatten? Oder doch Zeichen eines tieferen Wissens, das er in sich trug? Sonst wäre vermutlich solches nicht entstanden:
Die Linien des Lebens sind verschieden
Wie Wege sind und wie der Berge Grenzen.
Was hier wir sind, kann dort ein Gott ergänzen
Mit Harmonien und ewigem Lohn und Frieden.
Friedrich Hölderlin
(An Zimmern)
Ein letzter Blick zurück auf Tübingen. Zeitbedingt kurz war euer Besuch – erstaunlich, was er auszulösen vermochte. Eure Gedanken werden so schnell nicht mehr zur Ruhe kommen.
Aus Bettina Johl: Holunderblüten. Zwei Liebende auf den Spuren Hölderlins. Roman. Erschienen 2020 als Sonderausgabe von literaturkritik.de. Seit dem 20.12.2020 auch als E-Book (PDF) erhältlich.