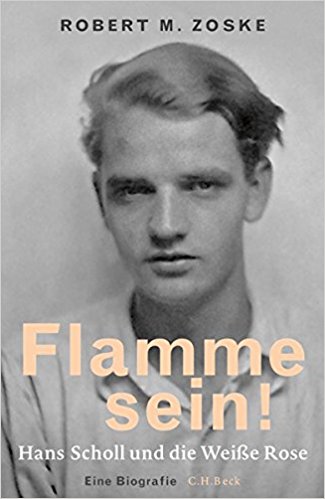XVII
Die erste Idee ist natürlich die Vorstellung von mir selbst als einem absolut freien Wesen. Mit dem freien, selbstbewussten Wesen tritt zugleich eine ganze Welt – aus dem Nichts hervor – die einzig wahre und denkbare Schöpfung aus dem Nichts.
Friedrich Hölderlin
(Aus: Das Älteste Systemprogramm des Deutschen Idealismus)
Der Dichter als Philosoph? Als ein solcher sah er sich zweifellos. Er bestand darauf, als Dichter notwendigerweise Philosoph sein zu müssen – und umgekehrt. Die Bereiche Dichtung und Philosophie sah er als untrennbar an und widmete sich zeitlebens der Aufgabe, die er sich selbst gestellt hatte: Beide einer neuen Einheit zuzuführen.
Ihr lest: Die Idee der Schönheit, die sich in der Kunst ausdrückt, sei die Idee, die alle anderen Ideen vereinige, und ein Philosoph müsse gerade so viel ästhetische Kraft besitzen wie ein Dichter, sonst nämlich bleibe er ein Buchstabenphilosoph, den keiner verstehe und der somit auch das Volk nicht erreiche. Die Poesie hingegen müsse wieder die Rolle der Lehrerin der Menschheit übernehmen, wie sie diese bereits zu Beginn innehatte. Und letztlich – so schließt er kühn – werde die Dichtkunst alle anderen Wissenschaften und Künste überleben.
Große Worte eines jungen Menschen. Er wird ihnen treu bleiben. Du staunst. Die Dichtkunst wird also überleben. Wird sie in letzter Konsequenz das sein, was bleibt? Das Schriftfragment, in dem sich all dies findet, nennt sich das „Älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus“. Es handelt sich hierbei um einen Entwurf der Tübinger Studienfreunde, nach Aussage der Forschung überliefert in Hegels Handschrift, nach einem Konzept von Schelling – und deutlich geprägt durch euren Dichter. Viele der hier enthaltenen Gedanken finden sich nahezu wörtlich im „Hyperion“ wieder, den er in sehr jungen Jahren begann und an dem er viele Jahre arbeitete. Ein Entwurf, nicht ganz vollständig erhalten, welcher Anfang 1797 entstand, als das bezeichnete Dreigestirn nach Jahren, in Frankfurt, zu erneutem Austausch wieder zueinander fand.
Dies also wurde vor mehr als zweihundert Jahren zu Papier gebracht durch drei außergewöhnlich begabte, noch junge Menschen. Zu dieser Zeit hatte noch keiner von ihnen das dreißigste Lebensjahr erreicht. Es beschäftigt dich. Wie ergeht es euch, wenn ihr aus heutiger Sicht darauf schaut? Wie ist es heute um Philosophie und Dichtkunst bestellt?
Revolutionen, Weltkriege, die technische Entwicklung und der allgemeine Lauf der Zeit haben die Gesellschaft verändert wie nie zuvor. Die Philosophie scheint inzwischen ein Schattendasein unter den Wissenschaften zu führen, geistert durch die Feuilletons, welche nur von einem kleinen Kreis gelesen werden. Oftmals erscheinen dir diese eher als eine Spielwiese der Selbstdarstellung, wo mit Begriffen jongliert wird, angesichts derer du dich fragst, ob jene, die sie verwenden, sie eigentlich selber verstehen. Oder sollten diese einzig dem Zweck dienen, beim Leser Erstarren in Ehrfurcht vor vermeintlicher geistiger Überlegenheit auszulösen?
Feuilletonbeiträge, so verriet dir einmal ein Zeitungsmensch, der es eigentlich wissen sollte, würden allgemein wenig gelesen, dies erkläre auch das Phänomen, dass immer wieder einmal auch Beiträge darin auftauchen, die sich einer problematischen oder ausgrenzenden Sprache bedienen und die erwartete Reaktion darauf bleibe aus, weil es einfach niemand gelesen habe. Eigentlich diene ein Feuilleton vor allem dazu, eine Zeitung aufzuwerten. Der Leser, auch wenn er es nicht liest, würde es dennoch vermissen, wäre es nicht vorhanden, verleiht es doch der Zeitung das gewisse Niveau. Dies wertet wiederum auch den Leser auf, er liest schließlich ein anspruchsvolles Blatt, selbst wenn dies Lesen sich auf das Überfliegen der Schlagzeilen beschränken sollte. Noch immer dieselbe oberflächliche Eitelkeit und Beliebigkeit also, die sich bezeichnend als „feuilletonistisches Zeitalter“ in Hermann Hesses „Glasperlenspiel“ kritisiert findet?
Philosophen also ungestört unter sich im Elfenbeinturm? Unbeachtet – und damit auch ungestört – vom Rest der Welt? „Stimmt so nicht!“, sagt dein Philosophenfreund, der sich unter denselben bewegt. Möglicherweise hat er Recht. Aber der Eindruck bleibt. Auch wenn immer einmal wieder Vertreterinnen und Vertreter einer jüngeren Philosophengeneration die Fernseh-Talkshows für sich entdecken.
Und du stellst dir die Frage: Wem nützt Philosophie, solange ihre Vertreter dem Leser suggerieren, ihre Inhalte könnten von einfach denkenden Menschen nicht verstanden werden? Wäre es hier nicht höchste Zeit, sich einzumischen?
Jung war sie damals: Die Vorstellung des Menschen von sich selbst als absolut freiem Wesen, bestimmt zum freiheitlichen Handeln, die aus dem Gedankengut der Aufklärung und der Französischen Revolution entstand. In Deutschland und von Deutschland aus wurde diese maßgebend geprägt durch die Philosophen Kant, den euer Dichter in Tübingen eingehend studierte, und Fichte, den er später in Jena hörte. Von dem er tief beeindruckt war und der ihm Denkanstöße lieferte, seine eigenen Ideen im Hinblick auf den schöpferischen, den Kunst schaffenden Menschen weiter zu entwickeln.
Was genau hat es aber mit Kant und Fichte auf sich? Die Philosophie hat dich in ihren Bann gezogen, jetzt willst du es doch genauer wissen. Hast die Konversationsebene verlassen. Über Kant lässt sich ja auf dieser noch irgendetwas zusammenbringen. Sofern es einer versteht, durch Herumwirbeln von Begriffen und Zitaten zu bluffen, lässt sich mit diesem Philosophen durchaus einen Abend lang Konversation treiben. „Der kategorische Imperativ, ja, ja!“ Den meisten wird es nicht auffallen, weil sie es zwar chic finden, sich über Kant zu unterhalten, dessen Namen sie ja schon mal gehört haben, auch wissen, dass das jemand Bedeutendes gewesen sein muss, aber möglicherweise insgeheim überlegen: Wer war das noch mal? Ein Modeschöpfer vielleicht?
Triffst du aber zufällig doch auf jemanden, der sich auskennt, wird derjenige in der Regel vor Begeisterung völlig außer sich sein: Wahnsinn, hier interessiert sich jemand für Kant! So dass auch er es nicht unbedingt mitbekommt, wenn du in Wirklichkeit nur Blödsinn erzählst. Auch dein Philosophenfreund wäre einst fast darauf hereingefallen.
Nun, Kant hatte in der Philosophie völlig neue Perspektiven geschaffen, indem er sich in der „Kritik der reinen Vernunft“ mit den Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis genauestens auseinandersetzte – und darauf aufbauend in der „Kritik der praktischen Vernunft“ mit Fragen der Ethik sowie in der „Kritik der Urteilskraft“ mit Fragen der Ästhetik. Dies klingt nach sehr viel akribischer Arbeit und sehr viel Theorie. Das ist es auch und schon für sich genommen dazu geeignet, euch ein Leben lang beschäftigt zu halten. Nicht jeder Mensch bringt hierzu die Zeit und Geduld auf, obwohl es sich gewiss auszahlen würde. Aber zumindest lohnt es, sich den Leitsatz der Aufklärung, den Kant prägte, hinter die Ohren zu schreiben:
Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!
Damit wäre schon jede Menge gewonnen. Hingegen bei Fichte verlassen dich zunächst alle guten Geister und so wird es Zeit, dass du dich dahinterklemmst. Hier auf deinem „Zauberberg“, wo du ein wenig Auszeit hast.
Wenigstens liegt dein Wissensmangel diesmal nicht darin begründet, dass du in der Schule schlicht gepennt hast; das hast du zwar in der Tat, aber Philosophie kannst du nicht verschlafen haben, denn – es gab sie nicht. Im Gegensatz zu manchen anderen Ländern in Europa ist Philosophie an deutschen Schulen eher nicht im Lehrplan vorgesehen, wird als eigenes Fach bis heute selten gelehrt. Und damit fängt das Elend an – und nimmt seinen weiteren Lauf.
Es führte nebenbei zu dem Phänomen, dass sich Menschen wie du im Erwachsenenalter auf „Sophies Welt“ von Jostein Gaarder stürzten, ein Buch, das sich eigentlich an Jugendliche richtet. Ihr kauftet es unter dem Vorwand, es euren Kindern schenken zu wollen. Und last es dann selbst, verschämt, unter der Bettdecke. Denn die Kids hatten auf so etwas gar keinen Bock, das roch ja viel zu sehr nach Bildung! Und so habt ihr auf diese Weise erstmals in verständlicher Form etwas über Philosophie erfahren. Die Kritiker freilich spotteten über das Buch – und über euch, seine unfreiwilligen Leserinnen und Leser, gleich mit. Sie versuchten, es schlecht zu reden, weil es seine Zielgruppe verfehlt hatte. Aber es gelang ihnen glücklicherweise nicht, das einmal entflammte Interesse wieder zu ersticken. Du erinnerst dich sogar an einen Doktor der Philosophie, der sich davon begeistern ließ. Er trug eine Baskenmütze wie Alberto Knox und bot unter dem Motto „Sophies Welt“ Philosophiekurse für Erwachsene an. An einem Ort, den du selbst für jegliche Philosophie verloren hieltest, aber er – unerschütterlicher Idealist – ließ sich davon nicht beeindrucken; er hielt seine Stunden auch, wenn sich nur fünf Leute einfanden. Von seinem Naturell war er eigentlich ein eher schüchterner Mensch und – das Angenehme an ihm – alles andere als ein Meister der Selbstdarstellung, demzufolge fielen jedoch seine sehr förmlich gehaltenen Vorträge mitunter etwas monoton aus, führten zu schweren Augenlidern während später Abendstunden in den muffigen Räumen der Volkshochschule, nach langen, mit stumpfsinniger Arbeit ausgefüllten Tagen. Anders eure anschließenden Gespräche auf der Straße vor dem Café, in das ihr irgendwann umzogt, unter freiem Himmel, der für eure Gedankenflüge brav die Kulisse lieferte. Du hast ihn ausgebeutet, denkst du rückblickend – und meinst damit nicht den Himmel. Ihn allzu oft über ungebührliche Zeit aufgehalten mit deinen Fragen und verrückten Gedankenspielen, die sich einstellten, sobald an frischer Luft deine Müdigkeit wie weggeblasen war. Er nahm es heiter und gelassen. Und auf zwei Gebieten hattest du einen Vorsprung: Er wusste die erstaunlichsten Dinge, aber, wie er freimütig zugab, wenig über die Bibel und praktisch nichts über den Sternenhimmel. Gebiete, die du dir in Eigenregie bereits etwas erschlossen hattest. So besaß jeder Teile eines großen Puzzles, die sich zuweilen ergänzten. Dies machte eure Gespräche zu etwas Wertvollem. Glücklich, wer in jedem Lebensalter immer wieder Lehrer findet, die das Denken auf neue Bahnen lenken helfen. Du hattest dieses Glück sehr oft.
Hier bist du auf dich gestellt, aber Selbstdenken – siehe Bettine! – und Selbstlernen ist ja keineswegs verboten, und so findest du dich nun alsbald mit einem Notizbuch gewappnet, alles zusammenschreibend, was du über Fichte in Erfahrung bringen kannst. Und findest zusehends Spaß daran.
In allem Anfang ist Legende: Johann Gottlieb Fichte, der begabte Sohn eines Webers aus der Oberlausitz, hütet eines Sonntags auf der Gemeindewiese hinter der Kirche das Vieh. Frondienst, der vor Kindern keineswegs Halt machte. Gewiss noch eine der angenehmeren Tätigkeiten. Etwas langweilig vielleicht. Andere hingegen mussten weniger früh aufstehen. Da gab es den Gutsherrn, mit dem auf einen Mann seines Formats nicht unpassenden Vornamen Haubold. Dieser hatte an jenem Morgen schlicht verschlafen und kam demzufolge zu spät zum Gottesdienst, wodurch er die Predigt verpasste, die er doch wohl ganz gern gehört hätte. Jedenfalls brachte er sein Bedauern darüber in einem Gespräch mit anderen Kirchenbesuchern, die wie üblich nach dem offiziellen Ende noch schwatzend in Grüppchen beieinander standen, zum Ausdruck. Das war die Stunde des unfreiwillig mithörenden jungen Fichte, der ihm daraufhin die Predigt, die er selbst durchs Kirchenfenster mitbekommen und im Kopf behalten hatte, auswendig vortrug, nicht ohne hierbei den Pfarrer auf unterhaltsame Weise zu imitieren. Und es schaffte, den edlen Herrn nachhaltig zu beeindrucken. Dieser beschloss umgehend, ein solch aufgewecktes Bürschchen müsse unbedingt gefördert und auf entsprechende Schulen geschickt werden. Eine Sache, die er auch sogleich mit den Mitteln, die ihm – anders als den Eltern des Jungen – zur Verfügung standen, in die Hand nahm.
Wie sagte doch schon dein geschätzter Konfirmandenpfarrer? Es hat noch keinem geschadet, bei der Sonntagspredigt die Ohren zu spitzen!
Eben war der Weg, den Fichte dadurch einschlagen konnte, jedoch keineswegs. Denn nach einer gewissen Zeit verstarb der Gutsherr und die Begeisterung seiner Erben für diese Art von Bildungssponsoring dürfte sich bereits zu dessen Lebzeiten in Grenzen gehalten haben. Unterstützung war also nicht länger zu erwarten. Der herangewachsene Fichte brach sein Studium ab und schlug sich – ähnlich wie später euer Dichter – mit Hauslehrerstellen durch. Nach mehreren gescheiterten Versuchen, beruflich oder schreibend Fuß zu fassen, beschäftigte er sich mit der Philosophie Kants, der er schon während des Studiums sehr zugetan war. Als er Kant einige Zeit später in Königsberg besuchte, war dieser von ihm sehr beeindruckt und half ihm, seine Schrift „Versuch einer Critik aller Offenbarung“ zu verlegen, eine religionsphilosophische Abhandlung, von der lange angenommen wurde, dass sie von Kant selbst stamme. Als dies schließlich durch Kant richtiggestellt wurde, bedeutete es den wissenschaftlichen Durchbruch Fichtes. Er wurde an die Universität Jena bestellt, wo euer Dichter schließlich mit ihm in Berührung kommen sollte.
Bezeichnend für die Philosophie Fichtes ist nun die Bedeutung, die er dem Begriff des Ich – großgeschrieben! – als dem aktiven, in Freiheit handelnden Part zuschreibt. Er baut diesen Gedanken weiter aus: Dem Ich entgegen steht – so nennt er es – die Welt des „Nicht-Ich“. Dieses „Nicht-Ich“ bezeichnet wiederum alles, was die Freiheit des Ich bestreitet. Die Begrenzung durch das „Nicht-Ich“, also durch äußere oder innere Umstände, welche das Ich angeblich am Handeln hindern, sei jedoch – so Fichte – in Wirklichkeit eine reine Selbstbegrenzung. Und damit eine faule Ausrede! Es gelte stattdessen, die Menschen aus ihrer Lethargie wachzurütteln. Das ganze Gejammer über angeblich unabänderliche Gegebenheiten: Unsinn! Fichte ist davon überzeugt: Es gibt diese nicht. Was er für das wahre Übel des Menschen hält, benennt er hingegen unumwunden: Die Trägheit! Mit heutigen Worten: Wenn das Ich nicht in die Pötte kommt, dann läuft gar nichts, dann ist es geradezu so, als wären wir schon lange tot! Oder nie lebendig gewesen. Der Mensch, so Fichte, tendiere stets stärker dazu, sich zum getriebenen Objekt als zum handelnden Subjekt zu machen und sich auf diese Weise zu verstecken und sich vor dem Denken und Handeln zu drücken. Warum? Weil die ansonsten so vielgepriesene Freiheit unbequem ist! Weil sie erfordert, Verantwortung zu übernehmen, was – wie wir wissen – seltener Lust als Last bedeuten kann. Das Subjekt jedoch – nicht das Objekt! – liege in Wahrheit allem zugrunde: Das Subjekt als das tätige und erkennende Ich, das sich seiner selbst bewusst sein muss, und dieses wiederum „setze sich selbst“. Es bringe sich selbst aus dem Denken hervor und sei weltbildend.
Seiner selbst bewusst! Weltbildend! Dies klingt für dich doch alles eigentlich sehr modern und weckt so gar nicht den Eindruck, bereits vor zweihundert Jahren gedacht worden zu sein. Was bedeutet dies nun umgesetzt ins praktische Leben? Denn dafür war es ja doch wohl gedacht, zu Zeiten, als die Philosophie sich noch nicht in die Feuilletons verkroch?
Während einer Rast auf einer deiner ausgedehnten Wanderungen sendest du deinem Philosophenfreund eine Nachricht per Mobiltelefon:
Mein Lieber, bin im Wald unterwegs und kämpfe noch immer mit Fichte. Das passt hierher, Du weißt schon: Schwarzwald! Links Fichten, rechts Fichten, alles Fichte! Also, wenn ich es richtig verstanden habe: Das Ich bin ich! Sein, das ist nach Fichte Wahrgenommen-werden. Ich werde hier zwar höchstens von den Vögeln des Waldes wahrgenommen, weil sonst kein Mensch unterwegs ist, aber da ich den Wald hier wahrnehme und den Berg, der vor mir liegt, gehe ich einfach mal davon aus, dass es mich trotzdem gibt. So. Und dieser Berg hier ist das Nicht-Ich, welches mich begrenzt und sagt – oder sagen würde, denn dieser Berg hat natürlich nichts zu melden, das wäre ja noch schöner! – wenn dieser Berg also etwas zu sagen hätte, würde sich das vermutlich so anhören: „Hey, du kommst hier nicht rauf, ich bin viel zu hoch, und du hast null Kondition, also vergiss es besser! Und jetzt liegt die Entscheidung beim Ich – sprich bei mir! –, wie ich damit umgehe. Ob ich entweder sage: „Jawohl, der Berg hat Recht, ich gehe dann mal lieber gleich wieder zurück und lege mich ins Bett!“ Oder ob ich zum Berg sage: „Blödsinn! Hey, was willst du Berg? So hoch bist du nun auch wieder nicht! Ich hab schon ganz andere Berge geschafft, gegen die bist du geradezu ein Idiotenhügel!“ Was also heißt: Ich kann mich von dem Berg erschrecken lassen, so dass ich umkehre und mich ins Bett verkrieche. Oder ich kann ihn bezwingen. Im extremsten Fall könnte ich ja auch einen Bagger holen und ihn abtragen lassen. Aber ich entscheide, bedeutet: das Ich entscheidet, ob der Berg zu bewältigen ist oder nicht! Dies gilt ja dann wohl für alle Berge im übertragenen Sinne. Und dies ist daran das „Weltschaffende“? Die Welt erschaffe ich mir? Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt – nach Art von Pippi Langstrumpf. Hab ich Fichte nun kapiert oder nicht?
„Nun ja“, erreicht dich die Antwort deines klugen Philosophenfreundes, „ironisch genug, die Berufsphilosophen würden Dir empört nachstellen, aber im Prinzip ist Deine Interpretation richtig!“ Dein Glück. Von nun an erklärst du dich als befugt!
Das Weltschaffende muss für euren Dichter, als Künstler, der ja immer im weitesten Sinne weltschaffend – weltenschaffend! – ist, die höchste Bedeutung gehabt haben. Mit dem freien, sich seiner selbst bewussten Wesen, dem Individuum, tritt also eine ganze Welt aus dem Nichts hervor. Eine Welt aus dem Nichts? Das klingt geradezu nach einem göttlichen Schöpferanspruch. Die Kirche wird an solcherlei Gedankengut ihre Freude gehabt haben! Noch dazu an der sich daraus ableitenden Forderung:
…absolute Freiheit aller Geister, die die intellektuelle Welt in sich tragen, und weder Gott noch Unsterblichkeit außer sich suchen dürfen…
Heißt dies: Es kann kein Gott angenommen werden, außer, wir schaffen ihn in uns selbst? Und ebenso keine Unsterblichkeit, außer eine von und durch uns selbst geschaffene? Dies ist in der Tat starker Tobak! Aber warum eigentlich nicht? Die biblische Aussage lautet: „Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde.“ Was bedeutet: Der Schöpfer als Schaffender – kreativ er selbst! – schuf den Menschen zu seinem Ebenbild. Und wenn er das mit dem Ebenbild ernst meinte, dann schuf er ihn folglich als Schaffenden, als Kreativen! Was wäre daran so verkehrt, als dass man darum Scheiterhaufen errichten müsste? Die Unsterblichkeit wiederum – gewiss, die hätte der Mensch freilich gern, ohne sie sich erst extra schaffen zu müssen!
Im Weiteren die Forderung der Systemschrift:
Monotheismus der Vernunft und des Herzens,
Polytheismus der Einbildungskraft und der Kunst,
dies ist‘s, was wir bedürfen!
Was hindert uns also, an den einen Gott zu glauben und zugleich als Schaffende frei zu sein?
Die Rolle des Dichters, des Künstlers aber als Erzieher der Menschheit? Solches will schon sehr hochtrabend klingen. Auch in Fichtes „Reden an die Deutsche Nation“ ist von Erziehung die Rede, von sittlicher Bildung zur Freiheit, zur Selbständigkeit. Zur – hier ganz wörtlich – „Veredelung“. Das menschliche Verhältnis zur Freiheit müsse in einer Vernunft- und Werteerziehung verankert werden.
Und nun wird es erst recht interessant: Die Erhebung zur Vernunft und zum wahren Selbst lasse auch die Feindschaft zu anderen freien Individuen und Nationen entfallen, denn der so gebildete Mensch strebe danach, seine Mitmenschen zu achten, und er liebe deren Freiheit und Größe! Mit Knechtschaft hingegen könne er sich nicht abfinden. Weder bei sich, noch bei anderen. Und für die Deutschen müsse ein neues Selbst gefunden werden, welches über die Nation hinausgehe!
Womit es dir in deinem Herumschweifen gerade noch gelungen wäre, die Kurve zu bekommen. Denn dieser Frage „Was ist heute mit den Deutschen – mit uns – los?“, der wolltest du anfangs ja nachgehen. Dein Philosophenfreund wird sagen, du seist zu lange im Wald gewesen. Zu viele Fichten – zu viel Fichte! Du kannst dich höchstens mit den Worten Hyperions herauszureden versuchen:
Ich schweifte herum, wie ein Irrlicht, griff alles an, wurde von allem ergriffen…
Wie steht es nun um euch? Seid ihr inzwischen – wie von eurem Dichter gefordert – mit Ernst und mit Liebe das, was ihr wirklich seid? Lasst ihr „den Geist leben“?
Ein Rückblick auf die Geschichte macht auf beklemmende Weise bewusst, welch langer, mühsamer Weg zu gehen war, bis die Idee der Freiheit, immer wieder verleugnet, verschlafen, unterdrückt, jedoch von den Nachgeborenen auch immer wieder neu aufgegriffen, sich durchsetzen konnte. Die Rückfälle: Jeweils einer schlimmer als der vorherige. Banges Hoffen, dass daraus keine Gesetzmäßigkeit abzuleiten sei! Beklommenheit ob der fatalen Irrwege, welche die Suche nach dem Selbstverständnis – des Einzelnen im Singular, einer ganzen Gesellschaft im Plural – einschlagen kann. Bis hin zu Verbrechen, die alle Vorstellungskraft sprengen. Die Unfähigkeit mehrerer Generationen zur eigenen Erinnerung und Aufarbeitung. Das Erbe tragt ihr, die Nachgeborenen.
Ihr könnt euch lange darüber streiten, ob sich Schuld vererben lässt. Die alte Geschichte von der Erbschuld, der Erbsünde. Auch diese hat die Menschheit verdrängt, so gut sie eben konnte. Die Christenheit hat sie zur Kitsch-Geschichte mit Äpfelchen-essen und Verschämt-nackt-herumlaufen herab stilisiert. Aber ging es denn um den naschhaften Genuss von Früchten? Gar um die Frucht der von kirchlicher Seite gründlich verteufelten Sexualität? Geduldet eben noch zum Zwecke der Fortpflanzung, denn wie sollte sonst auch der Fortbestand an Untertanen gesichert bleiben?
Moment! Woher, von welchem Baum stammte die Frucht gleich noch mal? Hierzu würde sich eine Umfrage lohnen. Auf die Antworten wärst du, hast du doch selbst theologisch gebildete Menschen allzu oft merkwürdige Apfelgeschichten zum Besten geben hören, in der Tat gespannt!
Was hätte die Frucht wohl dazu gesagt, wäre sie denn je selbst zu Wort gekommen? Schreien hätte sie müssen, um sich Gehör zu verschaffen: „Hallo! Ich bin kein Apfel! Ich stamme nicht von einem Apfelbaum, sondern vom Baum der Erkenntnis! Um genau zu sein: Vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen!“
Und nun angenommen, jemand hätte auf sie gehört: Welche Frage hätte das nach sich gezogen? Genau: Warum? Was, bitte, sollte so schlimm daran sein, wenn dem Menschen der Sinn nach Erkenntnis von Gut und Böse stand und er deshalb seine Hand nach dieser Frucht ausstreckte? Daran wäre doch nichts Verwerfliches? Nach jetzigem Stand deiner Ermittlungen scheint es dir unwahrscheinlich, dass der Schöpfer sich am Bildungsbedürfnis seiner Geschöpfe, die er sicher nicht nur aus einer Laune heraus zu seinem eigenen Bilde geschaffen hatte, gestört hätte.
Was stimmte also nicht? Das Motiv! Denn Ermittlungen fragen immer auch nach dem Motiv. Und das war nicht der Hunger nach Erkenntnis, die darauf zielt, Herzensbildung und Weisheit zu erlangen. Hier ging es um das Wozu! Denn was sagte die Schlange? „Ihr werdet keineswegs sterben, – ihr werdet sein wie Gott!“
Sein wie Gott. Was mag mit dieser Vorstellung verbunden gewesen sein? Wenn „Sein wie Gott“ bedeutete, kreativ schaffend zu sein, wäre das doch bestimmt ganz im Sinne des Schöpfers und würde kein Verbot erklären. Außerdem: Kreativität war dem Menschen in seiner Ebenbildlichkeit mit dem Schöpfer sicherlich schon von Beginn an verliehen, daran dürfte es ihm nicht gefehlt haben. Im Hinblick auf anvertraute Talente hieß es an späterer Stelle im Neuen Testament gar, es sei verwerflich, nicht mit ihnen zu wuchern! Auch der Wunsch des Menschen nach Unsterblichkeit hätte nicht zwingend eine Vertreibung aus dem Paradies gerechtfertigt. Dass der Mensch, einmal in diese Welt gesetzt, ganz gerne lebt, ist ja noch kein Vergehen. Im Gegenteil.
„Sein wie Gott“ jedoch bedeutete noch etwas ganz anderes. „Sein wie Gott“ bedeutete die Möglichkeit, Macht zu erlangen. Macht auszuüben. Inklusive der Gefahr, Macht zu missbrauchen. Grund genug für den Schöpfergott, den Baum zur verbotenen Zone zu erklären!
Wenn wir solche Mythen als Versuch des denkenden Menschen deuten, sich seinen eigenen Ursprung, den der Welt und auch den allen Übels in der Welt zu erklären, wird nachvollziehbar, dass der Kirche daran gelegen war, den Kern der Geschichte von der Vertreibung aus dem Paradies im Dunkeln zu lassen! Und ihn stattdessen bis zur Unkenntlichkeit zu verpacken und ihren Schäfchen die Story vom Apfel und der Sündhaftigkeit körperlichen Verlangens zu erzählen.
Beim Sündenfall der Menschheit ging es um nichts Geringeres als um das Verlangen nach Macht. Eine Erkenntnis, die die Macht der selbsternannten Mächtigen ganz schön in Frage gestellt hätte! Macht, um derentwillen sich in der Folgezeit so ziemlich alles zutragen sollte, was auch immer in der Menschheitsgeschichte an Grausigem geschehen konnte. In der Tat ein Erbe, welches wie ein Verhängnis auf euch lastet! Auf euch als Menschen. Soviel zur Frage, ob sich Schuld erben lässt. Und ob ihr überhaupt die Wahl habt, das Erbe der Schuld anzunehmen oder abzulehnen. Ihr müsst dies für euch selbst beantworten. In jedem Fall jedoch erbt ihr die Verantwortung, es ist dies euer Pflichtteil. Diesen ausschlagen wäre verhängnisvoll! Und es liegt in euren Händen, was ihr im Weiteren daraus macht.
Die Klagen des Hyperion vor Augen: Führen, fragst du dich, an sich als wünschenswert überlieferte Tugenden wie Fleiß, Streben nach Wissen oder Religiosität gar zwangsläufig in die Barbarei? Eine schlimme Vorstellung. Nein! Nicht zwangsläufig, meint dein Dichter, aber dort, wo es ohne Seele betrieben wird, wo dem freien Geist kein Raum gelassen wird. Denn dann sind solche Tugenden nichts als dies:
…– ein glänzend Übel und nichts weiter…
Immer wieder richtete sich euer Dichter gegen alles, was er als „ohne Seele betrieben“ ansah. Seine lebenslange Weigerung, eine Pfarrstelle anzutreten, auf die seine Ausbildung im Eigentlichen ausgerichtet war, wird vor diesem Hintergrund verständlich. In einem Brief an seine Mutter, welche ihn aus Sorge – auch der, womöglich das Stipendium zurückzahlen zu müssen – allzu gern auf einer solchen gesehen hätte, mit der er sich jedoch erstaunlicherweise sehr offen über persönliche Glaubensfragen auszutauschen pflegte, äußert er sich unter anderem über:
die Schriftgelehrten und Pharisäer unserer Zeit, die aus der heiligen lieben Bibel ein kaltes, geist- und herztötendes Geschwätz machen, die mag ich freilich nicht zu Zeugen meines innigen, lebendigen Glaubens haben.
(Brief an die Mutter vom Januar 1799)
Wie ist es aber um die deutlich beim Namen genannte „feige Angst“ und „Sklavenmühe“ bestellt? Hierzu dient dir dein „Zauberberg“ mit seinen Bewohnern – vorübergehende freilich, wie du selbst – als Mikrokosmos.
Strikte Sitzordnung im Speisesaal. Abweichungen werden geahndet. Zumindest steht dies in der ausgehängten Saalordnung so geschrieben. Kaum traut man sich, für eine Tasse Kaffee nach der Mahlzeit zwecks tischübergreifender Gespräche vorübergehend den Platz zu wechseln. Im Weiteren allerdings ist die gesamte Hausordnung sehr milde gehalten. Ausgehzeiten bis 23 Uhr, an Wochenenden und vor Feiertagen sogar bis Mitternacht. Der Speisesaal als letzte Bastion, die verhindern soll, dass die völlige Anarchie ausbricht? Deine Tischnachbarin, aus Hamburg angereist, die sich durch das Einladungsschreiben, wie sie erzählt, zunächst in helle Aufregung versetzen ließ, weil darin stand, man habe am ersten Tag pünktlich bis zwölf Uhr vor Ort zu sein. Sie wusste, dass dies für sie selbst bei einer frühen Zugverbindung nicht zu schaffen gewesen wäre. Als sie schließlich anrief, löste sich alles auf; es stellte sich heraus, dass dies von Anreisenden aus solcher Entfernung keineswegs erwartet wurde, sie selbst falle also nicht unter diese Regelung. Aber das Phänomen, dass allein die Nennung einer vermeintlichen Vorschrift diesen Höllenrespekt auslöste! Ihr konntet gemeinsam darüber lachen: Dies saht ihr als sehr typisch deutsch!
Andere siehst du sich mit verordneten Aktivitäten in ihrem Therapieplan quälen, mit dem sie sich insgesamt überfordert fühlen. Obgleich immer wieder erwähnt wird, wenn man mit etwas nicht zurechtkomme, genüge es, sich an die Therapieleitung zu wenden und das eine oder andere abzuwählen, tun dies nur wenige. Das Leitungsbüro gilt als Höhle des Löwen, warum, weiß keiner so richtig, aber man mag nicht hingehen, befürchtet, dadurch Nachteile zu erleiden oder Schwierigkeiten mit dem zahlenden Leistungsträger zu bekommen. Oder man hat einfach nur Angst, schief angesehen zu werden. Auch dieses sehr deutsch? Alles Mögliche tun, was einem eigentlich völlig gegen den Strich geht, nur damit keiner schief schaut! Feige Angst und Sklavenmühe? Unser Erbe scheint uns nicht völlig abhanden gekommen!
Ihr alle, die Zauberberg-Besatzung, kommt gesundheitlich angeschlagen aus einer modernen Arbeitswelt, die zunehmend krank macht. Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage und die Angst vor dem Gespenst Arbeitslosigkeit führen immer mehr dazu, unhaltbare Arbeitsbedingungen wider besseres Wissen hinzunehmen. Vorhandene Rechte nicht einzufordern, Errungenschaften früherer Generationen, die zu Verbesserungen geführt hatten, gar wieder aufzugeben! Immer unmenschlichere Schichtpläne. Vereinbarkeit von Familienleben und Beruf: Fehlanzeige! Immer schlechtere Bezahlung, immer weniger Arbeitspausen. Die Gesundheit bleibt auf der Strecke. Schleichend und stetig. Aber: Bloß nicht den Mund aufmachen, wer weiß, was dann womöglich an Schlimmerem passiert! Feige Angst und Sklavenmühe.
Dennoch lebst du – lebt ihr – in einer Gesellschaft, die im Laufe der Zeit vieles gelernt hat, auch, manches kritisch zu sehen und Verantwortung zu übernehmen. Anlass zur Sorge siehst du dennoch, denn im neuen Jahrtausend wächst eine neue, angepasste Generation heran, die nicht mehr gelernt hat, zu kämpfen und sich mit wichtigen Fragen auseinanderzusetzen. Wofür sie nichts kann. Ihre Eltern haben sie davon ferngehalten, wollten bestenfalls, dass sie es „mal besser haben“. Und an den Schulen wird solches nicht vermittelt. Hinzu kommt ein Bildungssystem, das keine gerechten Entwicklungschancen bietet. Es produziert Gewinner und Verlierer, aber keine mündigen Menschen.
Philosophie wird – wie schon hinlänglich beklagt – nicht gelehrt, allenfalls das Fach Ethik, um zu verhindern, dass sich die über Vierzehnjährigen, die sich tunlichst vom Religionsunterricht abgemeldet haben, unterdessen in Cafés herumdrücken. Die Forderung „Ethik für alle“, die der Schlüssel sein könnte zu einem besseren Miteinander, scheitert am Widerstand der Kirchen.
Der Dichtung widerfährt noch weit Schlimmeres. Sie wird in den Schulen zerlegt und zu Tode interpretiert. Wenn der Mensch der Schule entronnen ist, so fürchtest du, wird in nur wenigen Exemplaren seiner Spezies die Liebe zur Dichtung überlebt haben. Mit sehr viel Glück – so hast du es erlebt – kann sie eines Tages wieder geweckt werden. Der traurige Rest hat sie mit Erfolg ausgetrieben bekommen, wird im krassesten Falle Dichtung hassen, sie nie wieder zur Hand nehmen – und fürs Leben verdorben sein! Nicht für das Leben im Sinne von bloßem Überleben. Das sicher nicht. Auch nicht fürs Karrieremachen und Kohlescheffeln. Viele werden auch durchaus eine Familie gründen und versuchen, ihre Kinder im hergebrachten Sinne „anständig“ zu erziehen. Und sie werden sie in die Schule schicken…
Aus Bettina Johl: Holunderblüten. Zwei Liebende auf den Spuren Hölderlins. Roman. Erschienen 2020 als Sonderausgabe von literaturkritik.de. Seit dem 20.12.2020 auch als E-Book (PDF) erhältlich.