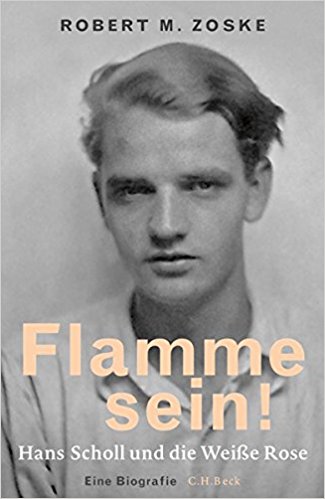XXV
Doch uns ist gegeben,
Auf keiner Stätte zu ruhn,
Es schwinden, es fallen
Die leidenden Menschen
Blindlings von einer
Stunde zur andern,
Wie Wasser von Klippe
Zu Klippe geworfen,
Jahr lang ins Ungewisse hinab.
Friedrich Hölderlin
(Aus: Hyperions Schicksalslied)
Ein hohes Grabmal, ein rechteckiger Sandsteinpfeiler-Schaft auf einer Plinthe, mit gusseisernem Kreuz auf dem Kapitell. Schlichter gehalten, als du vermutet hattest. Auf der Vorderseite die Inschrift:
FRIEDERICH
HÖLDERLIN
GEB. 20. März 1770
GEST. 7. Juni 1843
Friederich? Beim näheren Hinschauen siehst du, dass auf dem Kapitell, wie nach jüdischem Brauch, Steine abgelegt sind. Zwei frisch bepflanzte Blumenschalen. Immerhin. An Uhlands Grab, auf der anderen Seite des Hauptweges gelegen, findet sich außer Efeu nichts sonst. Sie suchen ihn noch auf, euren Dichter. Zwei Frauen treten soeben vom Grab, als du hinzukommst. Ansonsten bleibst du allein.
Hier schließt sich der Kreis, denkst du. Lange genug hast du gebraucht, herzukommen. Mehr als vierzig Jahre. Du meine Güte! Lag es daran, dass der Gedanke an das Schicksal deines Dichters stets begleitet war von gewissem Schaudern? In derselben Stadt geboren sein ist die eine Sache. Eine Stadt, die sich erst seit kurzem auf ihn besinnt. Aus demselben Grund? Was hast du so oft zu hören bekommen? „Hör mir bloß auf mit dem Hölderlin! Was der geschrieben hat, versteht sowieso kein Mensch, außerdem ist er am Ende verrückt geworden!“
An der rechten Seite des Steins steht in verwitterten, kaum lesbaren Großbuchstaben – sehr gedrängt, wohl aus Platzmangel, Doppelbuchstaben teilweise nur einfach, mit Oberstrich versehen – ein Vers aus dem Gedicht „Das Schicksal“, das so überliefert ist:
Im heiligsten der Stürme falle
Zusammen meine Kerkerwand,
Und herrlicher und freier walle
Mein Geist in‘s unbekannte Land!
Eines der frühen hymnischen Gedichte, die noch sehr an Schiller erinnern, einst erschienen in dessen Zeitschrift „Neue Thalia“, zusammen mit dem Fragment von Hyperion. Allerdings mochte Hölderlin selbst dieses Gedicht schon vor dessen Veröffentlichung „nimmer leiden“, wie er seinem Studienfreund Neuffer in einem Brief verraten hatte. Seine frühe Schaffenszeit, die es nach all den Eindrücken im Turm gilt, sich ins Gedächtnis zurückzurufen. Dazwischen scheinen Welten zu liegen.
Auf der linken Seite des Grabmals findet sich in besser lesbarer Schrift:
Dem Andenken seines theuren Bruders Carl F. von Gok.
Die Widmung des um sechseinhalb Jahre jüngeren „Halbbruders“, „Stiefbruders“ oder welche Bezeichnung man immer verwenden mag, den er liebte und stets förderte. Offensichtlich hatte dieser die Inschrift in Auftrag gegeben. Nannte er seinen Bruder zuweilen „Friederich“? Beim Geburtsdatum, liest du später, habe er sich auch vertan, die 20 sei eigentlich eine 29, da es hier wohl Irrtümer oder vorübergehende Unklarheiten gab. Es ist dir nicht aufgefallen. Die Neun ist so elegant geschwungen, dass sie auch für eine Null durchgehen könnte. Es heißt, auch die Schwester hätte sich gern in der Grabinschrift verewigt gesehen, was der Bruder jedoch nicht zuließ. Es gab Streit. Wie eben in den besten Familien.
Die Schwester. Rike. Maria Eleonore Heinrike Hölderlin, später mit einem Pfarrer verheiratete Breunlin. Die nur zwei Jahre jüngere Schwester, mit der euer Dichter in frühen Jahren in regem Briefwechsel stand. Der er im Alter von einundzwanzig Jahren gestand, sein höchster Wunsch sei:
… in Ruhe und Eingezogenheit einmal zu leben – und Bücher schreiben können, ohne dabei zu hungern…
Von beiden Geschwistern erhielt er selten Besuch im Turm. Wenn denn Begegnungen stattfanden, sollen sie sich unerfreulich gestaltet haben. Zu fremd war man sich geworden. Die Mutter hingegen, die sein Vermögen und Erbe verwaltete und bei seinem Unterhalt auf schwäbische Art nicht wenig geknausert haben soll, betrat den Turm nie.
Gleichgültigkeit? Gefühlskälte? Oder: Einfach nur Überforderung angesichts der offensichtlich zerrütteten Verfassung eines geliebten Menschen, den man einst ganz anders kannte? Dessen Zustand einen zu sehr schmerzt, als dass es zu ertragen wäre. Darüber zu urteilen steht niemandem an. Oft hörst du, für die Angehörigen sei so etwas stets am schlimmsten, während der Betroffene selbst seinen Zustand ja gar nicht mehr mitbekomme. Wirklich nicht? Unter den spätesten Zeugnissen eures Dichters findet sich jedenfalls auch dieses:
Nicht alle Tage nennet die schönsten der,
Der sich zurücksehnt unter die Freuden wo
Ihn Freunde liebten wo die Menschen
Über dem Jüngling mit Gunst verweilten.
Dies klingt nicht nach einem Verrückten. Auch nicht nach einem Menschen, der sich der Tragik seines Zustandes nicht bewusst ist. Der Schmerz über alles Verlorene muss zumindest phasenweise in seinem Bewusstsein gegenwärtig gewesen sein. Wenn nicht gar die ganze lange Zeit hindurch.
Viel später wirst du die Streitschrift eines Arztes lesen, der sich über viele Jahre mit Hölderlins Fall beschäftigte und zu dem Ergebnis kam, dass der Dichter Herzprobleme hatte, was seine Unruhe und das nächtliche Umherwandeln, auch das plötzliche, heftige Aufreißen von Fenstern, das ihm nachgesagt wurde, erklären könnte. Eine Schizophrenie, wie man sie ihm oft anhängen wollte, schließt jener völlig aus, nicht ohne es schlüssig zu begründen. Als Ursache für die Veränderungen im Verhalten des Dichters, wie die Anflüge von großer Ängstlichkeit und den völligen Rückzug in sich selbst, während das Gehirn ansonsten nachweislich noch sehr gut funktionierte, vermutet er eine schleichende Vergiftung durch ein quecksilberhaltiges Medikament, das früher in der Psychiatrie oft verabreicht und inzwischen aus dem Verkehr gezogen wurde. Dies würde manches erklären und kommt deinen Vermutungen entgegen.
Die Nachricht vom Tod des Dichters wurde von der Allgemeinen Zeitung mit dem Zitat aus der Schlussstrophe von Hyperions Schicksalslied versehen:
Doch uns ist gegeben,
Auf keiner Stätte zu ruhn…
Statt des Pathos, von dem die Grabinschrift zu künden versucht, hier sehr viel Trauer, fast schon an Resignation grenzend. Immerhin, denkst du, hat es durchaus sein Gutes, wenn Inschriften und Nachrufe für einen Toten aus dessen eigener Feder stammen, die Hinterbliebenen nicht genötigt waren, Nachschlagewerke zu Rate zu ziehen, die heute Titel wie „Tausend Sprüche für tausend Anlässe“ tragen!
Wer der Nachwelt ein literarisches Erbe hinterlässt, riskiert allerdings auch, dass diese damit nach eigenem Gutdünken verfährt. Dass sie etwa Schriften herausgibt, die nicht zur Veröffentlichung vorgesehen waren, dafür umgekehrt womöglich ihr Unliebsames unauffindbar verschwinden lässt. Auch dass es zu missverständlichen Auslegungen kommt, die der Verstorbene nicht mehr richtigstellen, geschweige denn sich dagegen verwahren kann.
Und es bringt auch die Gefahr mit sich, eines Tages im schlimmsten Fall für neue, fragwürdige Ideologien missbraucht zu werden. Auch vor eurem Dichter machte der Nationalsozialismus nicht Halt: Schöner sterben für „Führer, Volk und Vaterland“ – mit Hölderlin im Feldgepäck! Ein Meer von Hakenkreuzfahnen auf diesem Grab bei der Gedenkfeier zum 100. Todestag. Welch ein Zynismus! Umso mehr der Umstand, dass es vielen dieser Leute gelang, die Deutungshoheit über das Erbe des Dichters an sich zu reißen und diese teilweise bis weit über die Nachkriegsjahre hinaus in ihrer Hand zu behalten, ungeachtet ihrer früheren Verstrickungen! Die Rede ist hier nicht von Mitläufertum. Ein Durchblättern der älteren Jahrbücher der 1943 gegründeten Hölderlingesellschaft und ein Nachschlagen der Autorennamen im Hinblick auf ihre Funktionen während jener unseligen zwölf Jahre genügt, um zu wissen, wie der Hase lief!
Erschöpfung will sich einstellen. Also zurück durch das noch immer tobende Gewühl in der Stadt, auf der Suche nach einem ruhigen Winkel für einen Kaffee. Zum Glück findest du ein Buch-Café am Nonnentor mit einem kleinen Blumen- und Kräutergarten, an dem der Hauptstrom größtenteils vorüberzieht und es unbehelligt lässt. Genau richtig für dich! Immer wieder kleine Winkel und Nischen zum Überleben finden. Blick auf die Uhr. Wenn du noch zur Wurmlinger Kapelle willst, musst du allmählich ans Aufbrechen denken!
Froh, die Stadt hinter dir lassen zu können, nimmst du die Straße, die du gekommen bist und biegst in Unterjesingen ab in Richtung Rottenburg, nach Wurmlingen zur Kapelle. Jene, der Ludwig Uhland in seinem bekannten Gedicht „Die Kapelle“ ein Denkmal setzte:
Droben stehet die Kapelle,
Schauet still ins Tal hinab.
Drunten singt bei Wies‘ und Quelle
Froh und hell der Hirtenknab.
Traurig tönt das Glöcklein nieder,
Schauerlich der Leichenchor;
Stille sind die frohen Lieder,
Und der Knabe lauscht empor.
Droben bringt man sie zu Grabe,
Die sich freuten in dem Tal;
Hirtenknabe, Hirtenknabe!
Dir singt man dort auch einmal.
Jener düsteren Mahnung eingedenk sich vierzehn Kreuzwegstationen den steilen Hügel empor quälen, allerdings mit jedem gewonnenen Meter eine schönere Aussicht genießen, zwischen Birnbäumen in voller Blüte und weißen, honigsüß duftenden Schwarzdornhecken. Vielfältiges Summen von Bienen und Hummeln, frühabendlicher Gesang vieler Vögel. Die Sonne scheint noch immer warm. Von Düsternis keine Spur. Die Kapelle ist von einem ummauerten Friedhof umgeben, der, wie neu angelegte Gräber bezeugen, noch als solcher genutzt wird. Schöne Aussicht und Gedenken an die Toten in einem.
Eher heiter-nachdenklich der Ton bei Nikolaus Lenau in „Die Wurmlinger Kapelle“:
Luftig, wie ein leichter Kahn,
Auf des Hügels grüner Welle
Schwebt sie lächelnd himmelan,
Dort die friedliche Kapelle.
Rötlich kommt der Morgenschein
Und es kehrt der Abendschimmer
Treulich bei dem Bilde ein,
Doch die Menschen kommen nimmer.
Einst bei Sonnenuntergang
Schritt ich durch die öden Räume
Priesterwort und Festgesang
Säuselten um mich wie Träume.
Leise werd‘ ich hier umweht
Von geheimen frohen Schauern,
Gleich, als hätt‘ ein fromm Gebet
Sich verspätet in den Mauern.
Und Maria’s schönes Bild
Schien vom Altar sich zu senken,
Schien in Trauer, heilig mild
Alter Tage zu gedenken.
Scheidend grüsset hell und klar
Noch die Sonn‘ in die Kapelle,
Und der Gräber stille Schar
Liegt so traulich vor der Schwelle.
Freundlich schmiegt des Herbstes Ruh
Sich an die verlass‘nen Grüfte;
Dort dem fernen Süden zu
Wandern Vögel durch die Lüfte.
Und der Baum im Abendwind
Lässt sein Laub zu Boden wallen,
Wie ein schlafergriff‘nes Kind
Lässt sein buntes Spielzeug fallen.
Alles schlummert, Alles schweigt,
Mancher Hügel ist versunken,
Und die Kreuze steh‘n geneigt
Auf den Gräbern – schlafestrunken.
Hier ist all mein Erdenleid
Wie ein trüber Duft zerflossen;
Süsse Todesmüdigkeit
Hält die Seele hier umschlossen.
Welche Landschaft, wenn nicht diese, kann die Bilder zu solchen Gedichten liefern? Und sie tut es heute noch. Auch in jüngerer Zeit versucht man sich hier jährlich im Dichterwettstreit.
Du selbst kannst dich dem Zauber des Ortes schwer entziehen, auch wenn die Kapelle verschlossen ist. Die Aussicht geht über den Neckar bis nach Rottenburg. Dahinter der Albtrauf mit den sich deutlich abzeichnenden Burgen Teck und Hohenzollern. Auf der rückwärtigen Seite das blütenreiche Tal der Ammer, durch das du gekommen bist. Hügel an Hügel, bis hin zu den ersten Erhebungen des Schwarzwaldes, darunter Dorf an Dorf, weite Wiesen, Obstbäume und Hecken. Weidende Schafherden auch. Hirtenknabe, habe Acht!
Warum zieht es zu allen Zeiten Menschen auf Berge und Anhöhen, um von oben hinunterzuschauen? Ist es der kurze Moment, in dem sich ein Gefühl der Freiheit einstellen will, angesichts der winzig klein erscheinenden Welt? In der die durch Menschen verursachte Hässlichkeit verschwindet, zurücktritt hinter ein harmonisches Ganzes? Die meisten Aussichten von oben werden als schön bezeichnet. Immer noch, auch heute. Macht dies die Illusion, wenigstens für einen Augenblick über allem zu stehen? Bevor du wieder hinunter musst ins Gewühl, dir erneut mühsam unter all jenen da unten deinen Platz suchen und – falls du ihn denn findest – ihn behaupten.
„Herr, lass uns hier oben Hütten bauen!“ Ein Wunsch, der bereits in biblischen Tagen unerfüllt bleiben musste. Euer Dichter und Philosoph, dem der ästhetische Sinn alles war, wusste es. Und du weißt es auch.
Aus Bettina Johl: Holunderblüten. Zwei Liebende auf den Spuren Hölderlins. Roman. Erschienen 2020 als Sonderausgabe von literaturkritik.de. Seit dem 20.12.2020 auch als E-Book (PDF) erhältlich.