Literatur im Lichthof (7/2015) - Zoom
Christoph W. Bauer: orange sind die äpfel blau. Gedichte.
Innsbruck: Haymon 2015. 20 Seiten.
 Dass das Bändchen bibliofil gestaltet ist, entspricht dem Charakter dieses Zyklus von 15 Gedichten. Sie sind traditionsgesättigte Lyrik, der es auf Klang und hohen Stil und Bildlichkeit als Merkmale des ‚schönen’ Gedichts ankommt. Die Anlehnung an lyrische Traditionen ist aber nicht epigonales Nachahmen, sondern Bauer macht diese Anlehnung zum Thema, indem er sie von Anfang an deutlich markiert, schon im Titel, der auf einen berühmten Vers von Paul Éluard anspielt („La terre est bleue comme une orange“), und dann in der Fülle von Bezugnahmen auf einen Zeitgenossen Éluards, den andalusischen Poeten Federico García Lorca, der immer wieder im spanischen Original zitiert wird. Das letzte Gedicht des Zyklus (XV) spricht den spanischen Lyriker direkt an: Dass das Bändchen bibliofil gestaltet ist, entspricht dem Charakter dieses Zyklus von 15 Gedichten. Sie sind traditionsgesättigte Lyrik, der es auf Klang und hohen Stil und Bildlichkeit als Merkmale des ‚schönen’ Gedichts ankommt. Die Anlehnung an lyrische Traditionen ist aber nicht epigonales Nachahmen, sondern Bauer macht diese Anlehnung zum Thema, indem er sie von Anfang an deutlich markiert, schon im Titel, der auf einen berühmten Vers von Paul Éluard anspielt („La terre est bleue comme une orange“), und dann in der Fülle von Bezugnahmen auf einen Zeitgenossen Éluards, den andalusischen Poeten Federico García Lorca, der immer wieder im spanischen Original zitiert wird. Das letzte Gedicht des Zyklus (XV) spricht den spanischen Lyriker direkt an:
höre dich lachen tief in mich
hinein dabei spreche ich nur
mit deinem porträt federico
„federico“ ist das letzte Wort des Gedichtbands.
Dass Lorca im Bürgerkrieg von den Faschisten ermordet worden ist (vgl. Gedicht XII), gibt Bauers Versen nicht gerade eine politische Dimension, doch schließt die Berufung auf den radikalen Republikaner Lorca von vornherein aus, den Bezug auf die literarische Tradition in reaktionärem Sinn misszuverstehen.
Wenn man die Gedichte genau liest, erkennt man rasch, dass der Dichter bei aller Nähe (und wohl auch Liebe) zur Tradition keineswegs konventionell schreibt. VIII, IX und XIII sind etwa 14zeilig – aber es sind dann doch keine Sonette, sondern sie deuten die Sonettform nur an (wobei in IX obendrein von Góngora, 1561-1627, die Rede geht). Und wie der Bezug auf den Andalusier durch das zitierte „nur mit deinem porträt federico“ in Frage gestellt wird, durchbricht der Lyriker immer wieder den einheitlichen hohen Ton, durch spanische Zitate ebenso wie in manchen Gedichten durch ganz aktuelles Vokabular wie „la muerte“, „verjuxen“, „verquaste“ in Gedicht XIII. Das ist nicht das einzige Beispiel.
Eine vielleicht mit Lorca vergleichbare Technik Bauers ist die Herstellung der Einheit jedes Gedichts trotz ganz verschiedenen Motiven in einem Text. Bauer setzt dazu eine raffinierte syntaktische Methode ein, die ich bei Lorca nicht gefunden habe (vielleicht wegen mangelnder Spanischkenntnisse): Er setzt immer wieder Wortgruppen so, dass man sie sowohl der Zeile zuordnen kann, in der sie stehen, wie der darauf folgenden. Zum Beispiel in I:
[…] so
reduziert sich alles auf ein paar
zeilen zwischen dir und mir
wachsen tiefen abgründe nicht
zu nennen wie die gipfel dort
oben bettet die eitelkeit sich
zur ruh […]
„zwischen dir und mir“ ist sowohl Attribut zu „ein paar zeilen“ wie Ortsangabe zu „wachsen tiefen abgründe“; es gehört auch zu beiden, eine eindeutige Zuordnung ist nicht möglich (und verstieße gegen die Anlage der Verse). „nicht zu nennen wie die gipfel dort“ wiederum ist attributiv zu „tiefen abgründe“, „wie die gipfel dort“ gehört aber durch das „oben“ auch als Vergleich zum Sich-Betten der Eitelkeit. Dieses Gleiten der Wortgruppen von einem Zusammenhang in einen anderen ist eine besonders auffällige, und seltene, Verfahrensweise, zu der die Nicht-Markierung syntaktischer Grenzen, d. h. der Verzicht auf Satzzeichen, ebenso stimmt wie das fast durchgehende Nicht-Zusammenfallen von Zeilenende und Ende der syntaktischen Einheit. Auch an den Enden der Strofen hören die Sätze nicht auf. Dadurch gewinnen diese Verse einen ganz eigenen Ton.
Gegen die Tradition verstößt Bauer auch dadurch, dass seine Gedichte nicht ‚einheitlich’ sind; in der Tradition der klassischen Moderne verbinden sie stets Heterogenes, wie etwa X, das einerseits Bezug auf Lorcas New York-Gedichte nimmt, andererseits auch von der „stadt am hudson“ so spricht, dass man nicht an den älteren Lyriker denken muss. Ob „dort /// besäuft sich das wasser an pathos“ Lorca meint oder die Szene in New York, bleibt offen; „als / wäre auch liebe eine möglichkeit“ am Schluss überschreitet auf jeden Fall den intertextellen Zusammenhang. Ähnlich geht Bauer in XIII mit Lorca-Motiven um: Aus den „zigeunern“ und „andalusiern“ macht der Autor von heute Menschen von heute „mit wort und gelächter“, obwohl gerade in diesem Gedicht auch der Abstand zwischen damals und heute, zwischen dort und hier deutlich markiert ist.
Selbstverständlich ist Lyrik nicht nur eine Sache der Form, obwohl diese für Christoph W. Bauer offensichtlich sehr wichtig ist. Eine einheitliche Thematik dieser Verse ist, Themen dieser Gedichte sind freilich schwer zu bestimmen. Eines ist der sich durch das ganze Bändchen ziehende Dialog mit dem großen Andalusier, einem Ahnherrn der Moderne, damit auch die Frage, was literarische Tradition (auch jenseits von Lorca) heute bedeutet (besonders IX), und insbesondere, wie lebendig Lorca heute noch ist. Ein anderes Thema ist die Landschaft, der Kontrast zwischen den Landschaften im Süden Spaniens und denen in den Alpen, denen Lorcas und denen Bauers, sind auch die durch Prospekte verbreiteten Klischees über die Landschaften Andalusiens: „kam die alhambra ins haus eh /// mutter sie zum altpapier brachte“ (III). Zumal dieser Vers zeigt, dass diesen Gedichten ein hintergründiger Humor nicht ganz fremd ist.
Die eigentliche Leistung Bauers in diesen Versen sehe ich aber trotz interessanten Themen und Motiven darin, dass er wie wenige Zeitgenossen nachdrücklich an die autonome Schönheit der Sprache erinnert. Das Spanische hilft ihm dabei ...
Sigurd Paul Scheichl

Michael Denzer: randnotizen.
Brixen: Verlag A. Weger, 2012.
Junger Minnesang im Slamklangkleid
Randgedanken zum Debüt von Michael Denzer
Wie gerne will ich auf // Flugzeugkondensstreifenzeilen schreiben,
auf denen Worte ungelesen bleiben, // wenn sie nicht jemand liest,
der sie im Herz einschließt.
Michael Denzer, Sprache (S.34)
 Über randnotizen, die Erstveröffentlichung, des jungen Südtiroler Dichters Michael Denzer zu schreiben ist, um in seinen Worten zu bleiben, wie „den Text eines wunderbaren Liedes vorzulesen, ohne ihn zu singen und dabei die Gitarrenakkorde, welche ihn begleiten nur aufzuzählen“ (S.7). Der Autor entführt durch seine Werke, ins „Zwischenzeilenland“ (S.19) und zeigt uns dabei den eignen „separated twin“ (Mirror, S.42); Lesend schlüpft man selbst in die Rolle der neunzehnjährigen dichtenden Person und sieht die Welt durch deren Wortweltbrille, durch welche das zusammengeknüllte Papier, Heimat, ein Stromausfall, erste Liebe sowie lebensphilosophische Gedanken dazu anregen, in die Welt der Dichter einzutauchen und den Wörtern unentwegt zu begegnen. Denzer schafft es, zeitresistent den eigenen Weg zu beschreiten dabei gleichzeitig ein Beispiel für typisch postmoderne Mannigfaltigkeit und Klanglichkeit zu sein. Zum einen sind die Vielfalt an Formen und der gewandte Umgang damit ganz im Stil der Zeit; so steht ein Langgedicht in Slamlänge gleichberechtigt neben einem epigrammartigen Kurzgedicht und einer alten traditionellen Form wie dem Sonett. Zusätzlich finden sich in seinen Gedichten „Augenblickwinkel“ voll Sprachwitz, denn „Whenever I plant a poe-tree//(…) My mind is like a metaphor“ („Metaphor“, S.21). Wie die großen LyrikerInnen der Zeit mischt auch er Mehrsprachigkeit gekonnt. So finden sich Werke in Deutsch, Englisch und Italienisch, teilweise sogar polyglott vereint in einem Gedicht „denn so ist es nunmal, // rien ne va plus!“ („Augenblickwinkel“, S.20). Ähnlich wie Nora Gomringer und andere ist er vom Poetry Slam geprägt. Die lesende Person wird von der Slam-Stimme in seiner Lyrik angesprochen. Demzufolge ist die Klanglichkeit durchgehend sehr präsent und der Reim ein essentielles Bindemittel. In seinem Reimreichtum trifft man, wie zu vermuten ist, auf die unterschiedlichsten Arten von Reimen, jedoch ist der traditionelle Endreim vorherrschend. Diese Aspekte von postmoderner Vielfalt treffen bei ihm zum Teil auf mittelalterliche Minneakte, die im Slamklang präsentiert werden. Auf eine naiv berührende Weise beweist Denzer, dass es durchaus möglich ist, im 21. Jahrhundert zart und optimistisch über bekannte drei Worte und Innenwelten zu schreiben, ohne von der gegenwärtig vorherrschenden Gefühlsscheu und Innigkeitsabwehr mitgerissen zu sein. Er schreibt in einer Sprache, die noch unbescholten Wahrheit zu transportieren scheint, ähnlich „Kindern die noch mit den Händen sehen“ (Seifenblasenwelten, S.65). Er wagt Reimstrukturen und Liebesthematiken einzubauen, er traut sich auf seinen 72 Seiten, was andere nicht wagen und gewinnt. „You cannot write poetry, without giving it a try“ (S.8), wie er selbst seinem Gedichtband vorausschickt. Seine Gedichte sprechen dabei direkt an, ohne wie Frank Schmitter meinte, überflüssig „Pfauenrad schlagende Verformung und Verkopfung“ und „poetische Sperrgebiete“ zu besiedeln. Besonders macht sich das im Gedicht „Zwischenzeilenland“ (S.19) bemerkbar. Auffallend ist, dass es, als ob es dem zitierten aristotelischen „Horror vacui“ entgegenhalten will, die Leere des Raumes zwischen den Zeilen ausformuliert. Dadurch gelingt es Denzer, zwei einzelne selbstständige Gedichte in einem Werk zu vereinen und somit genaugenommen drei Gedichte zu kreieren, die einzeln oder zusammen gelesen Sinn ergeben. Dieses Werk wird so zu einer Art Kunst des richtigen Lesewinkels. Zusätzlich macht es selbstreflexiv die Vieldeutigkeit und zwischen-den-Zeilen-Sprachen-Spiel von Lyrik zum Thema. Über randnotizen, die Erstveröffentlichung, des jungen Südtiroler Dichters Michael Denzer zu schreiben ist, um in seinen Worten zu bleiben, wie „den Text eines wunderbaren Liedes vorzulesen, ohne ihn zu singen und dabei die Gitarrenakkorde, welche ihn begleiten nur aufzuzählen“ (S.7). Der Autor entführt durch seine Werke, ins „Zwischenzeilenland“ (S.19) und zeigt uns dabei den eignen „separated twin“ (Mirror, S.42); Lesend schlüpft man selbst in die Rolle der neunzehnjährigen dichtenden Person und sieht die Welt durch deren Wortweltbrille, durch welche das zusammengeknüllte Papier, Heimat, ein Stromausfall, erste Liebe sowie lebensphilosophische Gedanken dazu anregen, in die Welt der Dichter einzutauchen und den Wörtern unentwegt zu begegnen. Denzer schafft es, zeitresistent den eigenen Weg zu beschreiten dabei gleichzeitig ein Beispiel für typisch postmoderne Mannigfaltigkeit und Klanglichkeit zu sein. Zum einen sind die Vielfalt an Formen und der gewandte Umgang damit ganz im Stil der Zeit; so steht ein Langgedicht in Slamlänge gleichberechtigt neben einem epigrammartigen Kurzgedicht und einer alten traditionellen Form wie dem Sonett. Zusätzlich finden sich in seinen Gedichten „Augenblickwinkel“ voll Sprachwitz, denn „Whenever I plant a poe-tree//(…) My mind is like a metaphor“ („Metaphor“, S.21). Wie die großen LyrikerInnen der Zeit mischt auch er Mehrsprachigkeit gekonnt. So finden sich Werke in Deutsch, Englisch und Italienisch, teilweise sogar polyglott vereint in einem Gedicht „denn so ist es nunmal, // rien ne va plus!“ („Augenblickwinkel“, S.20). Ähnlich wie Nora Gomringer und andere ist er vom Poetry Slam geprägt. Die lesende Person wird von der Slam-Stimme in seiner Lyrik angesprochen. Demzufolge ist die Klanglichkeit durchgehend sehr präsent und der Reim ein essentielles Bindemittel. In seinem Reimreichtum trifft man, wie zu vermuten ist, auf die unterschiedlichsten Arten von Reimen, jedoch ist der traditionelle Endreim vorherrschend. Diese Aspekte von postmoderner Vielfalt treffen bei ihm zum Teil auf mittelalterliche Minneakte, die im Slamklang präsentiert werden. Auf eine naiv berührende Weise beweist Denzer, dass es durchaus möglich ist, im 21. Jahrhundert zart und optimistisch über bekannte drei Worte und Innenwelten zu schreiben, ohne von der gegenwärtig vorherrschenden Gefühlsscheu und Innigkeitsabwehr mitgerissen zu sein. Er schreibt in einer Sprache, die noch unbescholten Wahrheit zu transportieren scheint, ähnlich „Kindern die noch mit den Händen sehen“ (Seifenblasenwelten, S.65). Er wagt Reimstrukturen und Liebesthematiken einzubauen, er traut sich auf seinen 72 Seiten, was andere nicht wagen und gewinnt. „You cannot write poetry, without giving it a try“ (S.8), wie er selbst seinem Gedichtband vorausschickt. Seine Gedichte sprechen dabei direkt an, ohne wie Frank Schmitter meinte, überflüssig „Pfauenrad schlagende Verformung und Verkopfung“ und „poetische Sperrgebiete“ zu besiedeln. Besonders macht sich das im Gedicht „Zwischenzeilenland“ (S.19) bemerkbar. Auffallend ist, dass es, als ob es dem zitierten aristotelischen „Horror vacui“ entgegenhalten will, die Leere des Raumes zwischen den Zeilen ausformuliert. Dadurch gelingt es Denzer, zwei einzelne selbstständige Gedichte in einem Werk zu vereinen und somit genaugenommen drei Gedichte zu kreieren, die einzeln oder zusammen gelesen Sinn ergeben. Dieses Werk wird so zu einer Art Kunst des richtigen Lesewinkels. Zusätzlich macht es selbstreflexiv die Vieldeutigkeit und zwischen-den-Zeilen-Sprachen-Spiel von Lyrik zum Thema.
„Die Buchstaben sind gefallen
Unauslöschlich
Wie Asche auf Schnee.
Das weiße Blatt war unbefleckt
Wie wenig Worte man doch braucht.
Um viel zu sagen zu haben (…)“ (S.19)
Dieses Debütwerk von Michael Denzer, dessen Veröffentlichung durch den Verlag A. Wegner in Brixen erfolgte, beweist, dass sehr wohl junge Talente, gedruckt werden. In diesem Fall ist der Autor sogar sehr jung, er war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gerade mal neunzehn (also wiederum eine Gemeinsamkeit mit Gomringer). Dies erfolgte entgegen aller pessimistischen Lyrikprognosen. Zum Beispiel meinte zur gleichen Zeit wie Denzers Erstveröffentlichung der Altmeister Günter Kunert zu Lyrikveröffentlichungen im allgemeinen: „Gegenwärtig sollten Verlage, jedenfalls die meisten, über ihren Eingangspforten jene Formel anbringen, die Dante über das Tor zum Inferno setzte: ‚Wer hier eintritt, lasse alle Hoffnung fahren‘“ und Ferdinand Scholz bestärkt es mit dem Ausspruch „Jeder schreibt keiner liest Gedichte“. Dem entgegnet Denzer lakonisch prägnant in dem Gedicht „Von Schönheit und Sinn“ (S.17) mit folgenden Worten: „Von Lyrik lässt es sich nicht leben, // doch mit der Lyrik lebt’s sich gut“. Die Tatsache, dass er mit nicht einmal zwanzig Jahren schon so tief in die Wortwelten, „in Seifenblasenwelten (…), in der wir leisen Dichter leben“ („Seifenblasenwelten“, S.65) einzutauchen vermochte, lässt erwartungsvoll darauf gespannt sein, wie seine Wortwerke weiter reifen. Dabei ist besonders interessant, ob und inwiefern sein Literaturstudium, seine eigene weitere Sprachfindung, auch in Anbetracht seiner Reimbehandlung, beeinflussen wird. Dies werden wir in seiner nächsten Publikation erfahren. Auf jeden Fall sollte man sich zu seinem Namen mehr als nur „randnotizen“ machen. Es bleibt zu hoffen, dass die Personen hinter der "Enzensberger'schen Konstante", die durchschnittlich möglichen 1354 Leser, seine Verse ins Herz einschließen mögen.
Siljarosa Schletterer

Lois Hechenblaikner: Hinter den Bergen.
Göttingen: Steidl Verlag, 2015.
Hinter den Bergen
 Der Fotograf Lois Hechenblaikner sagt in einem Interview der Zeit: “Henri Cartier-Bresson hat gesagt: ‘Fotografie ist eine Art zu schreien.’ Die Veränderungsprozesse in meiner Heimat haben mich sehr belastet, sie haben auf meine Gesundheit geschlagen. Mit der Fotografie habe ich ein Mittel gefunden, mich zu wehren. Dank meiner Bilder kann niemand mehr sagen, dass es nicht so war. Wenn die lokalen Medien gleichgeschaltet sind, alle in dieser Schicksalsgemeinschaft namens Tourismus mittun, braucht es einen wie mich, der den Preis, den wir bezahlen, sichtbar macht. Aber es geht mir nicht darum, meine Heimat in den Dreck zu ziehen. Ich bin kein Nestbeschmutzer und kein Verhörnter. Ich liebe meine Heimat. Dies zeige ich in meiner Arbeit. Nur verstehen das noch nicht alle. Man hat mich verleumdet, bedroht, Ausstellungen von mir verboten.” Hechenblaikner poltert gern und schaut grimmig. “Die Hütte, das ist das größte Kulturhurengut der Alpen”, sagt er dem Spiegel. Fotografen stellen im Dienst der Tourismusindustrie nach wie vor Idyllen nach. “Fotografische Zuhälterei”. Armin Kniely, Erika Hubatschek, Hubert Leischner, Udo Bernhard, Sepp Hofer, Leo Bährendt, deren diesbezüglich unschuldig klassischen Schwarz-Weiß-Fotografien - Mitte der 1930er bis Ende der 1960er Jahre als Dokumente einer ausgewogen ruralen Kulturlandschaft entstanden - stellt Hechenblaikner eigenen Arbeiten aus den Jahren 2001 bis 2008 gegenüber. Seine eigenen Motive irritieren, weil sie Bildelemente des historischen Fotomaterials aufnehmen, ihre Perversion im Zug des touristischen Akkumulierungswahns auf den zweiten Blick vor Augen führen: müllversaute Festwiesen nach einem Schürzenjäger-Openair in Finkenberg, Fanbus-Schwadronen, die zum Kastelruther Spatzentreff anrücken, Schneekanonen, Pistenraupen, Saufspiele allüberall. Ähnliches hatte 1996 auch schon der Südtiroler Gianni Bodini mit seinen Fotografien für eine Ausgabe der Südtiroler Kulturzeitschrift Arunda unternommen (Die Alpen. Nach Gebrauch wegwerfen) oder Walter Niedermayr 2012 mit seiner Schneekanonen-Porträtserie für Quart Nummer 23. Vom Land Tirol wurde die Neuausgabe des 2009 in der Edition Braus erschienen Fotobuchs Hechenblaikners finanziell gefördert. Jetzt ist es neu im renommierten Steidl Verlag herausgekommen. Und das ist gut so. Denn Hechenblaikners Fotografien sind auf paradoxe Art schön. Der Fotograf Lois Hechenblaikner sagt in einem Interview der Zeit: “Henri Cartier-Bresson hat gesagt: ‘Fotografie ist eine Art zu schreien.’ Die Veränderungsprozesse in meiner Heimat haben mich sehr belastet, sie haben auf meine Gesundheit geschlagen. Mit der Fotografie habe ich ein Mittel gefunden, mich zu wehren. Dank meiner Bilder kann niemand mehr sagen, dass es nicht so war. Wenn die lokalen Medien gleichgeschaltet sind, alle in dieser Schicksalsgemeinschaft namens Tourismus mittun, braucht es einen wie mich, der den Preis, den wir bezahlen, sichtbar macht. Aber es geht mir nicht darum, meine Heimat in den Dreck zu ziehen. Ich bin kein Nestbeschmutzer und kein Verhörnter. Ich liebe meine Heimat. Dies zeige ich in meiner Arbeit. Nur verstehen das noch nicht alle. Man hat mich verleumdet, bedroht, Ausstellungen von mir verboten.” Hechenblaikner poltert gern und schaut grimmig. “Die Hütte, das ist das größte Kulturhurengut der Alpen”, sagt er dem Spiegel. Fotografen stellen im Dienst der Tourismusindustrie nach wie vor Idyllen nach. “Fotografische Zuhälterei”. Armin Kniely, Erika Hubatschek, Hubert Leischner, Udo Bernhard, Sepp Hofer, Leo Bährendt, deren diesbezüglich unschuldig klassischen Schwarz-Weiß-Fotografien - Mitte der 1930er bis Ende der 1960er Jahre als Dokumente einer ausgewogen ruralen Kulturlandschaft entstanden - stellt Hechenblaikner eigenen Arbeiten aus den Jahren 2001 bis 2008 gegenüber. Seine eigenen Motive irritieren, weil sie Bildelemente des historischen Fotomaterials aufnehmen, ihre Perversion im Zug des touristischen Akkumulierungswahns auf den zweiten Blick vor Augen führen: müllversaute Festwiesen nach einem Schürzenjäger-Openair in Finkenberg, Fanbus-Schwadronen, die zum Kastelruther Spatzentreff anrücken, Schneekanonen, Pistenraupen, Saufspiele allüberall. Ähnliches hatte 1996 auch schon der Südtiroler Gianni Bodini mit seinen Fotografien für eine Ausgabe der Südtiroler Kulturzeitschrift Arunda unternommen (Die Alpen. Nach Gebrauch wegwerfen) oder Walter Niedermayr 2012 mit seiner Schneekanonen-Porträtserie für Quart Nummer 23. Vom Land Tirol wurde die Neuausgabe des 2009 in der Edition Braus erschienen Fotobuchs Hechenblaikners finanziell gefördert. Jetzt ist es neu im renommierten Steidl Verlag herausgekommen. Und das ist gut so. Denn Hechenblaikners Fotografien sind auf paradoxe Art schön.
Bernhard Sandbichler

Markus Köhle, Ursula Timea-Rossel, Klex Wolf, Hannes Sprenger: Fransen Text. Die Siebentagewoche, ein literarisch-musikalisches Instantprojekt.
Molln: ATS Records, 2015.
Improvisiert gefranste Hörspielminiaturen
 Die noch ‚aufnahmefrische‘ CD von Fransen besticht in ihrer Charakterisierung der Wochentage durch ihre erfrischende Klangkombination in Wort als auch Musik. Hinter der improvisierten Musik von Fransen stehen als Personen Hannes Sprenger am Saxophon und Live-electronics, sowie Klex Wolf an den Keys und Live-electronics. Um sich zu „zerfransen“ bevorzugen sie die „unscharfen Ränder der Musik, die sich meist da zeigen, wo die Spiellaune ungesittet an allzu strengen Regeln rüttelt.“Die Menschen hinter den Wortklangwelten sind: Ursula Timea Rossel & Markus Köhle, die in personam AutorenInnen und vortragende Personen der Werke in einem sind. Produziert wurde dieses „Instantprodukt“ neben Fransen Musik auch von 8ung kultur, einem Verein zur kulturellen-literarischen Belebung des Landes. Auf vierzehn Tracks werden die Wochentage zweimal, jeweils einmal von Köhle und Rossel, in Worte gesetzt, mit Phrasen umgarnt und umschrieben. Die Spannweite der Länge ist alles andere als ‚Hitradio genormt‘, sondern reicht von über acht Minuten Einspielzeit („Samstagsgeschichte: Was ich suche aus der Dose“, Track 11) bis zu Kürzesteinspielung von vier Sekunden („Dienstag“, Track 3). In letzterer wird symptomatisch auch einzig die Aussage getroffen, dass Dienstage immer zu kurz kämen. Die Beziehung zwischen Musik und Text hat einen starken Kommunikationscharakter. Musikalischer Klang kommentiert, unterstreicht und kontrapunktiert verbal Gesagtes, zum Teil wird auch damit kokettiert. Sprachlicher Rhythmus wird instrumental aufgenommen und unterstrichen, verschmilzt so noch mehr ineinander. Fransen gelingt es, dem Text ein Mehr an Zuhör-Raum zu schenken. Sie verführen dazu, immer stärker an den Lippen bzw. eigentlich an den Lautsprechern hängen zu wollen, kommt doch die Musik in solch einem ‚catchy‘ Gewand daher. Besonders einfühlend und elegisch wirken die Keyboard- und Saxklänge in Track 10. („Freitag: Robinson“). Durch sie wird man mit Robinson auf die Insel verbannt und lauscht gebannt dem innermusikalischen Wellengang. Musik wird zum Teil auch in den Texten thematisiert. „Wäre ich ein Lied, ich hätte schrille Töne“, so Markus Köhle in „Samstag“(Track 12) und Ursula Timea Rossel meint in „Montags: Paranoia“ (Track 2):„Individuellpersönlich bin ich ein wenig bestürzt (…). Dann lege ich eben falsche Tonfährten, erzeuge Geräusche“. Passend zum Titel „Sonntags: Fertiggotteshaus“ (Track 13) erklingen ‚fertige‘ Orgelklänge‚ um den großen Gott in die Kirche zu bekommen‘. Doch belehrt einem die CD am Ende, „der Sonntag ist jetzt anders, ein Tag wie jeder andere“ (Sonntag, Track 14). In welcher Tradition diese literarisch-musikalische Wochensezierung zu verorten ist, fällt schwer. In einem Gespräch mit dem Musiker Wolf meinte er wahrscheinlich am treffendsten über die Musik: „wenn wir improvisiern, wahts ins halt irgendwohin…“. Erstaunlicherweise hätten sie beide oftmals „Rock im Kopf“, obwohl ihr Sound nicht auf den ersten Blick daran erinnern mag, ist ein gemeinsam sehr geschätzter Musiker Frank Zappa. Auf der CD ist oft ein selbstironisches Augenzwinkern zu finden, das „nicht alles bierernst“ nimmt oder wie Ursula Timea Rossel in „Montags: Paranoia“ meint: „na gut, jetzt kommts nicht mehr drauf an, ich steh öffentlich dazu, es ist: BIER-SHAMPOO!“ Diese vielschichte Selbstironie in den Texten als auch in den musikalischen Improvisationen lässt zuweilen an Pirchner denken, vor allem an sein 1973 erschienenes ein halbes doppelalbum. Sprenger hat sich schon intensiver mit Pirchner beschäftigt (u.a. CD-Einspielung mit AkkoSax). Der Zwischenbereich von Kabarett, Sprachspiel und Musik ist auch Heimo Wisser sehr nahe. Gerade die Art und Weise wie mit Texten umgegangen wird, erinnert an seine Arbeit. Der musikalische-literarische Duktus erinnert stark an die Form des Hörspiels, ebenso die Textbehandlung lässt diese Parallelen zu. Das Zusammenwirken von Wort und Musik, auch der musikalische Aufgabenbereich sind ident. Der Hörspielcharakter ist beizeiten so stark, dass man die Produktion auch „vierzehn Kurzhörspiele“ betiteln könnte. Einer der schreibenden Personen, Markus Köhle, hat schon Erfahrung mit diesem Medium: in Kommunikationsklimbim, ein Hörspiel, das 2008 ausgestrahlt wurde. Die Vorgehensweise oder der Produktionsplan, um sich den Worten des CD-Cover anzugleichen, scheint ein sehr kreativer gewesen zu sein. Die Werke entstanden in mehreren Impro-Sessions zu den fertigen Texten. Dieses Zusammenwirken wurde anschließend aufgenommen und dann zum Teil geschnitten. Ähnlich dem Hörspiel kann man bei dieser Produktion auch von einer Art Montage sprechen. Zu Beginn entstand die Idee die erste „passierte“ CD von Fransen Mittwochs mit Literatur zu vereinen und auf alle Wochentage auszuweiten. Der Schreibstil der AutorenInnen ist unterschiedlich. Rossels Kryptogeografie, ein netzaktives Lebensprojekt, welches in ihrem Roman Man nehme Silber und Knoblauch, Erde und Salz als bisheriges Kompendium gipfelte, ist in der Selbstbeschreibung eine markante, wenn auch wenig bekannte und noch weniger exakte Wissenschaft, die sich mit verborgenen und geheimen Dingen auf und in der Erde und um die Erde herum beschäftigt. In der Form sei sie opulent, arabesk, barock, ornamental, oriental, knorrig und verzworgelt. Ein kryptogeographisches Motto lautet: „Bahnhof ist die einzige Sprache, die ich verstehe“. Diese Beschäftigung schwingt auch in den CD-Texten sehr stark mit. Damit fordert sie intensives Lesen und Hören ein. Sie schafft so eine besondere Art von Intensität auf den zweiten Blick. Ihre Sprache ist grenzwertiger für dieses Hörspielkonzept wegen ihrer kryptischen Komplexität. Markus Köhle hingegen ist als treibender Motor in der österreichischen Slampoetrylandschaft nicht wegzudenken. Er bezeichnet sich selbst als Sprachinstallateur, Poetry Slammer und Literaturzeitschriftenaktivist, der schreibt, um gehört zu werden. Gerade in diesem letzten Satz wird seine Klangaffinität und akustische Meisterschaft deutlich. Köhle besitzt slamtypisch ein unglaubliches Rhythmus- und Timingfeingefühl. In der Beschreibung von Klex Wolf waren die Aufnahmesessions „so als ob drei Musiker, zu dritt den Text improvisiert“ hätten. Sie erschaffen so Literatur fürs Ohr. Köhles Wortspielereien regen zum Schmunzeln an und verblüffen zugleich in ihrer Assoziationenleichtigkeit, wie dieses Zitat aus Samstag (Track 12) zeigt: „Ohne Tag bin ich nur ein Sams, ein Kinderbuchheld mit Froschfüßen“. Durch die kontrastierende Gegenüberstellung kommen die zwei verschiedenen Charaktere der Autoren womöglich mehr zum Vorschein. Zugleich werden die Verschiedenheiten und Dualitäten auf mehreren Ebenen vereint. Zwei verschiedene Sprecher, aus zwei verschiedenen dialektalen Ufern und Schreibarten einen sich mit zwei verschiedenen oder doch gleichen Kunstsparten: Musik und Text. Doch auf der Aufnahme vereint sich alles im Ohr, alle scheinbaren Gegensätze verschmelzen gleichberechtigt im Klang. Insofern könnte es auch als eine moderne geslammte Fortsetzung der Vorlesetradition gesehen werden. Nachdem einem als zuhörende Person ein „Licht aufgeht“ wie im Track 5 („Mittwochs Post“) bezüglich der Reize dieser Produktion, wird die Vorfreude immer stärker auf hoffentlich baldige weiterer musikalisch-literarische Instantbearbeitungen der Monate und Jahreszeiten… Die noch ‚aufnahmefrische‘ CD von Fransen besticht in ihrer Charakterisierung der Wochentage durch ihre erfrischende Klangkombination in Wort als auch Musik. Hinter der improvisierten Musik von Fransen stehen als Personen Hannes Sprenger am Saxophon und Live-electronics, sowie Klex Wolf an den Keys und Live-electronics. Um sich zu „zerfransen“ bevorzugen sie die „unscharfen Ränder der Musik, die sich meist da zeigen, wo die Spiellaune ungesittet an allzu strengen Regeln rüttelt.“Die Menschen hinter den Wortklangwelten sind: Ursula Timea Rossel & Markus Köhle, die in personam AutorenInnen und vortragende Personen der Werke in einem sind. Produziert wurde dieses „Instantprodukt“ neben Fransen Musik auch von 8ung kultur, einem Verein zur kulturellen-literarischen Belebung des Landes. Auf vierzehn Tracks werden die Wochentage zweimal, jeweils einmal von Köhle und Rossel, in Worte gesetzt, mit Phrasen umgarnt und umschrieben. Die Spannweite der Länge ist alles andere als ‚Hitradio genormt‘, sondern reicht von über acht Minuten Einspielzeit („Samstagsgeschichte: Was ich suche aus der Dose“, Track 11) bis zu Kürzesteinspielung von vier Sekunden („Dienstag“, Track 3). In letzterer wird symptomatisch auch einzig die Aussage getroffen, dass Dienstage immer zu kurz kämen. Die Beziehung zwischen Musik und Text hat einen starken Kommunikationscharakter. Musikalischer Klang kommentiert, unterstreicht und kontrapunktiert verbal Gesagtes, zum Teil wird auch damit kokettiert. Sprachlicher Rhythmus wird instrumental aufgenommen und unterstrichen, verschmilzt so noch mehr ineinander. Fransen gelingt es, dem Text ein Mehr an Zuhör-Raum zu schenken. Sie verführen dazu, immer stärker an den Lippen bzw. eigentlich an den Lautsprechern hängen zu wollen, kommt doch die Musik in solch einem ‚catchy‘ Gewand daher. Besonders einfühlend und elegisch wirken die Keyboard- und Saxklänge in Track 10. („Freitag: Robinson“). Durch sie wird man mit Robinson auf die Insel verbannt und lauscht gebannt dem innermusikalischen Wellengang. Musik wird zum Teil auch in den Texten thematisiert. „Wäre ich ein Lied, ich hätte schrille Töne“, so Markus Köhle in „Samstag“(Track 12) und Ursula Timea Rossel meint in „Montags: Paranoia“ (Track 2):„Individuellpersönlich bin ich ein wenig bestürzt (…). Dann lege ich eben falsche Tonfährten, erzeuge Geräusche“. Passend zum Titel „Sonntags: Fertiggotteshaus“ (Track 13) erklingen ‚fertige‘ Orgelklänge‚ um den großen Gott in die Kirche zu bekommen‘. Doch belehrt einem die CD am Ende, „der Sonntag ist jetzt anders, ein Tag wie jeder andere“ (Sonntag, Track 14). In welcher Tradition diese literarisch-musikalische Wochensezierung zu verorten ist, fällt schwer. In einem Gespräch mit dem Musiker Wolf meinte er wahrscheinlich am treffendsten über die Musik: „wenn wir improvisiern, wahts ins halt irgendwohin…“. Erstaunlicherweise hätten sie beide oftmals „Rock im Kopf“, obwohl ihr Sound nicht auf den ersten Blick daran erinnern mag, ist ein gemeinsam sehr geschätzter Musiker Frank Zappa. Auf der CD ist oft ein selbstironisches Augenzwinkern zu finden, das „nicht alles bierernst“ nimmt oder wie Ursula Timea Rossel in „Montags: Paranoia“ meint: „na gut, jetzt kommts nicht mehr drauf an, ich steh öffentlich dazu, es ist: BIER-SHAMPOO!“ Diese vielschichte Selbstironie in den Texten als auch in den musikalischen Improvisationen lässt zuweilen an Pirchner denken, vor allem an sein 1973 erschienenes ein halbes doppelalbum. Sprenger hat sich schon intensiver mit Pirchner beschäftigt (u.a. CD-Einspielung mit AkkoSax). Der Zwischenbereich von Kabarett, Sprachspiel und Musik ist auch Heimo Wisser sehr nahe. Gerade die Art und Weise wie mit Texten umgegangen wird, erinnert an seine Arbeit. Der musikalische-literarische Duktus erinnert stark an die Form des Hörspiels, ebenso die Textbehandlung lässt diese Parallelen zu. Das Zusammenwirken von Wort und Musik, auch der musikalische Aufgabenbereich sind ident. Der Hörspielcharakter ist beizeiten so stark, dass man die Produktion auch „vierzehn Kurzhörspiele“ betiteln könnte. Einer der schreibenden Personen, Markus Köhle, hat schon Erfahrung mit diesem Medium: in Kommunikationsklimbim, ein Hörspiel, das 2008 ausgestrahlt wurde. Die Vorgehensweise oder der Produktionsplan, um sich den Worten des CD-Cover anzugleichen, scheint ein sehr kreativer gewesen zu sein. Die Werke entstanden in mehreren Impro-Sessions zu den fertigen Texten. Dieses Zusammenwirken wurde anschließend aufgenommen und dann zum Teil geschnitten. Ähnlich dem Hörspiel kann man bei dieser Produktion auch von einer Art Montage sprechen. Zu Beginn entstand die Idee die erste „passierte“ CD von Fransen Mittwochs mit Literatur zu vereinen und auf alle Wochentage auszuweiten. Der Schreibstil der AutorenInnen ist unterschiedlich. Rossels Kryptogeografie, ein netzaktives Lebensprojekt, welches in ihrem Roman Man nehme Silber und Knoblauch, Erde und Salz als bisheriges Kompendium gipfelte, ist in der Selbstbeschreibung eine markante, wenn auch wenig bekannte und noch weniger exakte Wissenschaft, die sich mit verborgenen und geheimen Dingen auf und in der Erde und um die Erde herum beschäftigt. In der Form sei sie opulent, arabesk, barock, ornamental, oriental, knorrig und verzworgelt. Ein kryptogeographisches Motto lautet: „Bahnhof ist die einzige Sprache, die ich verstehe“. Diese Beschäftigung schwingt auch in den CD-Texten sehr stark mit. Damit fordert sie intensives Lesen und Hören ein. Sie schafft so eine besondere Art von Intensität auf den zweiten Blick. Ihre Sprache ist grenzwertiger für dieses Hörspielkonzept wegen ihrer kryptischen Komplexität. Markus Köhle hingegen ist als treibender Motor in der österreichischen Slampoetrylandschaft nicht wegzudenken. Er bezeichnet sich selbst als Sprachinstallateur, Poetry Slammer und Literaturzeitschriftenaktivist, der schreibt, um gehört zu werden. Gerade in diesem letzten Satz wird seine Klangaffinität und akustische Meisterschaft deutlich. Köhle besitzt slamtypisch ein unglaubliches Rhythmus- und Timingfeingefühl. In der Beschreibung von Klex Wolf waren die Aufnahmesessions „so als ob drei Musiker, zu dritt den Text improvisiert“ hätten. Sie erschaffen so Literatur fürs Ohr. Köhles Wortspielereien regen zum Schmunzeln an und verblüffen zugleich in ihrer Assoziationenleichtigkeit, wie dieses Zitat aus Samstag (Track 12) zeigt: „Ohne Tag bin ich nur ein Sams, ein Kinderbuchheld mit Froschfüßen“. Durch die kontrastierende Gegenüberstellung kommen die zwei verschiedenen Charaktere der Autoren womöglich mehr zum Vorschein. Zugleich werden die Verschiedenheiten und Dualitäten auf mehreren Ebenen vereint. Zwei verschiedene Sprecher, aus zwei verschiedenen dialektalen Ufern und Schreibarten einen sich mit zwei verschiedenen oder doch gleichen Kunstsparten: Musik und Text. Doch auf der Aufnahme vereint sich alles im Ohr, alle scheinbaren Gegensätze verschmelzen gleichberechtigt im Klang. Insofern könnte es auch als eine moderne geslammte Fortsetzung der Vorlesetradition gesehen werden. Nachdem einem als zuhörende Person ein „Licht aufgeht“ wie im Track 5 („Mittwochs Post“) bezüglich der Reize dieser Produktion, wird die Vorfreude immer stärker auf hoffentlich baldige weiterer musikalisch-literarische Instantbearbeitungen der Monate und Jahreszeiten…
Siljarosa Schletterer
Links:
Fransen Text gibt’s jetzt übrigens auch als Film:

Bernhard Liphart, Getanztes Licht.
Wattens: Berenkamp (Erlesen, Bd 26), 2014.
Vergängliche Flügelschläge im nachdenklichen Licht
 Mit seinem neuen Werk Getanztes Licht veröffentlicht Liphart seinen dritter Lyrikband (nach Der andere Weg tastet die Sterne 2009 und Den Sternen ist kein Weg zu weit 2011) und fünfte Veröffentlichung beim Tiroler Verlag Berenkamp. Der Verlag wurde 1991 in Schwaz gegründet und bezeichnet sich selbst als den kleinen Verlag mit dem großen Programm. Der Autor wurde 1932 geboren und ist von Beruf Rechtsanwalt. Seine Passion des Schreibens stellt er selbst mit folgenden Worten dar: ‚,Die Gedichte sind nicht mit Hingabe erfunden. Ganz plötzlich und unerwartet höre ich sie für einen Augenblick, hastig sie niederzuschreiben in einem Gruß.“ Im Gedichtband fallen zwei große Themenkreise auf. Wie der Buchtitel vermuten lässt, ist ein zentrales Motive der Gedichte das Licht. „Licht/ ist wie das Lob/ der Träume,/ ist wie aus Lust/ ein Lied, / ist wie ein Lächeln/ alter Freunde,/ das Jungsein gibt –“ (S.39) Auch das letzte Gedicht des Bandes thematisiert dies mit der Zeile „Dunkelheit ist wartendes Licht“ (S. 123). Diese Worte können gleichzeitig als Beschreibung des einprägsamen Layouts angesehen werden. Der Schriftzug, welcher leuchtendes Licht in dunkler Umgebung nachahmt, sticht sofort ins Auge. Auf Seite 13 befindet sich eine seiner treffenden Aussagen. „Wo Kinder/ lachen/ wird Licht/ in die Welt/ gestellt –“. Damit verbindet er die zwei großen Themenkreise des Bandes, denn in seinem zweiten zentralen Motiv behandelt er die Kindheitsthematik. Zuweilen thematisiert Liphart auch die Erziehung auf berührende und weise Art: „Ich habe dir/ die Flügel/ nicht gebunden,/du solltest/ hohe Tiefen spüren/ ganz allein, / denn nur/ mit Flügeln/ und mit Wunden/ gelingt es, /Mensch zu sein –“ (S.77)Meist wird in diesem Band die Erinnerung an das eigene Kindsein mit dem Gefühl der Vergänglichkeit konfrontiert. Kindheit wird als ein Sehnsucht erweckender Topos in einer heilen Welt dargestellt. „Kinder/ haben immer/ ihren Tag,/ sie spüren nicht/ den fremden Fluss/ der Zeit,/ alles ist für sie/ Traum und/ Wirklichkeit –“ (S.38) Das lyrische Ich blickt auf die kindliche Unbeschwertheit mit sentimentalen liebevollen Augen, die einem Großvater zugesprochen werden können. Mit diesem Blick thematisiert er wiederum die eigene Vergänglichkeit. „Der Bach denkt nicht/ an seine Quellen,/ wo er im Alter/ stirbt- /das Leben tanzt/ auf seinen Wellen,/ und nichts/ ihm seine Lust/ verdirbt-“(S.98). Lipharts Thematisierung der Vergänglichkeit nimmt stellenweise barocke Züge an und spielt mit einer Art Vanitas Motiv: „Wie sehr man doch/ die Welt/ verändert spürt, / so vieles/ hat der Mensch/ verführt, / und was er/ noch nicht/ angerührt, / hat Angst/ vor seinen Griffen –“ (S.42).Hier erinnert auch der Duktus und Gesamtstil an barocke Dichtkunst. Bernhard Liphart hat trotzdem seinen eigenen Schreibstil, vielleicht sogar eine Art Stempel gefunden: Er verzichtet durchgehend auf Punkte, stattdessen endet jedes Gedicht mit einem langen Gedankenstrich. Damit schafft er ein eigenes Markenzeichen in der Schriftsetzung. Dies hat er mit bekannten Tiroler Lyriknamen gemein: Christoph W. Bauer beispielsweise kreiert eigene formale Muster für seine Lyrik, und C.H. Huber setzt ihre Titel immer an den Schluss. Ein weiteres Kennzeichen seines Stils fällt sofort ins Auge und zwar seine konsequente Kürze. Das längste Gedicht erstreckt sich über fünfzehn Zeilen (S.31), wobei hier maximal zwei Wörter in einer Zeile zu finden sind. Auch dies scheint bei ihm typisch zu sein. Nur zwei Mal finden sich 5 Wörter als Zeilen-Höchstzahl: „schaut dir frech ins Gesicht -“ (S.71) und „Es hat ein anderes Licht“ (S. 24) im Gedicht mit dem Titel „Herbst“. Interessanterweise handelt hier auch die Zeilen-Aussage von frecher Abweichung und Andersartigkeit, gar so als wolle er seine Abweichung vom eigenen Stil im doppelten Sinne unterstreichen. Seine Textkürze lässt an Haikus denken, was ins Deutsche übertragen soviel wie „scherzhafter Vers“ bedeutet und zu seinen augenzwinkernden Zwischenzeilen passt. Diese lassen zuweilen Erinnerungen an Wilhelm Buschs treffsichere Verse, welche immer eine gewichtige Weisheit transportierten, aufkommen. Wie das folgende aphorismenhafte Gedicht erkennen lässt: „Des Menschen Tage/ sind gezählt,/ doch jeder hofft/ auf Rechenfehler –“ (S.33) Dennoch wirkt seine Wortwahl ab und an artifiziell und unausgereift ähnlich den Poesiealbumsprüchen: etwas gezwungen auch in der Reimwahl. Bei Liphart ist neben dem Verzicht von Textlänge auch eine Art Titelvermeidung festzustellen: von den 118 Gedichten in diesem Band tragen davon nicht mehr als 18 einen expliziten Titel. Einige der Titel lassen die Vermutung zu, dass sie Überschriften für mögliche Zyklen sind, welche die darauffolgenden Gedichte zusammenfassen könnten. Abschied (S.28) und Allerseelen (S.32) samt den drei anschließenden Gedichten könnten hier als Beispiel dienen. In diesem Lyrikband sind interessante Wortkombinationen und poetische Neologismen zu finden, wie ‚angeliebt‘ (S.79) oder im Gedicht mit dem Titel Religion: „Hochgehofft, / niedergeglaubt, (…)“ (S.50). Auch die Phrase „(…) in einem Fragezeichen/ eingesteint –“ (S.34) beinhaltet eine Wortneuschöpfung, welche mit den Begriffen ‚in Stein gemeiselt‘ ‚eingebaut‘, und ‚eingemeiselt‘ spielt. Durch seine kurze, prägnante und dennoch berührende Sprache kann er in der Tradition der Liebes- und Lebensgedichte von Erich Fried gesehen werden. Gerade Folgendes ist sehr ähnlich: „Liebe/ ist kein/ ,,Dann und Wann‘‘/ ein wenig heute -/ ein wenig morgen -/ ein wenig irgendwann –“ (S.88). Auch das Gedicht auf Seite 55: „Nicht die Frage - /nicht die Antwort - / nur Du –“erweckt die Erinnerung an Frieds „Dich“. Liphart schafft es dabei, ähnlich Fried, in seinen lyrischen Aussagen die lesende Person beim Zeilenverweilen zum Nachdenken zu bringen. „Manches/ ist Klarheit -/ Wahrheit/ deshalb/ noch nicht –“ (S.44). Häufig sind seine kurzen epigrammartigen Analogien im Schema x ist y zu finden. „Blühen/ist/Göttlich-Sein/ohne/Mühen –“ (S.14). Dies bindet ein wenig die Flügel der lesenden Person, welche sooft von Liphart thematisiert werden, wie zum Beispiel auf Seite 95: „Die Fäuste/ der Nacht/ vermögen nichts/ gegen die Flügel/ der Träume -“. Mit seiner bildhaften Sprache kreiert der Autor ganze Bilder im inneren Auge der lesenden Person und entspinnt ganze Szenen wie in der folgenden Zeile: „In den Flügeln/ der Dämmerung/ wärmt sich/ die Sehnsucht –“ (S.18). Als LeserIn legt man sich selbst in diese lyrischen Flügel. Fast mit Wehmut sehnt man sich nach einem längeren Gedicht, aber wahrscheinlich macht gerade dies den Reiz dieser kurzen Entführung aus: das Mehr an Schweigen, das zum eigenen Träumen und Nachdenken anregt. Mit seinem neuen Werk Getanztes Licht veröffentlicht Liphart seinen dritter Lyrikband (nach Der andere Weg tastet die Sterne 2009 und Den Sternen ist kein Weg zu weit 2011) und fünfte Veröffentlichung beim Tiroler Verlag Berenkamp. Der Verlag wurde 1991 in Schwaz gegründet und bezeichnet sich selbst als den kleinen Verlag mit dem großen Programm. Der Autor wurde 1932 geboren und ist von Beruf Rechtsanwalt. Seine Passion des Schreibens stellt er selbst mit folgenden Worten dar: ‚,Die Gedichte sind nicht mit Hingabe erfunden. Ganz plötzlich und unerwartet höre ich sie für einen Augenblick, hastig sie niederzuschreiben in einem Gruß.“ Im Gedichtband fallen zwei große Themenkreise auf. Wie der Buchtitel vermuten lässt, ist ein zentrales Motive der Gedichte das Licht. „Licht/ ist wie das Lob/ der Träume,/ ist wie aus Lust/ ein Lied, / ist wie ein Lächeln/ alter Freunde,/ das Jungsein gibt –“ (S.39) Auch das letzte Gedicht des Bandes thematisiert dies mit der Zeile „Dunkelheit ist wartendes Licht“ (S. 123). Diese Worte können gleichzeitig als Beschreibung des einprägsamen Layouts angesehen werden. Der Schriftzug, welcher leuchtendes Licht in dunkler Umgebung nachahmt, sticht sofort ins Auge. Auf Seite 13 befindet sich eine seiner treffenden Aussagen. „Wo Kinder/ lachen/ wird Licht/ in die Welt/ gestellt –“. Damit verbindet er die zwei großen Themenkreise des Bandes, denn in seinem zweiten zentralen Motiv behandelt er die Kindheitsthematik. Zuweilen thematisiert Liphart auch die Erziehung auf berührende und weise Art: „Ich habe dir/ die Flügel/ nicht gebunden,/du solltest/ hohe Tiefen spüren/ ganz allein, / denn nur/ mit Flügeln/ und mit Wunden/ gelingt es, /Mensch zu sein –“ (S.77)Meist wird in diesem Band die Erinnerung an das eigene Kindsein mit dem Gefühl der Vergänglichkeit konfrontiert. Kindheit wird als ein Sehnsucht erweckender Topos in einer heilen Welt dargestellt. „Kinder/ haben immer/ ihren Tag,/ sie spüren nicht/ den fremden Fluss/ der Zeit,/ alles ist für sie/ Traum und/ Wirklichkeit –“ (S.38) Das lyrische Ich blickt auf die kindliche Unbeschwertheit mit sentimentalen liebevollen Augen, die einem Großvater zugesprochen werden können. Mit diesem Blick thematisiert er wiederum die eigene Vergänglichkeit. „Der Bach denkt nicht/ an seine Quellen,/ wo er im Alter/ stirbt- /das Leben tanzt/ auf seinen Wellen,/ und nichts/ ihm seine Lust/ verdirbt-“(S.98). Lipharts Thematisierung der Vergänglichkeit nimmt stellenweise barocke Züge an und spielt mit einer Art Vanitas Motiv: „Wie sehr man doch/ die Welt/ verändert spürt, / so vieles/ hat der Mensch/ verführt, / und was er/ noch nicht/ angerührt, / hat Angst/ vor seinen Griffen –“ (S.42).Hier erinnert auch der Duktus und Gesamtstil an barocke Dichtkunst. Bernhard Liphart hat trotzdem seinen eigenen Schreibstil, vielleicht sogar eine Art Stempel gefunden: Er verzichtet durchgehend auf Punkte, stattdessen endet jedes Gedicht mit einem langen Gedankenstrich. Damit schafft er ein eigenes Markenzeichen in der Schriftsetzung. Dies hat er mit bekannten Tiroler Lyriknamen gemein: Christoph W. Bauer beispielsweise kreiert eigene formale Muster für seine Lyrik, und C.H. Huber setzt ihre Titel immer an den Schluss. Ein weiteres Kennzeichen seines Stils fällt sofort ins Auge und zwar seine konsequente Kürze. Das längste Gedicht erstreckt sich über fünfzehn Zeilen (S.31), wobei hier maximal zwei Wörter in einer Zeile zu finden sind. Auch dies scheint bei ihm typisch zu sein. Nur zwei Mal finden sich 5 Wörter als Zeilen-Höchstzahl: „schaut dir frech ins Gesicht -“ (S.71) und „Es hat ein anderes Licht“ (S. 24) im Gedicht mit dem Titel „Herbst“. Interessanterweise handelt hier auch die Zeilen-Aussage von frecher Abweichung und Andersartigkeit, gar so als wolle er seine Abweichung vom eigenen Stil im doppelten Sinne unterstreichen. Seine Textkürze lässt an Haikus denken, was ins Deutsche übertragen soviel wie „scherzhafter Vers“ bedeutet und zu seinen augenzwinkernden Zwischenzeilen passt. Diese lassen zuweilen Erinnerungen an Wilhelm Buschs treffsichere Verse, welche immer eine gewichtige Weisheit transportierten, aufkommen. Wie das folgende aphorismenhafte Gedicht erkennen lässt: „Des Menschen Tage/ sind gezählt,/ doch jeder hofft/ auf Rechenfehler –“ (S.33) Dennoch wirkt seine Wortwahl ab und an artifiziell und unausgereift ähnlich den Poesiealbumsprüchen: etwas gezwungen auch in der Reimwahl. Bei Liphart ist neben dem Verzicht von Textlänge auch eine Art Titelvermeidung festzustellen: von den 118 Gedichten in diesem Band tragen davon nicht mehr als 18 einen expliziten Titel. Einige der Titel lassen die Vermutung zu, dass sie Überschriften für mögliche Zyklen sind, welche die darauffolgenden Gedichte zusammenfassen könnten. Abschied (S.28) und Allerseelen (S.32) samt den drei anschließenden Gedichten könnten hier als Beispiel dienen. In diesem Lyrikband sind interessante Wortkombinationen und poetische Neologismen zu finden, wie ‚angeliebt‘ (S.79) oder im Gedicht mit dem Titel Religion: „Hochgehofft, / niedergeglaubt, (…)“ (S.50). Auch die Phrase „(…) in einem Fragezeichen/ eingesteint –“ (S.34) beinhaltet eine Wortneuschöpfung, welche mit den Begriffen ‚in Stein gemeiselt‘ ‚eingebaut‘, und ‚eingemeiselt‘ spielt. Durch seine kurze, prägnante und dennoch berührende Sprache kann er in der Tradition der Liebes- und Lebensgedichte von Erich Fried gesehen werden. Gerade Folgendes ist sehr ähnlich: „Liebe/ ist kein/ ,,Dann und Wann‘‘/ ein wenig heute -/ ein wenig morgen -/ ein wenig irgendwann –“ (S.88). Auch das Gedicht auf Seite 55: „Nicht die Frage - /nicht die Antwort - / nur Du –“erweckt die Erinnerung an Frieds „Dich“. Liphart schafft es dabei, ähnlich Fried, in seinen lyrischen Aussagen die lesende Person beim Zeilenverweilen zum Nachdenken zu bringen. „Manches/ ist Klarheit -/ Wahrheit/ deshalb/ noch nicht –“ (S.44). Häufig sind seine kurzen epigrammartigen Analogien im Schema x ist y zu finden. „Blühen/ist/Göttlich-Sein/ohne/Mühen –“ (S.14). Dies bindet ein wenig die Flügel der lesenden Person, welche sooft von Liphart thematisiert werden, wie zum Beispiel auf Seite 95: „Die Fäuste/ der Nacht/ vermögen nichts/ gegen die Flügel/ der Träume -“. Mit seiner bildhaften Sprache kreiert der Autor ganze Bilder im inneren Auge der lesenden Person und entspinnt ganze Szenen wie in der folgenden Zeile: „In den Flügeln/ der Dämmerung/ wärmt sich/ die Sehnsucht –“ (S.18). Als LeserIn legt man sich selbst in diese lyrischen Flügel. Fast mit Wehmut sehnt man sich nach einem längeren Gedicht, aber wahrscheinlich macht gerade dies den Reiz dieser kurzen Entführung aus: das Mehr an Schweigen, das zum eigenen Träumen und Nachdenken anregt.
Siljarosa Schletterer

Felix Mitterer: Der Boxer. Theaterstück.
Innsbruck: Haymon, 2015.
 Felix Mitterer setzt in seinen Stücken vielfach brennende Themen und brisante zeithistorische Stoffe für ein breites Theaterpublikum um. Er verfügt gewissermaßen über „den Riecher“ und bringt – nicht selten als erster – auf die Bühne, was in der Gesellschaft rumort. Dazu kommt, dass er ein gutes Gespür für interessante Charaktere, häufig reale Persönlichkeiten, hat. Beides trifft auch auf sein neues Bühnenstück – Der Boxer – zu. Felix Mitterer setzt in seinen Stücken vielfach brennende Themen und brisante zeithistorische Stoffe für ein breites Theaterpublikum um. Er verfügt gewissermaßen über „den Riecher“ und bringt – nicht selten als erster – auf die Bühne, was in der Gesellschaft rumort. Dazu kommt, dass er ein gutes Gespür für interessante Charaktere, häufig reale Persönlichkeiten, hat. Beides trifft auch auf sein neues Bühnenstück – Der Boxer – zu.
Das Stück ist, so heißt es im Untertitel, „frei nach dem Schicksal des Sinto-Boxers Johann ‚Rukeli‘ Trollmann“ gestaltet, der, nachdem er 1933 den deutschen Meistertitel im Halbschwergewicht errungen hatte, von den Nazis – als ‚Zigeuner‘ – systematisch zugrunde gerichtet wurde. Trollmann war in einer Sinti-Familie in Hannover aufgewachsen, er war ein lebenslustiger Mann, Frauenschwarm und als Boxer sehr erfolgreich. Das Publikum liebte ihn, doch bereits drei Tage nach dem Titelsieg wurde ihm dieser vom Verband der Berufsboxer wieder aberkannt – ein schwerer Schlag für seine Karriere. Offizieller Grund: ‚schlechtes‘ Boxen. Trollmann war ein wendiger und tänzelnder Boxer, dem mit bloßer brachialer Gewalt kaum beizukommen war – das galt als ‚undeutsch‘. Mitterer schreibt in seinem Vorwort: „Nachdem die Nazis Rukeli mit Konsequenzen drohten, wenn er beim nächsten Kampf sein ‚zigeunerisches Herumgeflitze‘ nicht bleiben lasse, betrat er den Ring mit blond gefärbten Haaren und mehlbestäubtem Körper, stellte sich flachfüßig in den Ring und gab die Parodie eines ‚aufrechten deutschen Faustkämpfers‘. Was folgte, war das Grauen und der Tod […].“ (S. 5) Trollmann wurde, wohl auch, weil er sich nicht alles gefallen lassen wollte, wie unzählige seiner Brüder und Schwestern der Sinti-Volksgruppe erst ausgegrenzt, dann eingesperrt, zum Arbeitsdienst gezwungen und schließlich ermordet. Was die historischen Fakten anbelangt, konnte sich Mitterer beim Schreiben auf die Recherchen von Hans Firzlaff, Knud Kohr, Martin Krauß und Roger Repplinger stützen. (S. 5ff) Die Regie und der Hauptdarsteller standen von Anfang an fest: Nach dem Erfolg von „Jägerstätter“ im Theater in der Josefstadt 1913 (Regie: Steffi Mohr, Titelfigur: Gregor Bloéb) wollte das bewährte Team noch einmal gemeinsam antreten. (S. 6)
Über die Gräueltaten der Nazis zu schreiben, ist nicht leicht, die Erfahrungen der Opfer spür- und begreifbar zu machen fast unmöglich. Wie soll man daraus eine Geschichte machen? Wie kann man ein KZ darstellen? Der Autor stellte sich diese Fragen – auf der Suche nach konkreten Lösungen der Umsetzung. Im Vorwort verweist Mitterer auf die Peinlichkeit, die angesichts von Massenszenen in Filmen über den Holocaust hochkommen – da würden abgemagerte Statisten in dreckiger Häftlingskleidung vorgeführt. In seinem Stück habe er sich damit beholfen, „dass wir […] nur zwei Häftlinge sehen, nämlich Rukeli und seinen Bruder Stabeli, alle anderen bleiben unsichtbar.“ (S. 11) Mitterer hat also den Versuch unternommen, eine gewisse Verfremdung zu erzielen – er hätte dies intensiver tun können und auch sollen.
Im Programmheft des Theaters in der Josefstadt und unter dem Titel „Rukeli lebt!“ dankt Mitterer den Nachfahren von Trollmann für die Unterstützung: „Besonders danke ich Ihnen für das Verständnis, dass ich als Dramatiker keine Dokumentation auf die Bühne stellen kann, sondern ein ergreifendes Theaterstück schreiben muss, mit Dialogen, die von mir ‚erfunden‘ sind, mit Ereignissen, die so gar nicht immer stattfanden, mit Figuren, denen Rukeli so nicht begegnete.“ (o. S.) Obwohl Mitterer erkannt hat, wie problematisch es ist, aus einem solchen Stoff ‚eine Geschichte‘ zu machen, hat er sein Stück doch als Geschichte angelegt – das ist sein Stil und letztlich auch sein Erfolgsrezept bei einem breiten Publikum. Trotzdem bleibt ernsthaft zu fragen, ob nicht zu viele Zugeständnisse an Publikumswirksamkeit gemacht wurden.
Er habe unbedingt über Rukeli schreiben müssen, schreibt Mitterer (S. 5): Die Faszination angesichts der Figur Trollmann ist nachvollziehbar, glaubwürdig ist auch das Bedürfnis, anhand seiner Geschichte generell das Verbrechen an den ‚Zigeunern‘ im Dritten Reich erzählen zu wollen. Und es ist positiv, dass das Publikum auf das Schicksal der Sinti und Roman aufmerksam gemacht wird. Der Text bietet die Voraussetzung für ein kurzweiliges Stück Figurentheater, er enthält einige intensive Passagen und führt die Entscheidungsprozesse der Hauptfigur glücklicherweise nicht allzu eindimensional vor. Die Rezensentin hat die Aufführung nicht gesehen – mag sein, dass das Buch durch die Regie von Steffi Mohr gewonnen hat; man darf annehmen, dass es an Momenten der Berührung im Theatersaal nicht gefehlt hat. Rezipiert man das Stück jedoch als Text, bleibt vorwiegend Unbehagen zurück. Warum? Es ist als exemplarische Geschichte allzu sehr auf eine klare Botschaft hin gebaut, es will das Grauen spielbar machen, wirkt dadurch konstruiert und schwarz-weiß gemalt. Außerdem versucht Mitterer da und dort, über seine Figuren geschichtliche Fakten zu vermitteln, indem er sie dieselben referieren lässt. Johann Rukeli Trollmann ist zweifellos eine fabelhafte Person gewesen, als Theaterfigur aber wird er allzu offensichtlich zu einer Figur, die für eine ‚gute‘, politisch korrekte Geschichte Verwendung findet.
Trotz der Verfremdungsversuche bleibt in Mitterers Stück wenig offen. Trollmanns Niedergang, seine Qualen und das beispiellos verbrecherische Vorgehen des Nazi-Regimes werden Szene für Szene dargelegt, erklärt und ausbuchstabiert. Zum anderen sind die dialogischen Szenen nicht die angemessene Sprache, um die Ungeheuerlichkeiten der Geschichte nachzuzeichnen. Wenn der Rassehygieniker Dr. Robert Ritter, der kalte und rücksichtslose Mediziner, die ‚Zigeuner‘ ‚vermisst‘ und ‚katalogisiert‘, ihnen Blutproben nimmt, wobei er immer gern eine scheinbar harmlose Unterhaltung mit dem alten Trollmann und seiner Frau Pessi führt, überzeugen die Dialoge nicht, die Rezensentin hat den Eindruck: So kann das niemals gewesen sein. Wenn Rukeli Trollmann für die Lagerleitung am KZ-Schauboxen teilnehmen muss, um sein Leben und das seines ebenfalls inhaftierten Bruders Stabeli zumindest noch für eine Weile zu retten, wenn außerdem sein ehemaliger Boxgegner Wolf nunmehr Lagerleiter ist, so ist das ebenso wenig glaubwürdig.
Die Verbrechen des nationalsozialistischen Apparates an den Sinti und Roma in Erinnerung zu halten, ist zu befürworten; dem Versuch, einer widerständigen, aber auch tragischen Persönlichkeit wie Johann Rukeli Trollmann ein literarisches Denkmal zu setzen, ist nichts entgegenzusetzen. Doch wie leicht ein solches Unterfangen schief gehen kann, zeigt Der Boxer ganz deutlich. Das Stück hat Qualitäten, doch vielleicht wäre das Thema mit den Mitteln des dokumentarischen Theaters, mit den Mitteln der Verfremdung und Montage letztlich überzeugender und mindestens ebenso ergreifend zu bewältigen gewesen.
Dokumentarisches Theater muss erstens nicht langweilig sein, es kann zweitens mit dem Figurentheater kombiniert werden. An einer Stelle bedient sich Mitterer ja auch der Technik der Montage und bewirkt damit mehr Wahrhaftigkeit und Berührung als alle dialogischen Szenen zuvor: In seiner größten Not hört Rukeli aus der Ferne (aus einer anderen Dimension also) die Stimme eines Mädchens: Es sind wörtliche Zitate der Romni Ceija Stojka, die der Autor Karin Bergers erschütterndem Film über die Dichterin entnommen und eingeflochten hat. Mehr solche Szenen, mehr Brüche und mehr Leerstellen hätten diesem Stück wohl gut getan.
Erika Wimmer

Horst Moser: Etwas bleibt immer.
Bozen: Edition Raetia, 2015.
Vom Verlassen, Loslassen und Zulassen
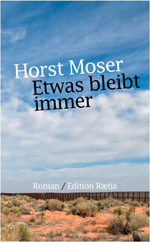 Etwas bleibt immer - und so soll es auch sein, wenn einer ein spannendes und zugleich kunstvoll konstruiertes Buch über die großen Themen der Menschheit, über Einsamkeit und Liebe, Gewalt, Erinnerung, Heimat und Fremdsein schreibt. Horst Mosers zweiter Roman hinterlässt auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck. Etwas bleibt immer - und so soll es auch sein, wenn einer ein spannendes und zugleich kunstvoll konstruiertes Buch über die großen Themen der Menschheit, über Einsamkeit und Liebe, Gewalt, Erinnerung, Heimat und Fremdsein schreibt. Horst Mosers zweiter Roman hinterlässt auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck.
Das mag einerseits am sprachlichen Duktus liegen, der Ton ist langsam und ruhig, der Aufbau klassisch mit Rückblenden und Andeutungen, und kunstvoll ineinander verwoben sind die Geschichten der vier Protagonisten und ihrer Familien, in denen alles miteinander in Zusammenhang zu stehen scheint. Denn, so heißt es schon auf der ersten Seite des Romans: "Manchmal [...] liegt die Wahrheit jenseits des Vernehmbaren und nimmt verzweigte Wege, bis sie langsam an die Oberfläche kommt und durchsickert, um dann liegen zu bleiben, und nur manchmal wird sie als das wahrgenommen, was sie ist, nämlich eine Abfolge von Ereignissen, die uns begegnen, ohne oder durch unser Zutun, zuweilen scheint auch das egal zu sein. Wir sind die Summe all dessen, was wir in unserem Leben zulassen, das ist die Wahrheit, dachte Svensson, und begann die ersten Sätze aufzuschreiben." (5) In diesen Sätzen ist eigentlich schon fast alles über die Geschichte des Buches gesagt. Denn immer wieder geht es darin um Ereignisse, die ohne das Zutun der Protagonisten geschehen oder, anders ausgedrückt: die geschehen, weil die Figuren nicht aktiv handeln oder Entscheidungen treffen, sondern die Ereignisse - wie es im Zitat heißt - einfach zulassen. Die Protagonisten, das sind der Journalist Manuel Svensson, ein "stiller und aufmerksamer Beobachter", der gelernt hat, "den Dingen mit einer gewissen Distanz zu begegnen, um sie nicht wichtiger zu nehmen, als sie sind" (10f). In der Rolle des "Zuschauers, der auf den Verlauf des Beobachteten keinerlei Einfluss nahm" (40) sieht sich auch zunehmend der erfolgreiche Anwalt Stefan Leitner, der mit seinem älteren Bruder Johannes, dem im Roman die Rolle des gescheiterten Versagers zukommt, im gleichen Haus in Innsbruck aufgewachsen ist wie die toughe Investmentbankerin Vera Rosenberg, deren Vater in seinem Kiosk Opfer eines Überfalls wurde. Und hier, am Ausgangspunkt des Romans, beginnt sich auch schon alles miteinander zu verknüpfen. Denn als Svensson über das mysteriöse Gewaltverbrechen berichtet, nimmt Vera Rosenberg Kontakt zu ihm auf, um ihn von der Unschuld des mutmaßlichen Täters zu überzeugen, allerdings ohne konkrete Beweise nennen zu können. Das Einzige, was sie dem Journalisten überlässt, ist ein scheinbar wenig aufschlussreiches Tonband, auf dem ihr Vater am Tag des Überfalls Gedanken und Erinnerungen für seine Tochter aufgezeichnet hat.
Und auch das verbindet alle Figuren: Sie stehen unter der Macht der Erinnerungen an ihre Kindheit und Jugend, Erinnerungen, die sie ein Leben lang nicht loslassen. Vor allem Manuel Svensson ist von seinen - anfangs etwas überzeichnet wirkenden - Kindheitserfahrungen und -erinnerungen so stark geprägt, dass es zunächst überrascht - dann aber fast als logische Konsequenz dieser Erfahrungen scheint -, wie aus ihm dieser ruhige und sachliche, aber keineswegs emotionslose Beobachter seiner Umwelt werden konnte. Als Manuel Hernandez in Mexiko geboren musste er eine von Kälte und roher Brutalität geprägte Kindheit in dem Land erleben, in das es seine Mutter Anna von einer "merkwürdigen Sehnsucht" getrieben zurückgezogen hatte. Zurück deshalb, weil sie als Zehnjährige sie in Mexico City für mehrere mysteriöse Stunden verloren gegangen war. Der Mangel an Nähe und Gefühlen, den Manuel als Kind erfahren musste, bestimmt auch die Erinnerungen von Vera und den Brüdern Stefan und vor allem Johannes. Ihre gemeinsame Kindheit erscheint in ihrer Erinnerung zwar als eine "Welt, die schöner nicht hätte sein können" (85), doch wie die Eiche zwischen den Mauern ihres Innenhofs fühlten auch sie sich eingesperrt in dieser nur scheinbar idyllischen Welt, denn so heißt es symbolisch: Eichen werden sehr groß, aber nur, "wenn man sie lässt" (54). Am stärksten bekommt das Johannes zu spüren: "Wie groß er auch wachsen kann, er wird nie größer werden, als die Mauern um ihn herum es ihm erlauben, dachte er und erkannte sich in diesem Gedanken selbst." (157) Nach dem Selbstmord des Vaters und unter dem ständigen Vergleich mit seinem jüngeren Bruder Stefan leidend, kommt er mit seinem Leben einfach nicht zurecht. Seinen wachsenden Zorn und seine kaum mehr kontrollierbare Aggressivität richtet er schließlich vor allem gegen sich selbst, sodass ihm als einzige Hoffnung nur mehr das Verlassen seiner Heimat bleibt. Und diese Flucht führt ihn - und wieder verknüpfen sich die Handlungsstränge - nach Mexiko.
Mexiko - das ist das andere große Thema in Mosers Roman. Die direkte und distanzlose Beschreibung des Elends, der Armut und der Hoffnungslosigkeit, die unzählige Menschen die Flucht in die USA wagen lässt, macht betroffen. Und es bleibt eine große Beklommenheit angesichts der Unmenschlichkeit und Kälte, mit der aus dieser Flüchtlingstragödie Profit geschlagen wird. Dass ein Menschenleben hier nichts zählt, erfährt während seiner Arbeit für eine Hilfsorganisation auch Johannes. Und die Erinnerung daran, wie hunderte, tausende Flüchtlinge unter dem Zug, mit dem sie dem Elend zu entkommen hofften, sterben oder verstümmelt werden, lässt ihn nicht mehr los. Dass hier - wie auch in der Geschichte der anderen Hauptfiguren - ein Hoffnungsschimmer bleibt, mag vielleicht kitschig erscheinen. Aber vor dem Hintergrund der Macht der Erinnerungen, erfährt es eine größere Tiefe. Und die Geschichte muss ja weitergehen, immerhin geht es auch um die Aufklärung eines Verbrechens. Und hier, auf den letzten Seiten des Romans, lässt einen die Geschichte endgültig nicht mehr los, alles, was bisher nur andeutungsweise miteinander verwoben war, beginnt sich langsam zu erklären und Moser gelingt es meisterhaft, die Spannung bis zum Ende zu halten.
Was am Ende bleibt, ist auch das Porträt einer Generation. Der aufstrebende Journalist, der erfolgreiche Anwalt und die toughe Bankerin, erfolgsorientiert und zielstrebig und doch unterworfen den Erinnerungen, die sie nicht loslassen, und den Ereignissen, die sie zulassen. Es bleibt, was zu Beginn des Romans schon gesagt wird: "Wir sind die Summe all dessen, was wir in unserem Leben zulassen" (5).
Sandra Unterweger

Peter Oberndorfer: Schweres Gift. Ein Wien-Krimi.
Berlin: Aufbau Verlag 2015, 362 Seiten.
Tödliche Karriere
 Akonitin, ein aus dem wunderschönen Blauen Eisenhut gewonnenes Gift, hat es zu einigem literarischem Ruhm gebracht: in einer Oscar Wilde-Geschichte, aber vor allem in James Joyce's Ulysses, in dem der Vater des Protagonisten Leopold Bloom damit seinen Selbstmord bewerkstelligt. Fans und Aficionados des Kultautors, die schon mal eine vom literarisch intellektuellen Übervater getragene Krawatte aus einem Joyce-Museum pfladern, mag das inspirieren, Otto Bramböck, der hier wegen Mordes ermittelt, geht diesbezüglich spät, aber doch ein Licht auf. Bramböck ist ein Ermittler, “der seinen Job macht und gut darin ist”. Der Fall einer viel versprechenden jungen Underground-Sängerin, der irgendjemand - eben ein Joyce-Aficionado wie sich schließlich herausstellt - Akonitin ins obligate Wasserglas vor dem Gig mengt, ufert jedoch aus. Funktionieren konnte das Ganze, weil die Newcomerin vorher mit kleinen Pillen ein wenig zugedröhnt war - und auch das wusste der mörderische Giftler geschickt einzufädeln. Welche Rolle spielt Ron Razorblade, ein abgehalfteter Alt-Punk aus Portland, Oregon? Ausgerechnet in Wien startet er sein Come-back und stößt auf diese umwerfende Linda Steinberg. Wird hopsgenommen, aber wider besseres Wissen zu lange festgehalten. So läuft das nicht. Weil sich die internationale, zumal US-amerikanische Medienwelt und Anwaltschaft einschalten. Klage gegen den österreichischen Staat! Das Innenministerium wird nervös, Bramböck wird abgezogen, ermittelt aber auf eigene Faust weiter. Und behält recht. Akonitin, ein aus dem wunderschönen Blauen Eisenhut gewonnenes Gift, hat es zu einigem literarischem Ruhm gebracht: in einer Oscar Wilde-Geschichte, aber vor allem in James Joyce's Ulysses, in dem der Vater des Protagonisten Leopold Bloom damit seinen Selbstmord bewerkstelligt. Fans und Aficionados des Kultautors, die schon mal eine vom literarisch intellektuellen Übervater getragene Krawatte aus einem Joyce-Museum pfladern, mag das inspirieren, Otto Bramböck, der hier wegen Mordes ermittelt, geht diesbezüglich spät, aber doch ein Licht auf. Bramböck ist ein Ermittler, “der seinen Job macht und gut darin ist”. Der Fall einer viel versprechenden jungen Underground-Sängerin, der irgendjemand - eben ein Joyce-Aficionado wie sich schließlich herausstellt - Akonitin ins obligate Wasserglas vor dem Gig mengt, ufert jedoch aus. Funktionieren konnte das Ganze, weil die Newcomerin vorher mit kleinen Pillen ein wenig zugedröhnt war - und auch das wusste der mörderische Giftler geschickt einzufädeln. Welche Rolle spielt Ron Razorblade, ein abgehalfteter Alt-Punk aus Portland, Oregon? Ausgerechnet in Wien startet er sein Come-back und stößt auf diese umwerfende Linda Steinberg. Wird hopsgenommen, aber wider besseres Wissen zu lange festgehalten. So läuft das nicht. Weil sich die internationale, zumal US-amerikanische Medienwelt und Anwaltschaft einschalten. Klage gegen den österreichischen Staat! Das Innenministerium wird nervös, Bramböck wird abgezogen, ermittelt aber auf eigene Faust weiter. Und behält recht.
Dem in Innsbruck geborenen, in Wien studierten und in Thailand lebenden Peter Oberndorfer, Jahrgang 1971, gelingt nach seinem in der knorrigen Tiroler Bergwelt angelegten Krimi-Erstling Kreuzigers Tod (2008) ein solide spannender urbaner Whodunit.
Bernhard Sandbichler

Thomas Schafferer: Differdange liegt am Meer.
Luxemburg: Edition phi, 2014.
Differdange liegt am Meer – eine poetische Liebeserklärung, die „sich mit tirol aber auch mit luxemburg auseinandersetzt“
 Mit seinem neuen, 2014 im Luxemburger Verlag Edition phi erschienenen Lyrikband lässt Thomas Schafferer wieder aufhorchen. Seine in Buchform geronnene Liebeserklärung an seine aus Luxemburg stammende Frau, der dieses Werk auch gewidmet ist, schafft poetisch Bemerkenswertes. In seinen 74 Gedichten gelingt es ihm nicht nur Luxemburg mit seinen Eigenheiten lyrisch einzufangen, sondern „nicht erst hier eine liebeserklärung an das// großherzlichkeitstum aus[zu]sprechen, als// zwei welten aufeinander prallen (…)“, wie er selbst im Gedicht ‚grand duchesse’ (S. 33) charakterisiert. Dieses Aufeinanderprallen von zwei Länderwelten wird in diesem Band zu einer ‘verschreibbarten‘ Annährung und Auseinandersetzung auch in der Beziehung zwischen lyrischem Du und Ich. Durch das Einarbeiten der anderen, der Luxemburger Sprache, welches einem Einverleiben gleicht, wird die Fremdheit immer mehr zur vertrauten Heimat. Mit seinem neuen, 2014 im Luxemburger Verlag Edition phi erschienenen Lyrikband lässt Thomas Schafferer wieder aufhorchen. Seine in Buchform geronnene Liebeserklärung an seine aus Luxemburg stammende Frau, der dieses Werk auch gewidmet ist, schafft poetisch Bemerkenswertes. In seinen 74 Gedichten gelingt es ihm nicht nur Luxemburg mit seinen Eigenheiten lyrisch einzufangen, sondern „nicht erst hier eine liebeserklärung an das// großherzlichkeitstum aus[zu]sprechen, als// zwei welten aufeinander prallen (…)“, wie er selbst im Gedicht ‚grand duchesse’ (S. 33) charakterisiert. Dieses Aufeinanderprallen von zwei Länderwelten wird in diesem Band zu einer ‘verschreibbarten‘ Annährung und Auseinandersetzung auch in der Beziehung zwischen lyrischem Du und Ich. Durch das Einarbeiten der anderen, der Luxemburger Sprache, welches einem Einverleiben gleicht, wird die Fremdheit immer mehr zur vertrauten Heimat.
nicht mehr aus dem kopf
seelenverwandt mit dir, mit
euch, amte ich dich ein
atme ich auch ein, atme ich
eure sprache ein, wasche
mein gehirn mit eurer
sprache, war noch nie so
weit in deine, in eure
sprache vorgedrungen
hatte noch nie so viel
verstanden wie in diesen
tagen in diesem land (S.27)
Wie aufwühlend dieses sich Näherkommen, diese gegenseitige auch geografische Offenbarung sein kann, wird im Gedicht „recherche I“ deutlich: „nach den schlimmsten weinkrämpfen, nicht// mehr aufhören können zu lachen, nicht// mehr aufhören können zu lieben, nicht// mehr aufhören können wach zu bleiben// (…) sich vom einen auf den anderen// moment plötzlich nicht mehr verstehen// und sogar an das ende einer liebe denken“ (S.23).Dennoch erkennt das lyrische Ich am Ende (des Bandes): ‚,all das bist du‘‘ (S.88).Der Prozess des geografischen und seelischen Näherkommens wird von Schafferer poetisch verschriftlicht. Seine autobiografische (Liebes-) Recherche wird damit auch eine poetische Landeserforschung: er erzählt, wie er ihrer Welt, ihrer Heimat, näher kommt und damit auch ihr. „(…) wenn ich am weg nach hause // deinem zuhause bin, mit dir“ (S. 17) Denn er kann endlich ankommen. Wie im Gedicht „toi et moi“ (S.12) hat das lyrische Ich„einen ort gefunden (…) wo ich endlich ankommen kann// unbeschwert, sanft und liebevoll// landen kann bei dir“.
Diesen ihren Ort beschreibt Schafferer sehr orts- und wortkundig und macht Luxemburg und damit auch Cécile, seiner Frau, seiner ‚miss minett‘ (S.22),seine Aufwartung. Schon der Titel „differdange liegt am meer“, welcher einem Gedichttitel (S.20) entspricht, bringt seine metaphorische Beschäftigung mit einem Luxemburgischem Ort, dem Heimatort seiner Frau, dar.Er bringt den lesenden Reisebegleitern die ,‚artenreichste kreisverkehrslandschaft der welt‘‘ (S.28) nahe und schafft damit mehr als nur ,‚ein gedicht, das sich mit tirol aber auch mit luxemburg auseinandersetzt‘‘ (S.53).Schafferer gelingt es die luxemburgische Atmosphäre, deren art-de-vivre einzufangen auch die luxemburgischen Kulturen und Szenen und Persönlichkeiten zu charakterisieren. Der Autor beschreibt die Topografie und landschaftsbewohnenden Personen und schafft so ein „déifferdenger landschaftsbild“ (S.36) bei Nacht und bei Tag.
Diese Beschreibung von (gemeinsam) erlebten und erzählten Gegebenheiten ist wie eine Reisebeschreibung konzipiert und lässt Erinnerungen an seine Reisegedichte 500 Polaroids aufkommen. Der Autor kreiert, um es im Zeitgeist neudeutsch zu formulieren, ein poetisches Selfie von sich und seiner Frau auf der Reise durch Luxemburg. Der Band ist auch chronologisch wie eine fiktive Reise aufgebaut; obwohl die Gedichte nicht zusammenhängend, sondern in einem weiten Zeitraum von zehn Jahren (2001-2011) entstanden sind. Als rezipierende Person fährt man im inneren Auge mit den beiden lyrischen Akteuren mit. Zu Beginn des Bandes (S.18) erleben die lesenden Personen mit dem lyrischen Ich die Vorfreude auf die Fahrt „dorthin, woher du kommst// freue mich darauf zu erleben, was// uns verbindet (…)“.Der Band endet mit dem Schlussgedicht „Schengen“, der letzte luxemburgischen Ort vor der Grenze auf der Strecke nach Österreich.
Seine Wortwahl und sein Stil sind komplex, metaphernreich und dennoch leicht zugänglich. Schafferer verbarrikadiert sich nicht hinter einen ausgewählten Kreis an Kennern, sondern bedient eine junge, an peppige Sprache gewöhnte Leserschaft. Man merkt seinem Duktus die Versiertheit der zehnten Veröffentlichung an und das Können, mit den aktuellen lyrischen Verfahren zu jonglieren. Ganz im Stil der Zeit pflegt er eine konsequente Kleinschreibung und einen Verzicht auf Punkte. Auch seine Mehrsprachigkeit, seine Verflechtung von vor allem Deutsch, Französisch und Luxemburgisch, sowie die Paarung von Fremd-, Slang- und Hochsprache entspricht dem Zeitgeist und ist eine interessante Bewegung in der deutschsprachigen Lyrik, welche unter anderem von der „spoken word“ Szene angeregt wurde. Diese Mehrsprachigkeit kann auch als Abbild des sprachlichen Alltags mit den verschiedenen Landessprachen Luxemburgs gedeutet werden. Dennoch triftet diese Mehrsprachigkeit zum Teil in eine andere zeitgenössische Richtung und zwar in die des poeta doctus ab. Sobald Schafferer einen ganzen zweiseitigen Dialog, ein Streitgespräch, in ausschließlich luxemburgischen Kraftausdrücken darstellt, wird der Inhalt den lesenden deutschsprachigen Personen semantisch schwer verständlich (S.50-51). Doch zumeist beleben und erklären sich die Sprachen gegenseitig wie im Gedicht ‚stupp‘ (S.25) beschreibt er Kosenamen gebenden Partner, „(…)die sich stupp// nennen was so viel bedeutet wie// „schatz“, denn mäer hunn eis// gäer, ganz vill gäer“. Schafferer, so wird der Eindruck erweckt, versucht sich der sprachlichen Malkunst und zeichnet ein Charakterbild seiner Frau und ihrer (gemeinsamen) Lebensgeschichte – einer Geschichte, die ‚sie erzählt‘ zum Beispiel im Gedicht dunkle leidenschaft‘ (S.21). Ob diese Darstellungen fiktional oder frei erlebt oder wirklich treu nachgezeichnet sind, bleibt ohne Antwort und als offene Frage für die Leser und Leserinnen bestehen.
Siljarosa Schletterer

Bernd Schuchter: Innsbruck abseits der Pfade.
Wien: Braumüller, 2015.
Großer Flanneur
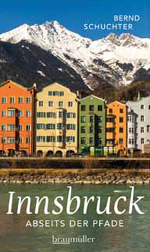 Dieser Stadtführer ist von einem Flaneur für Flaneure geschrieben: nomadisch und unabhängig, die Komplexität seines Gegenstands, seine Schichten und Fragmente literarisch erfassend. Der Innsbrucker Mikrokosmos erzählt hier eine sehr persönliche Universalegeschichte ebenso wie sehr persönliche regionale Geschichten. Alles, was man über die 104,9 qkm Stadtgebiet wissen und in ihm unternehmen soll, findet sich in sechs gemütlichen Viertel-Spaziergängen verhandelt. Sie heißen, ganz konventionell, “Zwischen Judenbühel und Scheibenbühel”, aber auch ganz unkonventionell etwa “Innsbruck und die Migration”. Alles ist unaufdringlich, Tipps, “Orte zum Verweilen”, Literatisches und Sachen “zum Nachkochen” werden zum textlichen Hauptgang nachgereicht. Besonders hübsch ist die Gestaltung des broschierten Bandes mit S/W-Fotos von Peter Gründhammer bzw. Bernd Schuchter selbst. Was heißt hübsch?! Diese bildlichen Beigaben sind zum Teil so herausragend, wie Innsbruck seit Langem nicht mehr zu sehen war. Man darf dieses Buch guten Gewissens als Geschenk ans Herz legen. Dieser Stadtführer ist von einem Flaneur für Flaneure geschrieben: nomadisch und unabhängig, die Komplexität seines Gegenstands, seine Schichten und Fragmente literarisch erfassend. Der Innsbrucker Mikrokosmos erzählt hier eine sehr persönliche Universalegeschichte ebenso wie sehr persönliche regionale Geschichten. Alles, was man über die 104,9 qkm Stadtgebiet wissen und in ihm unternehmen soll, findet sich in sechs gemütlichen Viertel-Spaziergängen verhandelt. Sie heißen, ganz konventionell, “Zwischen Judenbühel und Scheibenbühel”, aber auch ganz unkonventionell etwa “Innsbruck und die Migration”. Alles ist unaufdringlich, Tipps, “Orte zum Verweilen”, Literatisches und Sachen “zum Nachkochen” werden zum textlichen Hauptgang nachgereicht. Besonders hübsch ist die Gestaltung des broschierten Bandes mit S/W-Fotos von Peter Gründhammer bzw. Bernd Schuchter selbst. Was heißt hübsch?! Diese bildlichen Beigaben sind zum Teil so herausragend, wie Innsbruck seit Langem nicht mehr zu sehen war. Man darf dieses Buch guten Gewissens als Geschenk ans Herz legen.
Bernhard Sandbichler

Carolina Schutti: Eulen fliegen lautlos. Novelle.
Innsbruck: edition laurin bei innsbruck university press, 2015.
 Mit dieser Novelle legt die frisch gekürte EU-Preisträgerin Carolina Schutti eine außerordentliche Arbeit vor: die Geschichte eines Kindes. In „Eulen fliegen lautlos“ nimmt der Leser die Welt eines etwa 6-jährigen Buben aus dessen Perspektive wahr. Die Sprache, der Stil, die kunstvolle Verschränkung von seinen Wahrnehmungen, Sprachfetzen, elterlichen Aufforderungen, ritualisierten Handlungen, die zum Teil wortwörtlich, stereotyp, formelhaft wiederholt werden, erlauben einen Blick in das Innensein, ohne es zu entblößen oder gar bloßzustellen. Mit dieser Novelle legt die frisch gekürte EU-Preisträgerin Carolina Schutti eine außerordentliche Arbeit vor: die Geschichte eines Kindes. In „Eulen fliegen lautlos“ nimmt der Leser die Welt eines etwa 6-jährigen Buben aus dessen Perspektive wahr. Die Sprache, der Stil, die kunstvolle Verschränkung von seinen Wahrnehmungen, Sprachfetzen, elterlichen Aufforderungen, ritualisierten Handlungen, die zum Teil wortwörtlich, stereotyp, formelhaft wiederholt werden, erlauben einen Blick in das Innensein, ohne es zu entblößen oder gar bloßzustellen.
Jakob lebt mit seinen Eltern in einem Haus am Waldrand, Ort und Zeit bleiben weitgehend unbestimmt. Er ist ein träumerisches, phantasiebegabtes, wegen einer „Sprachstörung“ in der Schule zurückgestelltes Kind, das seine Umwelt mit allen Sinnen erfassen, erforschen will, und dabei an elterliche Grenzen stößt. Sein Umfeld besteht aus einem strengen, nie fröhlich lachenden Vater, einer sich fügenden Mutter und einem Briefträger, der als einziger dem Kind Wohlwollen entgegenzubringen scheint. Seine „Spielgefährten“ sind neben einem Eichhörnchen und Ameisen die ausgestopften Tiere im Keller des Hauses. Mit der Pflege dieser Tiere beginnt die Erzählung, mit der Sinnlichkeit des Leders, dessen Geruch.
Im Umgang mit der präparierten Eule zeigt sich die Beziehung vom Sohn zum Vater. Interessiert stellt Jakob die Frage: „Haben die Krallen Mäuse geschlagen, Hasen, einen kleinen Fuchs?“ Worauf der Vater mit „Kleine Kinder, wenn sie nicht aufhören zu fragen“ antwortet, „und der Vater lacht … Lacht, dass es aus dem Haus hinausdröhnt in den dunklen Wald hinein und in die Ohren des neben ihm knienden Kindes, dessen Schultern augenblicklich schmal geworden sind.“ In solch subtilen Beobachtungen, nuancierten Andeutungen entsteht das Bild einer verletzlichen Kinderseele, das jedoch über Andeutungen nicht hinausgeht, auch wenn diese so deutlich sind, dass über Misshandlung kaum Zweifel bestehen kann. „So oft hat Jakob den Frühling noch nicht kommen sehen, dass er dem Eichhörnchen nicht zuflüstern wollte, was sonst keiner hören darf. Vom Schmerz, den der Vater hinterlässt, vom wilden Schnauben, das manchmal in seinen, Jakobs, Haaren hängenbleibt. An den Wind denkt er, an den, der vom Wald herkommt, wenn der Vater enttäuscht ist von sich und stattdessen den Gürtel aus der Hose zieht, um dem Kind früh zu zeigen, dass man Wut nicht hinunterschluckt. An den Wind denkt er, wenn der Vater die Hose schließt und horcht, ob die Mutter noch schläft.“
Das schmale Buch besteht aus 14 Kapiteln. Schon das erste erzählt im Grunde genommen den gesamten Inhalt. Die anderen 13 Kapitel beinhalten Paraphrasen, kehrreimartige Wiederholungen von bereits Erzähltem. Eines dieser, wie der Refrain eines Gedichtes wiederkehrenden Motive ist: „Und die leisen Sockenfüße tapsen, der kleine Atem bewegt nicht die stockende Luft“ oder: „Das Kartenspiel führt in die Nacht.“ Es sind Satzfragmente, Wörter, die scheinbar aus anderen Kontexten losgelöst, schweben, in Jakobs Welt eindringen, sie durchdringen, besetzen, sich wieder lösen. Der dichte Text spannt von Beginn an einen Bogen. In dieser Kinderwelt existiert die Zeit nicht als eine vorwärtsdrängende, in die Zukunft weisende Kraft, sondern es ist die mythische Allgegenwart des Immergleichen, das nur unwesentlich variiert wird. Das Spiel mit den toten und lebenden Tieren ist seine soziale Kommunikation. Ein Vater, der trotz seiner angedeuteten Brutalität nichts Dämonisches hat; eine Mutter, die trotz ihrer angedeuteten Unzufriedenheit sich durch Schreien Luft macht und den Sohn nicht schikaniert. Ein Kind, das in eine Welt voller Verletzungen, aber auch zärtlicher Gesten versetzt ist, das das, was ihm widerfährt, mit einer Totalität wahrnimmt, die dem Augenblick eigen ist. Es ist dünn, dieses Kind, blass, kaum lebensfähig. Eine große Seele ist dieses Kind, das sich in den engen Begriffen seiner Umwelt, in den Anleitungen, wie man etwas „richtig“ macht: die Schuhe schnüren, Wurzeln schneiden …, lernwillig und aufnahmebereit zeigt, aber in seiner Weltentdeckungslust ständig behindert wird. Das Auffinden eines verendeten Rehkitzes im Schnee dient dem Vater dazu, dem Kind ein warnendes Beispiel ins Ohr zu brüllen: „Komm her, schau zu!, brüllt der Vater, das passiert wenn man zu wenig isst.“ Jakob nimmt dies als Vorschau auf die Möglichkeit, einer verletzenden Welt zu entrinnen, wahr.
„Eulen fliegen lautlos“ ist der sensibel, einfühlsam erzählte Versuch einer Annäherung ans kindliche Gemüt, der Versuch, sanft in eine Erlebens- und Vorstellungswelt mittels Sprache einzudringen: einer höchst poetischen Sprache, die von Andeutungen, Auslassungen und Anspielungen lebt; kleinen Hinweisen, die dechiffriert werden wollen, hingehauchte Worte, verwehende Worte, die der Gewalt, die das Kind erlebt, standhalten. Die unglaubliche Schönheit dieses Prosagedichts erschließt sich nach mehrmaligem Lesen umso mehr. Dann wird deutlich, was man schon beim ersten Lesen ahnt: dass Carolina Schutti kein Wort zu viel geschrieben hat, dass jedes Wort an seinem Platz ist, und auf diese Weise etwas entsteht, das noch nicht zu lesen war.
Florian Braitenthaller

|
 Dass das Bändchen bibliofil gestaltet ist, entspricht dem Charakter dieses Zyklus von 15 Gedichten. Sie sind traditionsgesättigte Lyrik, der es auf Klang und hohen Stil und Bildlichkeit als Merkmale des ‚schönen’ Gedichts ankommt. Die Anlehnung an lyrische Traditionen ist aber nicht epigonales Nachahmen, sondern Bauer macht diese Anlehnung zum Thema, indem er sie von Anfang an deutlich markiert, schon im Titel, der auf einen berühmten Vers von Paul Éluard anspielt („La terre est bleue comme une orange“), und dann in der Fülle von Bezugnahmen auf einen Zeitgenossen Éluards, den andalusischen Poeten Federico García Lorca, der immer wieder im spanischen Original zitiert wird. Das letzte Gedicht des Zyklus (XV) spricht den spanischen Lyriker direkt an:
Dass das Bändchen bibliofil gestaltet ist, entspricht dem Charakter dieses Zyklus von 15 Gedichten. Sie sind traditionsgesättigte Lyrik, der es auf Klang und hohen Stil und Bildlichkeit als Merkmale des ‚schönen’ Gedichts ankommt. Die Anlehnung an lyrische Traditionen ist aber nicht epigonales Nachahmen, sondern Bauer macht diese Anlehnung zum Thema, indem er sie von Anfang an deutlich markiert, schon im Titel, der auf einen berühmten Vers von Paul Éluard anspielt („La terre est bleue comme une orange“), und dann in der Fülle von Bezugnahmen auf einen Zeitgenossen Éluards, den andalusischen Poeten Federico García Lorca, der immer wieder im spanischen Original zitiert wird. Das letzte Gedicht des Zyklus (XV) spricht den spanischen Lyriker direkt an:  Über randnotizen, die Erstveröffentlichung, des jungen Südtiroler Dichters Michael Denzer zu schreiben ist, um in seinen Worten zu bleiben, wie „den Text eines wunderbaren Liedes vorzulesen, ohne ihn zu singen und dabei die Gitarrenakkorde, welche ihn begleiten nur aufzuzählen“ (S.7). Der Autor entführt durch seine Werke, ins „Zwischenzeilenland“ (S.19) und zeigt uns dabei den eignen „separated twin“ (Mirror, S.42); Lesend schlüpft man selbst in die Rolle der neunzehnjährigen dichtenden Person und sieht die Welt durch deren Wortweltbrille, durch welche das zusammengeknüllte Papier, Heimat, ein Stromausfall, erste Liebe sowie lebensphilosophische Gedanken dazu anregen, in die Welt der Dichter einzutauchen und den Wörtern unentwegt zu begegnen. Denzer schafft es, zeitresistent den eigenen Weg zu beschreiten dabei gleichzeitig ein Beispiel für typisch postmoderne Mannigfaltigkeit und Klanglichkeit zu sein. Zum einen sind die Vielfalt an Formen und der gewandte Umgang damit ganz im Stil der Zeit; so steht ein Langgedicht in Slamlänge gleichberechtigt neben einem epigrammartigen Kurzgedicht und einer alten traditionellen Form wie dem Sonett. Zusätzlich finden sich in seinen Gedichten „Augenblickwinkel“ voll Sprachwitz, denn „Whenever I plant a poe-tree//(…) My mind is like a metaphor“ („Metaphor“, S.21). Wie die großen LyrikerInnen der Zeit mischt auch er Mehrsprachigkeit gekonnt. So finden sich Werke in Deutsch, Englisch und Italienisch, teilweise sogar polyglott vereint in einem Gedicht „denn so ist es nunmal, // rien ne va plus!“ („Augenblickwinkel“, S.20). Ähnlich wie Nora Gomringer und andere ist er vom Poetry Slam geprägt. Die lesende Person wird von der Slam-Stimme in seiner Lyrik angesprochen. Demzufolge ist die Klanglichkeit durchgehend sehr präsent und der Reim ein essentielles Bindemittel. In seinem Reimreichtum trifft man, wie zu vermuten ist, auf die unterschiedlichsten Arten von Reimen, jedoch ist der traditionelle Endreim vorherrschend. Diese Aspekte von postmoderner Vielfalt treffen bei ihm zum Teil auf mittelalterliche Minneakte, die im Slamklang präsentiert werden. Auf eine naiv berührende Weise beweist Denzer, dass es durchaus möglich ist, im 21. Jahrhundert zart und optimistisch über bekannte drei Worte und Innenwelten zu schreiben, ohne von der gegenwärtig vorherrschenden Gefühlsscheu und Innigkeitsabwehr mitgerissen zu sein. Er schreibt in einer Sprache, die noch unbescholten Wahrheit zu transportieren scheint, ähnlich „Kindern die noch mit den Händen sehen“ (Seifenblasenwelten, S.65). Er wagt Reimstrukturen und Liebesthematiken einzubauen, er traut sich auf seinen 72 Seiten, was andere nicht wagen und gewinnt. „You cannot write poetry, without giving it a try“ (S.8), wie er selbst seinem Gedichtband vorausschickt. Seine Gedichte sprechen dabei direkt an, ohne wie Frank Schmitter meinte, überflüssig „Pfauenrad schlagende Verformung und Verkopfung“ und „poetische Sperrgebiete“ zu besiedeln. Besonders macht sich das im Gedicht „Zwischenzeilenland“ (S.19) bemerkbar. Auffallend ist, dass es, als ob es dem zitierten aristotelischen „Horror vacui“ entgegenhalten will, die Leere des Raumes zwischen den Zeilen ausformuliert. Dadurch gelingt es Denzer, zwei einzelne selbstständige Gedichte in einem Werk zu vereinen und somit genaugenommen drei Gedichte zu kreieren, die einzeln oder zusammen gelesen Sinn ergeben. Dieses Werk wird so zu einer Art Kunst des richtigen Lesewinkels. Zusätzlich macht es selbstreflexiv die Vieldeutigkeit und zwischen-den-Zeilen-Sprachen-Spiel von Lyrik zum Thema.
Über randnotizen, die Erstveröffentlichung, des jungen Südtiroler Dichters Michael Denzer zu schreiben ist, um in seinen Worten zu bleiben, wie „den Text eines wunderbaren Liedes vorzulesen, ohne ihn zu singen und dabei die Gitarrenakkorde, welche ihn begleiten nur aufzuzählen“ (S.7). Der Autor entführt durch seine Werke, ins „Zwischenzeilenland“ (S.19) und zeigt uns dabei den eignen „separated twin“ (Mirror, S.42); Lesend schlüpft man selbst in die Rolle der neunzehnjährigen dichtenden Person und sieht die Welt durch deren Wortweltbrille, durch welche das zusammengeknüllte Papier, Heimat, ein Stromausfall, erste Liebe sowie lebensphilosophische Gedanken dazu anregen, in die Welt der Dichter einzutauchen und den Wörtern unentwegt zu begegnen. Denzer schafft es, zeitresistent den eigenen Weg zu beschreiten dabei gleichzeitig ein Beispiel für typisch postmoderne Mannigfaltigkeit und Klanglichkeit zu sein. Zum einen sind die Vielfalt an Formen und der gewandte Umgang damit ganz im Stil der Zeit; so steht ein Langgedicht in Slamlänge gleichberechtigt neben einem epigrammartigen Kurzgedicht und einer alten traditionellen Form wie dem Sonett. Zusätzlich finden sich in seinen Gedichten „Augenblickwinkel“ voll Sprachwitz, denn „Whenever I plant a poe-tree//(…) My mind is like a metaphor“ („Metaphor“, S.21). Wie die großen LyrikerInnen der Zeit mischt auch er Mehrsprachigkeit gekonnt. So finden sich Werke in Deutsch, Englisch und Italienisch, teilweise sogar polyglott vereint in einem Gedicht „denn so ist es nunmal, // rien ne va plus!“ („Augenblickwinkel“, S.20). Ähnlich wie Nora Gomringer und andere ist er vom Poetry Slam geprägt. Die lesende Person wird von der Slam-Stimme in seiner Lyrik angesprochen. Demzufolge ist die Klanglichkeit durchgehend sehr präsent und der Reim ein essentielles Bindemittel. In seinem Reimreichtum trifft man, wie zu vermuten ist, auf die unterschiedlichsten Arten von Reimen, jedoch ist der traditionelle Endreim vorherrschend. Diese Aspekte von postmoderner Vielfalt treffen bei ihm zum Teil auf mittelalterliche Minneakte, die im Slamklang präsentiert werden. Auf eine naiv berührende Weise beweist Denzer, dass es durchaus möglich ist, im 21. Jahrhundert zart und optimistisch über bekannte drei Worte und Innenwelten zu schreiben, ohne von der gegenwärtig vorherrschenden Gefühlsscheu und Innigkeitsabwehr mitgerissen zu sein. Er schreibt in einer Sprache, die noch unbescholten Wahrheit zu transportieren scheint, ähnlich „Kindern die noch mit den Händen sehen“ (Seifenblasenwelten, S.65). Er wagt Reimstrukturen und Liebesthematiken einzubauen, er traut sich auf seinen 72 Seiten, was andere nicht wagen und gewinnt. „You cannot write poetry, without giving it a try“ (S.8), wie er selbst seinem Gedichtband vorausschickt. Seine Gedichte sprechen dabei direkt an, ohne wie Frank Schmitter meinte, überflüssig „Pfauenrad schlagende Verformung und Verkopfung“ und „poetische Sperrgebiete“ zu besiedeln. Besonders macht sich das im Gedicht „Zwischenzeilenland“ (S.19) bemerkbar. Auffallend ist, dass es, als ob es dem zitierten aristotelischen „Horror vacui“ entgegenhalten will, die Leere des Raumes zwischen den Zeilen ausformuliert. Dadurch gelingt es Denzer, zwei einzelne selbstständige Gedichte in einem Werk zu vereinen und somit genaugenommen drei Gedichte zu kreieren, die einzeln oder zusammen gelesen Sinn ergeben. Dieses Werk wird so zu einer Art Kunst des richtigen Lesewinkels. Zusätzlich macht es selbstreflexiv die Vieldeutigkeit und zwischen-den-Zeilen-Sprachen-Spiel von Lyrik zum Thema. Der Fotograf Lois Hechenblaikner sagt in einem Interview der Zeit: “Henri Cartier-Bresson hat gesagt: ‘Fotografie ist eine Art zu schreien.’ Die Veränderungsprozesse in meiner Heimat haben mich sehr belastet, sie haben auf meine Gesundheit geschlagen. Mit der Fotografie habe ich ein Mittel gefunden, mich zu wehren. Dank meiner Bilder kann niemand mehr sagen, dass es nicht so war. Wenn die lokalen Medien gleichgeschaltet sind, alle in dieser Schicksalsgemeinschaft namens Tourismus mittun, braucht es einen wie mich, der den Preis, den wir bezahlen, sichtbar macht. Aber es geht mir nicht darum, meine Heimat in den Dreck zu ziehen. Ich bin kein Nestbeschmutzer und kein Verhörnter. Ich liebe meine Heimat. Dies zeige ich in meiner Arbeit. Nur verstehen das noch nicht alle. Man hat mich verleumdet, bedroht, Ausstellungen von mir verboten.” Hechenblaikner poltert gern und schaut grimmig. “Die Hütte, das ist das größte Kulturhurengut der Alpen”, sagt er dem Spiegel. Fotografen stellen im Dienst der Tourismusindustrie nach wie vor Idyllen nach. “Fotografische Zuhälterei”. Armin Kniely, Erika Hubatschek, Hubert Leischner, Udo Bernhard, Sepp Hofer, Leo Bährendt, deren diesbezüglich unschuldig klassischen Schwarz-Weiß-Fotografien - Mitte der 1930er bis Ende der 1960er Jahre als Dokumente einer ausgewogen ruralen Kulturlandschaft entstanden - stellt Hechenblaikner eigenen Arbeiten aus den Jahren 2001 bis 2008 gegenüber. Seine eigenen Motive irritieren, weil sie Bildelemente des historischen Fotomaterials aufnehmen, ihre Perversion im Zug des touristischen Akkumulierungswahns auf den zweiten Blick vor Augen führen: müllversaute Festwiesen nach einem Schürzenjäger-Openair in Finkenberg, Fanbus-Schwadronen, die zum Kastelruther Spatzentreff anrücken, Schneekanonen, Pistenraupen, Saufspiele allüberall. Ähnliches hatte 1996 auch schon der Südtiroler
Der Fotograf Lois Hechenblaikner sagt in einem Interview der Zeit: “Henri Cartier-Bresson hat gesagt: ‘Fotografie ist eine Art zu schreien.’ Die Veränderungsprozesse in meiner Heimat haben mich sehr belastet, sie haben auf meine Gesundheit geschlagen. Mit der Fotografie habe ich ein Mittel gefunden, mich zu wehren. Dank meiner Bilder kann niemand mehr sagen, dass es nicht so war. Wenn die lokalen Medien gleichgeschaltet sind, alle in dieser Schicksalsgemeinschaft namens Tourismus mittun, braucht es einen wie mich, der den Preis, den wir bezahlen, sichtbar macht. Aber es geht mir nicht darum, meine Heimat in den Dreck zu ziehen. Ich bin kein Nestbeschmutzer und kein Verhörnter. Ich liebe meine Heimat. Dies zeige ich in meiner Arbeit. Nur verstehen das noch nicht alle. Man hat mich verleumdet, bedroht, Ausstellungen von mir verboten.” Hechenblaikner poltert gern und schaut grimmig. “Die Hütte, das ist das größte Kulturhurengut der Alpen”, sagt er dem Spiegel. Fotografen stellen im Dienst der Tourismusindustrie nach wie vor Idyllen nach. “Fotografische Zuhälterei”. Armin Kniely, Erika Hubatschek, Hubert Leischner, Udo Bernhard, Sepp Hofer, Leo Bährendt, deren diesbezüglich unschuldig klassischen Schwarz-Weiß-Fotografien - Mitte der 1930er bis Ende der 1960er Jahre als Dokumente einer ausgewogen ruralen Kulturlandschaft entstanden - stellt Hechenblaikner eigenen Arbeiten aus den Jahren 2001 bis 2008 gegenüber. Seine eigenen Motive irritieren, weil sie Bildelemente des historischen Fotomaterials aufnehmen, ihre Perversion im Zug des touristischen Akkumulierungswahns auf den zweiten Blick vor Augen führen: müllversaute Festwiesen nach einem Schürzenjäger-Openair in Finkenberg, Fanbus-Schwadronen, die zum Kastelruther Spatzentreff anrücken, Schneekanonen, Pistenraupen, Saufspiele allüberall. Ähnliches hatte 1996 auch schon der Südtiroler  Die noch ‚aufnahmefrische‘ CD von Fransen besticht in ihrer Charakterisierung der Wochentage durch ihre erfrischende Klangkombination in Wort als auch Musik. Hinter der improvisierten Musik von Fransen stehen als Personen Hannes Sprenger am Saxophon und Live-electronics, sowie Klex Wolf an den Keys und Live-electronics. Um sich zu „zerfransen“ bevorzugen sie die „unscharfen Ränder der Musik, die sich meist da zeigen, wo die Spiellaune ungesittet an allzu strengen Regeln rüttelt.“Die Menschen hinter den Wortklangwelten sind: Ursula Timea Rossel & Markus Köhle, die in personam AutorenInnen und vortragende Personen der Werke in einem sind. Produziert wurde dieses „Instantprodukt“ neben Fransen Musik auch von 8ung kultur, einem Verein zur kulturellen-literarischen Belebung des Landes. Auf vierzehn Tracks werden die Wochentage zweimal, jeweils einmal von Köhle und Rossel, in Worte gesetzt, mit Phrasen umgarnt und umschrieben. Die Spannweite der Länge ist alles andere als ‚Hitradio genormt‘, sondern reicht von über acht Minuten Einspielzeit („Samstagsgeschichte: Was ich suche aus der Dose“, Track 11) bis zu Kürzesteinspielung von vier Sekunden („Dienstag“, Track 3). In letzterer wird symptomatisch auch einzig die Aussage getroffen, dass Dienstage immer zu kurz kämen. Die Beziehung zwischen Musik und Text hat einen starken Kommunikationscharakter. Musikalischer Klang kommentiert, unterstreicht und kontrapunktiert verbal Gesagtes, zum Teil wird auch damit kokettiert. Sprachlicher Rhythmus wird instrumental aufgenommen und unterstrichen, verschmilzt so noch mehr ineinander. Fransen gelingt es, dem Text ein Mehr an Zuhör-Raum zu schenken. Sie verführen dazu, immer stärker an den Lippen bzw. eigentlich an den Lautsprechern hängen zu wollen, kommt doch die Musik in solch einem ‚catchy‘ Gewand daher. Besonders einfühlend und elegisch wirken die Keyboard- und Saxklänge in Track 10. („Freitag: Robinson“). Durch sie wird man mit Robinson auf die Insel verbannt und lauscht gebannt dem innermusikalischen Wellengang. Musik wird zum Teil auch in den Texten thematisiert. „Wäre ich ein Lied, ich hätte schrille Töne“, so Markus Köhle in „Samstag“(Track 12) und Ursula Timea Rossel meint in „Montags: Paranoia“ (Track 2):„Individuellpersönlich bin ich ein wenig bestürzt (…). Dann lege ich eben falsche Tonfährten, erzeuge Geräusche“. Passend zum Titel „Sonntags: Fertiggotteshaus“ (Track 13) erklingen ‚fertige‘ Orgelklänge‚ um den großen Gott in die Kirche zu bekommen‘. Doch belehrt einem die CD am Ende, „der Sonntag ist jetzt anders, ein Tag wie jeder andere“ (Sonntag, Track 14). In welcher Tradition diese literarisch-musikalische Wochensezierung zu verorten ist, fällt schwer. In einem Gespräch mit dem Musiker Wolf meinte er wahrscheinlich am treffendsten über die Musik: „wenn wir improvisiern, wahts ins halt irgendwohin…“. Erstaunlicherweise hätten sie beide oftmals „Rock im Kopf“, obwohl ihr Sound nicht auf den ersten Blick daran erinnern mag, ist ein gemeinsam sehr geschätzter Musiker Frank Zappa. Auf der CD ist oft ein selbstironisches Augenzwinkern zu finden, das „nicht alles bierernst“ nimmt oder wie Ursula Timea Rossel in „Montags: Paranoia“ meint: „na gut, jetzt kommts nicht mehr drauf an, ich steh öffentlich dazu, es ist: BIER-SHAMPOO!“ Diese vielschichte Selbstironie in den Texten als auch in den musikalischen Improvisationen lässt zuweilen an Pirchner denken, vor allem an sein 1973 erschienenes ein halbes doppelalbum. Sprenger hat sich schon intensiver mit Pirchner beschäftigt (u.a. CD-Einspielung mit AkkoSax). Der Zwischenbereich von Kabarett, Sprachspiel und Musik ist auch Heimo Wisser sehr nahe. Gerade die Art und Weise wie mit Texten umgegangen wird, erinnert an seine Arbeit. Der musikalische-literarische Duktus erinnert stark an die Form des Hörspiels, ebenso die Textbehandlung lässt diese Parallelen zu. Das Zusammenwirken von Wort und Musik, auch der musikalische Aufgabenbereich sind ident. Der Hörspielcharakter ist beizeiten so stark, dass man die Produktion auch „vierzehn Kurzhörspiele“ betiteln könnte. Einer der schreibenden Personen, Markus Köhle, hat schon Erfahrung mit diesem Medium: in Kommunikationsklimbim, ein Hörspiel, das 2008 ausgestrahlt wurde. Die Vorgehensweise oder der Produktionsplan, um sich den Worten des CD-Cover anzugleichen, scheint ein sehr kreativer gewesen zu sein. Die Werke entstanden in mehreren Impro-Sessions zu den fertigen Texten. Dieses Zusammenwirken wurde anschließend aufgenommen und dann zum Teil geschnitten. Ähnlich dem Hörspiel kann man bei dieser Produktion auch von einer Art Montage sprechen. Zu Beginn entstand die Idee die erste „passierte“ CD von Fransen Mittwochs mit Literatur zu vereinen und auf alle Wochentage auszuweiten. Der Schreibstil der AutorenInnen ist unterschiedlich. Rossels Kryptogeografie, ein netzaktives Lebensprojekt, welches in ihrem Roman Man nehme Silber und Knoblauch, Erde und Salz als bisheriges Kompendium gipfelte, ist in der Selbstbeschreibung eine markante, wenn auch wenig bekannte und noch weniger exakte Wissenschaft, die sich mit verborgenen und geheimen Dingen auf und in der Erde und um die Erde herum beschäftigt. In der Form sei sie opulent, arabesk, barock, ornamental, oriental, knorrig und verzworgelt. Ein kryptogeographisches Motto lautet: „Bahnhof ist die einzige Sprache, die ich verstehe“. Diese Beschäftigung schwingt auch in den CD-Texten sehr stark mit. Damit fordert sie intensives Lesen und Hören ein. Sie schafft so eine besondere Art von Intensität auf den zweiten Blick. Ihre Sprache ist grenzwertiger für dieses Hörspielkonzept wegen ihrer kryptischen Komplexität. Markus Köhle hingegen ist als treibender Motor in der österreichischen Slampoetrylandschaft nicht wegzudenken. Er bezeichnet sich selbst als Sprachinstallateur, Poetry Slammer und Literaturzeitschriftenaktivist, der schreibt, um gehört zu werden. Gerade in diesem letzten Satz wird seine Klangaffinität und akustische Meisterschaft deutlich. Köhle besitzt slamtypisch ein unglaubliches Rhythmus- und Timingfeingefühl. In der Beschreibung von Klex Wolf waren die Aufnahmesessions „so als ob drei Musiker, zu dritt den Text improvisiert“ hätten. Sie erschaffen so Literatur fürs Ohr. Köhles Wortspielereien regen zum Schmunzeln an und verblüffen zugleich in ihrer Assoziationenleichtigkeit, wie dieses Zitat aus Samstag (Track 12) zeigt: „Ohne Tag bin ich nur ein Sams, ein Kinderbuchheld mit Froschfüßen“. Durch die kontrastierende Gegenüberstellung kommen die zwei verschiedenen Charaktere der Autoren womöglich mehr zum Vorschein. Zugleich werden die Verschiedenheiten und Dualitäten auf mehreren Ebenen vereint. Zwei verschiedene Sprecher, aus zwei verschiedenen dialektalen Ufern und Schreibarten einen sich mit zwei verschiedenen oder doch gleichen Kunstsparten: Musik und Text. Doch auf der Aufnahme vereint sich alles im Ohr, alle scheinbaren Gegensätze verschmelzen gleichberechtigt im Klang. Insofern könnte es auch als eine moderne geslammte Fortsetzung der Vorlesetradition gesehen werden. Nachdem einem als zuhörende Person ein „Licht aufgeht“ wie im Track 5 („Mittwochs Post“) bezüglich der Reize dieser Produktion, wird die Vorfreude immer stärker auf hoffentlich baldige weiterer musikalisch-literarische Instantbearbeitungen der Monate und Jahreszeiten…
Die noch ‚aufnahmefrische‘ CD von Fransen besticht in ihrer Charakterisierung der Wochentage durch ihre erfrischende Klangkombination in Wort als auch Musik. Hinter der improvisierten Musik von Fransen stehen als Personen Hannes Sprenger am Saxophon und Live-electronics, sowie Klex Wolf an den Keys und Live-electronics. Um sich zu „zerfransen“ bevorzugen sie die „unscharfen Ränder der Musik, die sich meist da zeigen, wo die Spiellaune ungesittet an allzu strengen Regeln rüttelt.“Die Menschen hinter den Wortklangwelten sind: Ursula Timea Rossel & Markus Köhle, die in personam AutorenInnen und vortragende Personen der Werke in einem sind. Produziert wurde dieses „Instantprodukt“ neben Fransen Musik auch von 8ung kultur, einem Verein zur kulturellen-literarischen Belebung des Landes. Auf vierzehn Tracks werden die Wochentage zweimal, jeweils einmal von Köhle und Rossel, in Worte gesetzt, mit Phrasen umgarnt und umschrieben. Die Spannweite der Länge ist alles andere als ‚Hitradio genormt‘, sondern reicht von über acht Minuten Einspielzeit („Samstagsgeschichte: Was ich suche aus der Dose“, Track 11) bis zu Kürzesteinspielung von vier Sekunden („Dienstag“, Track 3). In letzterer wird symptomatisch auch einzig die Aussage getroffen, dass Dienstage immer zu kurz kämen. Die Beziehung zwischen Musik und Text hat einen starken Kommunikationscharakter. Musikalischer Klang kommentiert, unterstreicht und kontrapunktiert verbal Gesagtes, zum Teil wird auch damit kokettiert. Sprachlicher Rhythmus wird instrumental aufgenommen und unterstrichen, verschmilzt so noch mehr ineinander. Fransen gelingt es, dem Text ein Mehr an Zuhör-Raum zu schenken. Sie verführen dazu, immer stärker an den Lippen bzw. eigentlich an den Lautsprechern hängen zu wollen, kommt doch die Musik in solch einem ‚catchy‘ Gewand daher. Besonders einfühlend und elegisch wirken die Keyboard- und Saxklänge in Track 10. („Freitag: Robinson“). Durch sie wird man mit Robinson auf die Insel verbannt und lauscht gebannt dem innermusikalischen Wellengang. Musik wird zum Teil auch in den Texten thematisiert. „Wäre ich ein Lied, ich hätte schrille Töne“, so Markus Köhle in „Samstag“(Track 12) und Ursula Timea Rossel meint in „Montags: Paranoia“ (Track 2):„Individuellpersönlich bin ich ein wenig bestürzt (…). Dann lege ich eben falsche Tonfährten, erzeuge Geräusche“. Passend zum Titel „Sonntags: Fertiggotteshaus“ (Track 13) erklingen ‚fertige‘ Orgelklänge‚ um den großen Gott in die Kirche zu bekommen‘. Doch belehrt einem die CD am Ende, „der Sonntag ist jetzt anders, ein Tag wie jeder andere“ (Sonntag, Track 14). In welcher Tradition diese literarisch-musikalische Wochensezierung zu verorten ist, fällt schwer. In einem Gespräch mit dem Musiker Wolf meinte er wahrscheinlich am treffendsten über die Musik: „wenn wir improvisiern, wahts ins halt irgendwohin…“. Erstaunlicherweise hätten sie beide oftmals „Rock im Kopf“, obwohl ihr Sound nicht auf den ersten Blick daran erinnern mag, ist ein gemeinsam sehr geschätzter Musiker Frank Zappa. Auf der CD ist oft ein selbstironisches Augenzwinkern zu finden, das „nicht alles bierernst“ nimmt oder wie Ursula Timea Rossel in „Montags: Paranoia“ meint: „na gut, jetzt kommts nicht mehr drauf an, ich steh öffentlich dazu, es ist: BIER-SHAMPOO!“ Diese vielschichte Selbstironie in den Texten als auch in den musikalischen Improvisationen lässt zuweilen an Pirchner denken, vor allem an sein 1973 erschienenes ein halbes doppelalbum. Sprenger hat sich schon intensiver mit Pirchner beschäftigt (u.a. CD-Einspielung mit AkkoSax). Der Zwischenbereich von Kabarett, Sprachspiel und Musik ist auch Heimo Wisser sehr nahe. Gerade die Art und Weise wie mit Texten umgegangen wird, erinnert an seine Arbeit. Der musikalische-literarische Duktus erinnert stark an die Form des Hörspiels, ebenso die Textbehandlung lässt diese Parallelen zu. Das Zusammenwirken von Wort und Musik, auch der musikalische Aufgabenbereich sind ident. Der Hörspielcharakter ist beizeiten so stark, dass man die Produktion auch „vierzehn Kurzhörspiele“ betiteln könnte. Einer der schreibenden Personen, Markus Köhle, hat schon Erfahrung mit diesem Medium: in Kommunikationsklimbim, ein Hörspiel, das 2008 ausgestrahlt wurde. Die Vorgehensweise oder der Produktionsplan, um sich den Worten des CD-Cover anzugleichen, scheint ein sehr kreativer gewesen zu sein. Die Werke entstanden in mehreren Impro-Sessions zu den fertigen Texten. Dieses Zusammenwirken wurde anschließend aufgenommen und dann zum Teil geschnitten. Ähnlich dem Hörspiel kann man bei dieser Produktion auch von einer Art Montage sprechen. Zu Beginn entstand die Idee die erste „passierte“ CD von Fransen Mittwochs mit Literatur zu vereinen und auf alle Wochentage auszuweiten. Der Schreibstil der AutorenInnen ist unterschiedlich. Rossels Kryptogeografie, ein netzaktives Lebensprojekt, welches in ihrem Roman Man nehme Silber und Knoblauch, Erde und Salz als bisheriges Kompendium gipfelte, ist in der Selbstbeschreibung eine markante, wenn auch wenig bekannte und noch weniger exakte Wissenschaft, die sich mit verborgenen und geheimen Dingen auf und in der Erde und um die Erde herum beschäftigt. In der Form sei sie opulent, arabesk, barock, ornamental, oriental, knorrig und verzworgelt. Ein kryptogeographisches Motto lautet: „Bahnhof ist die einzige Sprache, die ich verstehe“. Diese Beschäftigung schwingt auch in den CD-Texten sehr stark mit. Damit fordert sie intensives Lesen und Hören ein. Sie schafft so eine besondere Art von Intensität auf den zweiten Blick. Ihre Sprache ist grenzwertiger für dieses Hörspielkonzept wegen ihrer kryptischen Komplexität. Markus Köhle hingegen ist als treibender Motor in der österreichischen Slampoetrylandschaft nicht wegzudenken. Er bezeichnet sich selbst als Sprachinstallateur, Poetry Slammer und Literaturzeitschriftenaktivist, der schreibt, um gehört zu werden. Gerade in diesem letzten Satz wird seine Klangaffinität und akustische Meisterschaft deutlich. Köhle besitzt slamtypisch ein unglaubliches Rhythmus- und Timingfeingefühl. In der Beschreibung von Klex Wolf waren die Aufnahmesessions „so als ob drei Musiker, zu dritt den Text improvisiert“ hätten. Sie erschaffen so Literatur fürs Ohr. Köhles Wortspielereien regen zum Schmunzeln an und verblüffen zugleich in ihrer Assoziationenleichtigkeit, wie dieses Zitat aus Samstag (Track 12) zeigt: „Ohne Tag bin ich nur ein Sams, ein Kinderbuchheld mit Froschfüßen“. Durch die kontrastierende Gegenüberstellung kommen die zwei verschiedenen Charaktere der Autoren womöglich mehr zum Vorschein. Zugleich werden die Verschiedenheiten und Dualitäten auf mehreren Ebenen vereint. Zwei verschiedene Sprecher, aus zwei verschiedenen dialektalen Ufern und Schreibarten einen sich mit zwei verschiedenen oder doch gleichen Kunstsparten: Musik und Text. Doch auf der Aufnahme vereint sich alles im Ohr, alle scheinbaren Gegensätze verschmelzen gleichberechtigt im Klang. Insofern könnte es auch als eine moderne geslammte Fortsetzung der Vorlesetradition gesehen werden. Nachdem einem als zuhörende Person ein „Licht aufgeht“ wie im Track 5 („Mittwochs Post“) bezüglich der Reize dieser Produktion, wird die Vorfreude immer stärker auf hoffentlich baldige weiterer musikalisch-literarische Instantbearbeitungen der Monate und Jahreszeiten… Mit seinem neuen Werk Getanztes Licht veröffentlicht Liphart seinen dritter Lyrikband (nach Der andere Weg tastet die Sterne 2009 und Den Sternen ist kein Weg zu weit 2011) und fünfte Veröffentlichung beim Tiroler Verlag Berenkamp. Der Verlag wurde 1991 in Schwaz gegründet und bezeichnet sich selbst als den kleinen Verlag mit dem großen Programm. Der Autor wurde 1932 geboren und ist von Beruf Rechtsanwalt. Seine Passion des Schreibens stellt er selbst mit folgenden Worten dar: ‚,Die Gedichte sind nicht mit Hingabe erfunden. Ganz plötzlich und unerwartet höre ich sie für einen Augenblick, hastig sie niederzuschreiben in einem Gruß.“ Im Gedichtband fallen zwei große Themenkreise auf. Wie der Buchtitel vermuten lässt, ist ein zentrales Motive der Gedichte das Licht. „Licht/ ist wie das Lob/ der Träume,/ ist wie aus Lust/ ein Lied, / ist wie ein Lächeln/ alter Freunde,/ das Jungsein gibt –“ (S.39) Auch das letzte Gedicht des Bandes thematisiert dies mit der Zeile „Dunkelheit ist wartendes Licht“ (S. 123). Diese Worte können gleichzeitig als Beschreibung des einprägsamen Layouts angesehen werden. Der Schriftzug, welcher leuchtendes Licht in dunkler Umgebung nachahmt, sticht sofort ins Auge. Auf Seite 13 befindet sich eine seiner treffenden Aussagen. „Wo Kinder/ lachen/ wird Licht/ in die Welt/ gestellt –“. Damit verbindet er die zwei großen Themenkreise des Bandes, denn in seinem zweiten zentralen Motiv behandelt er die Kindheitsthematik. Zuweilen thematisiert Liphart auch die Erziehung auf berührende und weise Art: „Ich habe dir/ die Flügel/ nicht gebunden,/du solltest/ hohe Tiefen spüren/ ganz allein, / denn nur/ mit Flügeln/ und mit Wunden/ gelingt es, /Mensch zu sein –“ (S.77)Meist wird in diesem Band die Erinnerung an das eigene Kindsein mit dem Gefühl der Vergänglichkeit konfrontiert. Kindheit wird als ein Sehnsucht erweckender Topos in einer heilen Welt dargestellt. „Kinder/ haben immer/ ihren Tag,/ sie spüren nicht/ den fremden Fluss/ der Zeit,/ alles ist für sie/ Traum und/ Wirklichkeit –“ (S.38) Das lyrische Ich blickt auf die kindliche Unbeschwertheit mit sentimentalen liebevollen Augen, die einem Großvater zugesprochen werden können. Mit diesem Blick thematisiert er wiederum die eigene Vergänglichkeit. „Der Bach denkt nicht/ an seine Quellen,/ wo er im Alter/ stirbt- /das Leben tanzt/ auf seinen Wellen,/ und nichts/ ihm seine Lust/ verdirbt-“(S.98). Lipharts Thematisierung der Vergänglichkeit nimmt stellenweise barocke Züge an und spielt mit einer Art Vanitas Motiv: „Wie sehr man doch/ die Welt/ verändert spürt, / so vieles/ hat der Mensch/ verführt, / und was er/ noch nicht/ angerührt, / hat Angst/ vor seinen Griffen –“ (S.42).Hier erinnert auch der Duktus und Gesamtstil an barocke Dichtkunst. Bernhard Liphart hat trotzdem seinen eigenen Schreibstil, vielleicht sogar eine Art Stempel gefunden: Er verzichtet durchgehend auf Punkte, stattdessen endet jedes Gedicht mit einem langen Gedankenstrich. Damit schafft er ein eigenes Markenzeichen in der Schriftsetzung. Dies hat er mit bekannten Tiroler Lyriknamen gemein: Christoph W. Bauer beispielsweise kreiert eigene formale Muster für seine Lyrik, und C.H. Huber setzt ihre Titel immer an den Schluss. Ein weiteres Kennzeichen seines Stils fällt sofort ins Auge und zwar seine konsequente Kürze. Das längste Gedicht erstreckt sich über fünfzehn Zeilen (S.31), wobei hier maximal zwei Wörter in einer Zeile zu finden sind. Auch dies scheint bei ihm typisch zu sein. Nur zwei Mal finden sich 5 Wörter als Zeilen-Höchstzahl: „schaut dir frech ins Gesicht -“ (S.71) und „Es hat ein anderes Licht“ (S. 24) im Gedicht mit dem Titel „Herbst“. Interessanterweise handelt hier auch die Zeilen-Aussage von frecher Abweichung und Andersartigkeit, gar so als wolle er seine Abweichung vom eigenen Stil im doppelten Sinne unterstreichen. Seine Textkürze lässt an Haikus denken, was ins Deutsche übertragen soviel wie „scherzhafter Vers“ bedeutet und zu seinen augenzwinkernden Zwischenzeilen passt. Diese lassen zuweilen Erinnerungen an Wilhelm Buschs treffsichere Verse, welche immer eine gewichtige Weisheit transportierten, aufkommen. Wie das folgende aphorismenhafte Gedicht erkennen lässt: „Des Menschen Tage/ sind gezählt,/ doch jeder hofft/ auf Rechenfehler –“ (S.33) Dennoch wirkt seine Wortwahl ab und an artifiziell und unausgereift ähnlich den Poesiealbumsprüchen: etwas gezwungen auch in der Reimwahl. Bei Liphart ist neben dem Verzicht von Textlänge auch eine Art Titelvermeidung festzustellen: von den 118 Gedichten in diesem Band tragen davon nicht mehr als 18 einen expliziten Titel. Einige der Titel lassen die Vermutung zu, dass sie Überschriften für mögliche Zyklen sind, welche die darauffolgenden Gedichte zusammenfassen könnten. Abschied (S.28) und Allerseelen (S.32) samt den drei anschließenden Gedichten könnten hier als Beispiel dienen. In diesem Lyrikband sind interessante Wortkombinationen und poetische Neologismen zu finden, wie ‚angeliebt‘ (S.79) oder im Gedicht mit dem Titel Religion: „Hochgehofft, / niedergeglaubt, (…)“ (S.50). Auch die Phrase „(…) in einem Fragezeichen/ eingesteint –“ (S.34) beinhaltet eine Wortneuschöpfung, welche mit den Begriffen ‚in Stein gemeiselt‘ ‚eingebaut‘, und ‚eingemeiselt‘ spielt. Durch seine kurze, prägnante und dennoch berührende Sprache kann er in der Tradition der Liebes- und Lebensgedichte von Erich Fried gesehen werden. Gerade Folgendes ist sehr ähnlich: „Liebe/ ist kein/ ,,Dann und Wann‘‘/ ein wenig heute -/ ein wenig morgen -/ ein wenig irgendwann –“ (S.88). Auch das Gedicht auf Seite 55: „Nicht die Frage - /nicht die Antwort - / nur Du –“erweckt die Erinnerung an Frieds „Dich“. Liphart schafft es dabei, ähnlich Fried, in seinen lyrischen Aussagen die lesende Person beim Zeilenverweilen zum Nachdenken zu bringen. „Manches/ ist Klarheit -/ Wahrheit/ deshalb/ noch nicht –“ (S.44). Häufig sind seine kurzen epigrammartigen Analogien im Schema x ist y zu finden. „Blühen/ist/Göttlich-Sein/ohne/Mühen –“ (S.14). Dies bindet ein wenig die Flügel der lesenden Person, welche sooft von Liphart thematisiert werden, wie zum Beispiel auf Seite 95: „Die Fäuste/ der Nacht/ vermögen nichts/ gegen die Flügel/ der Träume -“. Mit seiner bildhaften Sprache kreiert der Autor ganze Bilder im inneren Auge der lesenden Person und entspinnt ganze Szenen wie in der folgenden Zeile: „In den Flügeln/ der Dämmerung/ wärmt sich/ die Sehnsucht –“ (S.18). Als LeserIn legt man sich selbst in diese lyrischen Flügel. Fast mit Wehmut sehnt man sich nach einem längeren Gedicht, aber wahrscheinlich macht gerade dies den Reiz dieser kurzen Entführung aus: das Mehr an Schweigen, das zum eigenen Träumen und Nachdenken anregt.
Mit seinem neuen Werk Getanztes Licht veröffentlicht Liphart seinen dritter Lyrikband (nach Der andere Weg tastet die Sterne 2009 und Den Sternen ist kein Weg zu weit 2011) und fünfte Veröffentlichung beim Tiroler Verlag Berenkamp. Der Verlag wurde 1991 in Schwaz gegründet und bezeichnet sich selbst als den kleinen Verlag mit dem großen Programm. Der Autor wurde 1932 geboren und ist von Beruf Rechtsanwalt. Seine Passion des Schreibens stellt er selbst mit folgenden Worten dar: ‚,Die Gedichte sind nicht mit Hingabe erfunden. Ganz plötzlich und unerwartet höre ich sie für einen Augenblick, hastig sie niederzuschreiben in einem Gruß.“ Im Gedichtband fallen zwei große Themenkreise auf. Wie der Buchtitel vermuten lässt, ist ein zentrales Motive der Gedichte das Licht. „Licht/ ist wie das Lob/ der Träume,/ ist wie aus Lust/ ein Lied, / ist wie ein Lächeln/ alter Freunde,/ das Jungsein gibt –“ (S.39) Auch das letzte Gedicht des Bandes thematisiert dies mit der Zeile „Dunkelheit ist wartendes Licht“ (S. 123). Diese Worte können gleichzeitig als Beschreibung des einprägsamen Layouts angesehen werden. Der Schriftzug, welcher leuchtendes Licht in dunkler Umgebung nachahmt, sticht sofort ins Auge. Auf Seite 13 befindet sich eine seiner treffenden Aussagen. „Wo Kinder/ lachen/ wird Licht/ in die Welt/ gestellt –“. Damit verbindet er die zwei großen Themenkreise des Bandes, denn in seinem zweiten zentralen Motiv behandelt er die Kindheitsthematik. Zuweilen thematisiert Liphart auch die Erziehung auf berührende und weise Art: „Ich habe dir/ die Flügel/ nicht gebunden,/du solltest/ hohe Tiefen spüren/ ganz allein, / denn nur/ mit Flügeln/ und mit Wunden/ gelingt es, /Mensch zu sein –“ (S.77)Meist wird in diesem Band die Erinnerung an das eigene Kindsein mit dem Gefühl der Vergänglichkeit konfrontiert. Kindheit wird als ein Sehnsucht erweckender Topos in einer heilen Welt dargestellt. „Kinder/ haben immer/ ihren Tag,/ sie spüren nicht/ den fremden Fluss/ der Zeit,/ alles ist für sie/ Traum und/ Wirklichkeit –“ (S.38) Das lyrische Ich blickt auf die kindliche Unbeschwertheit mit sentimentalen liebevollen Augen, die einem Großvater zugesprochen werden können. Mit diesem Blick thematisiert er wiederum die eigene Vergänglichkeit. „Der Bach denkt nicht/ an seine Quellen,/ wo er im Alter/ stirbt- /das Leben tanzt/ auf seinen Wellen,/ und nichts/ ihm seine Lust/ verdirbt-“(S.98). Lipharts Thematisierung der Vergänglichkeit nimmt stellenweise barocke Züge an und spielt mit einer Art Vanitas Motiv: „Wie sehr man doch/ die Welt/ verändert spürt, / so vieles/ hat der Mensch/ verführt, / und was er/ noch nicht/ angerührt, / hat Angst/ vor seinen Griffen –“ (S.42).Hier erinnert auch der Duktus und Gesamtstil an barocke Dichtkunst. Bernhard Liphart hat trotzdem seinen eigenen Schreibstil, vielleicht sogar eine Art Stempel gefunden: Er verzichtet durchgehend auf Punkte, stattdessen endet jedes Gedicht mit einem langen Gedankenstrich. Damit schafft er ein eigenes Markenzeichen in der Schriftsetzung. Dies hat er mit bekannten Tiroler Lyriknamen gemein: Christoph W. Bauer beispielsweise kreiert eigene formale Muster für seine Lyrik, und C.H. Huber setzt ihre Titel immer an den Schluss. Ein weiteres Kennzeichen seines Stils fällt sofort ins Auge und zwar seine konsequente Kürze. Das längste Gedicht erstreckt sich über fünfzehn Zeilen (S.31), wobei hier maximal zwei Wörter in einer Zeile zu finden sind. Auch dies scheint bei ihm typisch zu sein. Nur zwei Mal finden sich 5 Wörter als Zeilen-Höchstzahl: „schaut dir frech ins Gesicht -“ (S.71) und „Es hat ein anderes Licht“ (S. 24) im Gedicht mit dem Titel „Herbst“. Interessanterweise handelt hier auch die Zeilen-Aussage von frecher Abweichung und Andersartigkeit, gar so als wolle er seine Abweichung vom eigenen Stil im doppelten Sinne unterstreichen. Seine Textkürze lässt an Haikus denken, was ins Deutsche übertragen soviel wie „scherzhafter Vers“ bedeutet und zu seinen augenzwinkernden Zwischenzeilen passt. Diese lassen zuweilen Erinnerungen an Wilhelm Buschs treffsichere Verse, welche immer eine gewichtige Weisheit transportierten, aufkommen. Wie das folgende aphorismenhafte Gedicht erkennen lässt: „Des Menschen Tage/ sind gezählt,/ doch jeder hofft/ auf Rechenfehler –“ (S.33) Dennoch wirkt seine Wortwahl ab und an artifiziell und unausgereift ähnlich den Poesiealbumsprüchen: etwas gezwungen auch in der Reimwahl. Bei Liphart ist neben dem Verzicht von Textlänge auch eine Art Titelvermeidung festzustellen: von den 118 Gedichten in diesem Band tragen davon nicht mehr als 18 einen expliziten Titel. Einige der Titel lassen die Vermutung zu, dass sie Überschriften für mögliche Zyklen sind, welche die darauffolgenden Gedichte zusammenfassen könnten. Abschied (S.28) und Allerseelen (S.32) samt den drei anschließenden Gedichten könnten hier als Beispiel dienen. In diesem Lyrikband sind interessante Wortkombinationen und poetische Neologismen zu finden, wie ‚angeliebt‘ (S.79) oder im Gedicht mit dem Titel Religion: „Hochgehofft, / niedergeglaubt, (…)“ (S.50). Auch die Phrase „(…) in einem Fragezeichen/ eingesteint –“ (S.34) beinhaltet eine Wortneuschöpfung, welche mit den Begriffen ‚in Stein gemeiselt‘ ‚eingebaut‘, und ‚eingemeiselt‘ spielt. Durch seine kurze, prägnante und dennoch berührende Sprache kann er in der Tradition der Liebes- und Lebensgedichte von Erich Fried gesehen werden. Gerade Folgendes ist sehr ähnlich: „Liebe/ ist kein/ ,,Dann und Wann‘‘/ ein wenig heute -/ ein wenig morgen -/ ein wenig irgendwann –“ (S.88). Auch das Gedicht auf Seite 55: „Nicht die Frage - /nicht die Antwort - / nur Du –“erweckt die Erinnerung an Frieds „Dich“. Liphart schafft es dabei, ähnlich Fried, in seinen lyrischen Aussagen die lesende Person beim Zeilenverweilen zum Nachdenken zu bringen. „Manches/ ist Klarheit -/ Wahrheit/ deshalb/ noch nicht –“ (S.44). Häufig sind seine kurzen epigrammartigen Analogien im Schema x ist y zu finden. „Blühen/ist/Göttlich-Sein/ohne/Mühen –“ (S.14). Dies bindet ein wenig die Flügel der lesenden Person, welche sooft von Liphart thematisiert werden, wie zum Beispiel auf Seite 95: „Die Fäuste/ der Nacht/ vermögen nichts/ gegen die Flügel/ der Träume -“. Mit seiner bildhaften Sprache kreiert der Autor ganze Bilder im inneren Auge der lesenden Person und entspinnt ganze Szenen wie in der folgenden Zeile: „In den Flügeln/ der Dämmerung/ wärmt sich/ die Sehnsucht –“ (S.18). Als LeserIn legt man sich selbst in diese lyrischen Flügel. Fast mit Wehmut sehnt man sich nach einem längeren Gedicht, aber wahrscheinlich macht gerade dies den Reiz dieser kurzen Entführung aus: das Mehr an Schweigen, das zum eigenen Träumen und Nachdenken anregt. Felix Mitterer setzt in seinen Stücken vielfach brennende Themen und brisante zeithistorische Stoffe für ein breites Theaterpublikum um. Er verfügt gewissermaßen über „den Riecher“ und bringt – nicht selten als erster – auf die Bühne, was in der Gesellschaft rumort. Dazu kommt, dass er ein gutes Gespür für interessante Charaktere, häufig reale Persönlichkeiten, hat. Beides trifft auch auf sein neues Bühnenstück – Der Boxer – zu.
Felix Mitterer setzt in seinen Stücken vielfach brennende Themen und brisante zeithistorische Stoffe für ein breites Theaterpublikum um. Er verfügt gewissermaßen über „den Riecher“ und bringt – nicht selten als erster – auf die Bühne, was in der Gesellschaft rumort. Dazu kommt, dass er ein gutes Gespür für interessante Charaktere, häufig reale Persönlichkeiten, hat. Beides trifft auch auf sein neues Bühnenstück – Der Boxer – zu.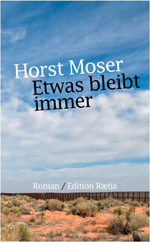 Etwas bleibt immer - und so soll es auch sein, wenn einer ein spannendes und zugleich kunstvoll konstruiertes Buch über die großen Themen der Menschheit, über Einsamkeit und Liebe, Gewalt, Erinnerung, Heimat und Fremdsein schreibt. Horst Mosers zweiter Roman hinterlässt auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck.
Etwas bleibt immer - und so soll es auch sein, wenn einer ein spannendes und zugleich kunstvoll konstruiertes Buch über die großen Themen der Menschheit, über Einsamkeit und Liebe, Gewalt, Erinnerung, Heimat und Fremdsein schreibt. Horst Mosers zweiter Roman hinterlässt auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck. Akonitin, ein aus dem wunderschönen Blauen Eisenhut gewonnenes Gift, hat es zu einigem literarischem Ruhm gebracht: in einer Oscar Wilde-Geschichte, aber vor allem in James Joyce's Ulysses, in dem der Vater des Protagonisten Leopold Bloom damit seinen Selbstmord bewerkstelligt. Fans und Aficionados des Kultautors, die schon mal eine vom literarisch intellektuellen Übervater getragene Krawatte aus einem Joyce-Museum pfladern, mag das inspirieren, Otto Bramböck, der hier wegen Mordes ermittelt, geht diesbezüglich spät, aber doch ein Licht auf. Bramböck ist ein Ermittler, “der seinen Job macht und gut darin ist”. Der Fall einer viel versprechenden jungen Underground-Sängerin, der irgendjemand - eben ein Joyce-Aficionado wie sich schließlich herausstellt - Akonitin ins obligate Wasserglas vor dem Gig mengt, ufert jedoch aus. Funktionieren konnte das Ganze, weil die Newcomerin vorher mit kleinen Pillen ein wenig zugedröhnt war - und auch das wusste der mörderische Giftler geschickt einzufädeln. Welche Rolle spielt Ron Razorblade, ein abgehalfteter Alt-Punk aus Portland, Oregon? Ausgerechnet in Wien startet er sein Come-back und stößt auf diese umwerfende Linda Steinberg. Wird hopsgenommen, aber wider besseres Wissen zu lange festgehalten. So läuft das nicht. Weil sich die internationale, zumal US-amerikanische Medienwelt und Anwaltschaft einschalten. Klage gegen den österreichischen Staat! Das Innenministerium wird nervös, Bramböck wird abgezogen, ermittelt aber auf eigene Faust weiter. Und behält recht.
Akonitin, ein aus dem wunderschönen Blauen Eisenhut gewonnenes Gift, hat es zu einigem literarischem Ruhm gebracht: in einer Oscar Wilde-Geschichte, aber vor allem in James Joyce's Ulysses, in dem der Vater des Protagonisten Leopold Bloom damit seinen Selbstmord bewerkstelligt. Fans und Aficionados des Kultautors, die schon mal eine vom literarisch intellektuellen Übervater getragene Krawatte aus einem Joyce-Museum pfladern, mag das inspirieren, Otto Bramböck, der hier wegen Mordes ermittelt, geht diesbezüglich spät, aber doch ein Licht auf. Bramböck ist ein Ermittler, “der seinen Job macht und gut darin ist”. Der Fall einer viel versprechenden jungen Underground-Sängerin, der irgendjemand - eben ein Joyce-Aficionado wie sich schließlich herausstellt - Akonitin ins obligate Wasserglas vor dem Gig mengt, ufert jedoch aus. Funktionieren konnte das Ganze, weil die Newcomerin vorher mit kleinen Pillen ein wenig zugedröhnt war - und auch das wusste der mörderische Giftler geschickt einzufädeln. Welche Rolle spielt Ron Razorblade, ein abgehalfteter Alt-Punk aus Portland, Oregon? Ausgerechnet in Wien startet er sein Come-back und stößt auf diese umwerfende Linda Steinberg. Wird hopsgenommen, aber wider besseres Wissen zu lange festgehalten. So läuft das nicht. Weil sich die internationale, zumal US-amerikanische Medienwelt und Anwaltschaft einschalten. Klage gegen den österreichischen Staat! Das Innenministerium wird nervös, Bramböck wird abgezogen, ermittelt aber auf eigene Faust weiter. Und behält recht. Mit seinem neuen, 2014 im Luxemburger Verlag Edition phi erschienenen Lyrikband lässt Thomas Schafferer wieder aufhorchen. Seine in Buchform geronnene Liebeserklärung an seine aus Luxemburg stammende Frau, der dieses Werk auch gewidmet ist, schafft poetisch Bemerkenswertes. In seinen 74 Gedichten gelingt es ihm nicht nur Luxemburg mit seinen Eigenheiten lyrisch einzufangen, sondern „nicht erst hier eine liebeserklärung an das// großherzlichkeitstum aus[zu]sprechen, als// zwei welten aufeinander prallen (…)“, wie er selbst im Gedicht ‚grand duchesse’ (S. 33) charakterisiert. Dieses Aufeinanderprallen von zwei Länderwelten wird in diesem Band zu einer ‘verschreibbarten‘ Annährung und Auseinandersetzung auch in der Beziehung zwischen lyrischem Du und Ich. Durch das Einarbeiten der anderen, der Luxemburger Sprache, welches einem Einverleiben gleicht, wird die Fremdheit immer mehr zur vertrauten Heimat.
Mit seinem neuen, 2014 im Luxemburger Verlag Edition phi erschienenen Lyrikband lässt Thomas Schafferer wieder aufhorchen. Seine in Buchform geronnene Liebeserklärung an seine aus Luxemburg stammende Frau, der dieses Werk auch gewidmet ist, schafft poetisch Bemerkenswertes. In seinen 74 Gedichten gelingt es ihm nicht nur Luxemburg mit seinen Eigenheiten lyrisch einzufangen, sondern „nicht erst hier eine liebeserklärung an das// großherzlichkeitstum aus[zu]sprechen, als// zwei welten aufeinander prallen (…)“, wie er selbst im Gedicht ‚grand duchesse’ (S. 33) charakterisiert. Dieses Aufeinanderprallen von zwei Länderwelten wird in diesem Band zu einer ‘verschreibbarten‘ Annährung und Auseinandersetzung auch in der Beziehung zwischen lyrischem Du und Ich. Durch das Einarbeiten der anderen, der Luxemburger Sprache, welches einem Einverleiben gleicht, wird die Fremdheit immer mehr zur vertrauten Heimat. 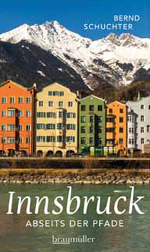 Dieser Stadtführer ist von einem Flaneur für Flaneure geschrieben: nomadisch und unabhängig, die Komplexität seines Gegenstands, seine Schichten und Fragmente literarisch erfassend. Der Innsbrucker Mikrokosmos erzählt hier eine sehr persönliche Universalegeschichte ebenso wie sehr persönliche regionale Geschichten. Alles, was man über die 104,9 qkm Stadtgebiet wissen und in ihm unternehmen soll, findet sich in sechs gemütlichen Viertel-Spaziergängen verhandelt. Sie heißen, ganz konventionell, “Zwischen Judenbühel und Scheibenbühel”, aber auch ganz unkonventionell etwa “Innsbruck und die Migration”. Alles ist unaufdringlich, Tipps, “Orte zum Verweilen”, Literatisches und Sachen “zum Nachkochen” werden zum textlichen Hauptgang nachgereicht. Besonders hübsch ist die Gestaltung des broschierten Bandes mit S/W-Fotos von Peter Gründhammer bzw.
Dieser Stadtführer ist von einem Flaneur für Flaneure geschrieben: nomadisch und unabhängig, die Komplexität seines Gegenstands, seine Schichten und Fragmente literarisch erfassend. Der Innsbrucker Mikrokosmos erzählt hier eine sehr persönliche Universalegeschichte ebenso wie sehr persönliche regionale Geschichten. Alles, was man über die 104,9 qkm Stadtgebiet wissen und in ihm unternehmen soll, findet sich in sechs gemütlichen Viertel-Spaziergängen verhandelt. Sie heißen, ganz konventionell, “Zwischen Judenbühel und Scheibenbühel”, aber auch ganz unkonventionell etwa “Innsbruck und die Migration”. Alles ist unaufdringlich, Tipps, “Orte zum Verweilen”, Literatisches und Sachen “zum Nachkochen” werden zum textlichen Hauptgang nachgereicht. Besonders hübsch ist die Gestaltung des broschierten Bandes mit S/W-Fotos von Peter Gründhammer bzw.  Mit dieser Novelle legt die frisch gekürte EU-Preisträgerin Carolina Schutti eine außerordentliche Arbeit vor: die Geschichte eines Kindes. In „Eulen fliegen lautlos“ nimmt der Leser die Welt eines etwa 6-jährigen Buben aus dessen Perspektive wahr. Die Sprache, der Stil, die kunstvolle Verschränkung von seinen Wahrnehmungen, Sprachfetzen, elterlichen Aufforderungen, ritualisierten Handlungen, die zum Teil wortwörtlich, stereotyp, formelhaft wiederholt werden, erlauben einen Blick in das Innensein, ohne es zu entblößen oder gar bloßzustellen.
Mit dieser Novelle legt die frisch gekürte EU-Preisträgerin Carolina Schutti eine außerordentliche Arbeit vor: die Geschichte eines Kindes. In „Eulen fliegen lautlos“ nimmt der Leser die Welt eines etwa 6-jährigen Buben aus dessen Perspektive wahr. Die Sprache, der Stil, die kunstvolle Verschränkung von seinen Wahrnehmungen, Sprachfetzen, elterlichen Aufforderungen, ritualisierten Handlungen, die zum Teil wortwörtlich, stereotyp, formelhaft wiederholt werden, erlauben einen Blick in das Innensein, ohne es zu entblößen oder gar bloßzustellen.