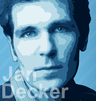weitere Infos zum Beitrag
Essay
anything goes
Wahrscheinlich wären sie bessere Ermittler, wenn man sie nicht so perfekt ausleuchten würde. Ein unterproduzierter Tatort, ein Tatort von Quentin Tarantino oder Lars von Trier, denke ich, das wäre schön. Nicht ohne Grund hat Lars von Trier seine Wagner-Produktion bei den Bayreuther Festspielen abgesagt. Er dreht wie Quentin Tarantino neuerdings am liebsten in Deutschland, das als Land der Mittelmäßigkeit zu erfrischenden Unterproduktionen einlädt, wenn man nur auf die Kulisse schaut. Sicherlich kompensiere ich mit diesen Gedanken das gescheiterte Abhören meines Hörspiels über Brian Wilson, mein Kollaborateur wartet schließlich gespannt auf den Anruf zur Freigabe der Produktion.
Aber ist es nicht verlockend, im gleichen Atemzug die Kultur zu retten? Ich möchte nicht noch einmal in die Falle der Überproduktion tappen. Kein knisterndes Windspiel am Anfang eines Hörspiels. Und als Botschaft an alle Kulturschaffenden geht raus: Wir produzieren unter, Baby! Einer dringt in das Büro des ARD-Fernsehdirektors ein, und hackt mit der Machete eines brasilianischen Ureinwohners das Tatort-Konzeptpapier klein, auf dem steht: Tatort ist das Flaggschiff der deutschsprachigen Fernsehunterhaltung. Mit einem schwarzen Edding setzt er unser Zeichen darunter: Aktenzeichen XY. Ein anderer verhindert das Aufhängen des Amazonas-Riesen-Rundbilds im Amazonas. Damit, werde ich meinem Kollaborateur sagen, ist viel erreicht.
Der Talkmaster Beckmann hat eine brisante Runde eingeladen. Andreas Huckele erzählt von den Missbrauchsfällen an der Odenwaldschule, Pola Kinski bekräftigt die Missbrauchsvorwürfe gegen ihren Vater, Ursula Enders berichtet von ihrer Arbeit in der Beratungsstelle Zartbitter. Die taz schreibt danach: „Das alles ist von einer Ungeheuerlichkeit, die kaum erahnbar ist, wenn sie einem in dieser geschmeidigen Dramaturgie vorgetragen wird.“ Als Beckmann Pola Kinski am Ende der Talkshow fragt, ob es ihr nun schon besser gehe, als könne ein perfekt ausgeleuchtetes Fernsehstudio über Missbrauch hinwegtrösten, antwortet sie: „Als Opfer von Missbrauch hat man lebenslänglich.“ Die Dramaturgie der Überproduktion, ergänze ich, gleicht dem Öffnen einer Prosecco-Flasche. Erst knallt es laut, dann perlt es fein, und später ist die Flasche leer. Oh weh, da muss die nächste Flasche her!
Wer ist die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird? Ich habe unser Hörspiel über Brian Wilson abgenommen. Ja, ich habe meinem Kollaborateur mitgeteilt, dass wir keinen Strich ändern werden. Die Produktion ist fertig. Alles andere wären weiße Mäuse. Ein knisterndes Windspiel am Anfang. Na und? Mensch gegen Technik, sage ich meinem Kollaborateur, darum geht es heute. Was drückt diesen Zweikampf besser aus als ein knisterndes Windspiel? Seinen Einwand, dass das Windspiel nicht knistern, sondern perlen würde, nehme ich gar nicht zur Kenntnis. Der Kunstgenuss, sage ich ihm, lässt sich eben nicht bis ins letzte Detail steuern. Du lässt dir doch auch nicht vom Wasser-Sommelier erzählen, welches Wasser du trinken sollst. Stille am anderen Ende der Leitung.
Ich bleibe dabei. Die menschliche Komponente ist sexy. Das ist mein Hauptargument gegen die Überproduktion. Der Umstand, das wir vieles besser wissen als die Experten, zum Beispiel, dass ein Amazonas-Riesen-Rundbild im Amazonas Quatsch ist. Und dass wir am Feierabend nicht überwältigt werden wollen, sondern uns erholen wollen. Rede ich von weißen Mäusen? Natürlich sind das Luxusfragen, außerdem sind die Geschmäcker verschieden. Und natürlich hätte das Abhören unseres Hörspiels über Brian Wilson glatter laufen können. Jetzt habe ich ihn, den Prachtkarpfen, den ich gegen schizoide Tatort-Ermittler und perfekt ausgeleuchtete Talkmaster in die Kamera halte. Eine Fernsehsendung, die nicht unter- oder über-, sondern schlichtweg auf den Punkt produziert ist. Aktenzeichen XY.
Eduard Zimmermann, der Kriminalexperte und Fernseh-Gute, ist mein erster Gewährsmann gegen den Inszenierungswahn. Ständig werden Formate überarbeitet oder ganz ausgelöscht. Nur dieser Dinosaurier unter den Fernsehformaten bleibt. Wahrlich ein Prachtkarpfen, seit 1967 auf Sendung. Echte Kommissare im Aufnahmestudio. Unterspielt nachgespielte echte Kriminalfälle. Ich liebe vor allem die Dialoge vor den Verbrechen, jene Minuten der nachgespielten Kriminalfälle also, da die Welt noch in Ordnung ist. Mutter: Wird es wieder spät, Yvonne? Tochter: Ach Mama, du weißt doch, Achim feiert seinen 18. Geburtstag. Mutter: Aber wenn es spät wird, kommst du bitte mit dem Taxi. Hörst du, Yvonne? Tochter: Ja, Mama.
Und erst die Telefonisten im Studio-Hintergrund, die während der Sendung, gedämpft hörbar, die Zuschauerhinweise entgegennehmen. Sie sind die Brechtsche Rückleitung, die Möglichkeit der Empfänger, die Sendung mitzugestalten. Eduard Zimmermann ist Avantgarde. Das Aktenzeichen XY-Studio ist einmal eingerichtet, rums!, und wird dann über Jahrzehnte benutzt. Man sieht das Studio in der klugen wie überschaubaren Halbtotalen, die Kamera kriecht nicht anheischend an die Akteure heran. Wie viel sexyier ist das als die Sorgenfalte der Tatort-Kommissarin in Großaufnahme! Man beachte den verdächtigen Hang der Überproduktion zum Unfertigen: Die Protagonisten treten ihren Dienst auf halben Baustellen oder inmitten von Umzugskartons an. Formal geschieht etwas: Möbel werden herumgewuchtet. Aber ich möchte lieber wissen, ob Yvonne nach Achims Party mit dem Taxi nach Hause gefahren ist.
Aktenzeichen XY erscheint mir heute als der Prachtkarpfen unter den weißen Mäusen, als ein erbauliches Sammelsurium Brechtscher Verfremdung. Nicht nur, dass Rudi Cerne, der die Sendung seit 2002 moderiert, den Versprecher als bewusste Kunstform erfunden hat. Die nachgespielten Kriminalfälle kommen schnell zur Sache, sie bauschen nichts auf. Kaum ist das Verbrechen geschehen, geht der Moderator dazwischen und lädt den ermittelnden Kommissar neben sich an das Pult. Man redet über den Fall, der sich nun von der Fiktion in einen wirklichen Kriminalfall verwandelt. Anschließend tritt der ermittelnde Kommissar, für alle sichtbar, ab, während im Hintergrund die Brechtschen Rückleitungen heiß laufen.
Die Erfolge des Formats liegen auf der Hand: 40 Prozent der ausgestrahlten Fälle von Aktenzeichen XY werden mit Hilfe der Zuschauer aufgeklärt. Illustre Schauspieler wie Otto Sander und Kai Wiesinger genossen es, ihr Licht einmal nicht unter den Scheffel der Überproduktion stellen zu müssen. Wenn ein anderer Schauspieler, wie im April 2012 geschehen, nach der Sendung von der Stuttgarter Polizei verhaftet wird, weil man ihn für einen gesuchten Verbrecher hielt, ist der Erfolg der Fiktion überbeglaubigt. Aktenzeichen XY vermittelt starke Inhalte, schließlich war Eduard Zimmermann einst selbst Opfer eines Betrügers geworden und schöpfte daraus die Motivation für das Format. Dass er die Explosion einer Deckenlampe in der Sendung vom 20. Oktober 1972 zunächst als ein Attentat auf ihn interpretierte, zeigt, dass es bei dieser Produktion wirklich um etwas geht. Die besten Geschichten schreibt eben das Leben selbst, allem Knistern, Rauschen, Ausleuchten und Schminken zum Trotz.
Unterdessen erreicht mich eine Schlagzeile der Bild-Zeitung: „Wer produziert, ist attraktiv. Das zeigt eine Umfrage. Mit Mitarbeitern welcher Abteilung würden Sie am ehesten eine Beziehung eingehen?“ Die Top drei: 1. Produktion. 2. Vertrieb. 3. Personalwesen. Man muss sich nur zu produzieren wissen. Die Fotografin Friede Janssen zeigt auf T-Online unter der Überschrift Kalkulierte Provokation Hochglanz-Fotos von rauchenden Kindern in Star-Posen. Mir wird schlecht, aber das ist gewollt. Müssen wir jetzt eine Debatte über rauchende Kinder führen? Oder über die Aufwertung der Abteilung Personalwesen? Die Fotografin selbst gibt das übliche Urteil der Überproduzenten ab: Sie sei weder für noch gegen ein Rauchverbot. Diese Antwort ist unsexy, sage ich meinem Kollaborateur beim nächsten Gespräch, ich will mehr als den Eyecatcher, mehr als das klimpernde Windspiel am Anfang eines Hörspiels. Er ist beleidigt, nennt mich gleichmacherisch.
Dabei möchte ich nur sagen: Bitte keine Produktion für alle! Denn sonst stehen auf der einen Seite die Produzenten, die niemals Feierabend machen und doch alle Frauen abbekommen, und auf der anderen Seite das konsumierende Volk. Bitte keine Trennung von Experten und Unwissenden! Streng genommen, und hier führe ich meinen zweiten Gewährsmann an, den Philosophen Paul Feyerabend, gibt es keinen Unterschied zwischen Wissenschaft und Mythos. Ich kann sehr wohl ohne Experten für bewusstes Gehen gehen, ohne den Wasser-Sommelier Wasser trinken, Hörspiele produzieren, die nicht überproduziert sind. Lassen wir die Kirche im Dorf, das Amazonas-Riesen-Rundbild in Leipzig. Wenn mich die Experten mit ihrer Expertise jagen, greife ich zu Paul Feyerabend, und die Welt verrückt wieder ein Stückchen und ist in Ordnung.
Paul Feyerabends Gedanken sind der Katechismus für den bewussten Produzenten als Genießer, der sich nicht vorschreiben lässt, was er genießen will. Weitsichtig unterschied Feyerabend Wissenschaftler und Künstler von Stars, die für Unterhaltung sorgen. Produzieren heißt, den Widerspruch leben. Nichts anderes tat Paul Feyerabend, der selbst ein Star seiner Zunft war, das Telefon aber grundsätzlich nicht abnahm. Für Planungen war er überhaupt unbrauchbar. Vorträge sagte er kurzfristig ab. Die Einladung zu einem Essen lehnte er mit dem Hinweis ab, er esse nur, wenn er hungrig sei, und wann das sei, wisse er nie im Voraus. Die wahren Produzenten sind Schöpfer, sie dürfen schöpferisch leben. Wo wäre der eigensinnige Paul Feyerabend heute? Hoffentlich nicht bei Sokrates und einer Flasche Rotwein unter der Brücke!
Intellectual flatulence. Das kommt nach Paul Feyerabend in überproduzierten Zeiten heraus, wenn die Kriterien gegenüber den Effekten verblassen, wenn quotenfröhliche Wissenschaft getrieben wird, aber nichts mehr kritisch untersucht. Einst wurde Paul Feyerabend, der theaterbegeistert war, eine Dramaturgenstelle bei Bertolt Brecht angeboten. Tatsächlich, die Intellectual flatulence findet ihre Brechtsche Entsprechung in dessen Bild vom sich ewig drehenden Karussell der bürgerlichen Dramatik. Wie viele Morde sind im Tatort schon geschehen? Da das Grundmuster des Tatort-Katechismus feststeht, bleibt nur das Aufpeppen des Formats mit Produktionsmitteln. Ein Schnitt mehr, eine Kameraeinstellung mehr, ein Überspielen des Kommissars mehr.
Dazu fügt sich Paul Feyerabends Kritik am Abstrakt-Allgemeinen. Schwedische Krimis sind unwiderstehlich! Keine Ahnung, aber der letzte schwedische Krimi hat mir gefallen. Quentin Tarantino ist der beste Filmemacher seit Jahrzehnten! Schwer zu beurteilen, aber sein letzter Film war doof. Ich kann nur anhand eines Einzelfalls sagen, was mir gefallen hat. Doch seit kurzem herrscht ein hymnischer Anpreisungston, der leere Abstraktionen über unsere Köpfe hinwegfegt! Die Überproduktion ist eben teuer, ihre Kosten müssen amortisiert werden. Dabei wird das Rad selten neu erfunden, und viel öfter die Haut zu Markte getragen.
Schließlich wies Feyerabend darauf hin, dass die großen Theorien der Gegenwart bereits im 19. Jahrhundert geboren wurden, nur eben als Aperçus, Tagebucheinträge, Fragmente. Stattdessen muss es heute schon das Standardwerk sein: Bewusstes Gehen, fünf Bände. Der Wasser-Sommelier, 912 Seiten mit Anhang. Wir brauchen das Standardwerk oft nicht, es ist die weiße Maus, die niemand vermisst. Im Alltag wenden wir nach Feyerabend ständig Wissen an, ohne dessen Gründe zu kennen. Wir sind Meister des Ermittelns, und dabei meistens charismatischer als die TV-Ermittler. Man denke an das Fahrradfahren auf vereisten Radwegen, oder an das Öffnen einer Bierflasche ohne Flaschenöffner.