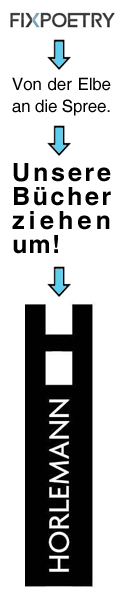weitere Infos zum Beitrag
Reihe Naturkunden
Berge um 1900. John Muir. »Die Berge Kaliforniens«. übersetzt und kommentiert mit einem Essay von Jürgen Brôcan.
04.08.2013 | Hamburg
Der Einband leuchtet türkisfarben. Leinen liegt über einem flexiblen Material, wahrscheinlich Pappe. Diese Kombination verleiht dem Buch seine einzigartige Haptik. Die Prägeschrift auf der Vorderseite des Einbandes ist schwarz und orange, im selben Orange der obere Schnitt. Ein Buch, das gut in den Händen liegt. Sein Titel:
John Muir. Die Berge Kaliforniens.
übersetzt und kommentiert mit einem Essay von Jürgen Brôcan.
Blättert man ins Buch hinein, trifft man auf Photographien von Eadweard Muybridge. Portraitaufnahmen und Landschaftsfotografie noch ganz von der Euphorie des erwachenden neuen Mediums geprägt. Theatralische Inszenierungen der Welt. Natürlich in jenem Braunstich, der zum Orange der Schrift und des Schnittes passt und der den Betrachter auf eine Zeitreise schickt, an die vorletzte Jahrhundertwende. Und man sieht einen Photographen mit einer schweren Plattenkamera an steilen Berghängen entlang stapfen. Die ganze Mühe die ein Bild verlangt ist in diesen Bildern zu finden, auch die technische Anstrengung.
Das Orange des Titels findet sich wieder als Farbe, in der die Schlagworte der Anmerkungen gesetzt sind und da ich ein Freund von Anmerkungen bin, und diese immer zuerst, fast unabhängig vom Fließtext lese, fiel mir dir Sorgfalt sofort auf, mit der sie gestaltet und ausgeführt sind. Dieses Leseverhalten übrigens verhindert zuweilen den Zwang des Hin- und Her Blätterns. Aber auch für sich haben die Anmerkungen in diesem Buch eine Qualität. Zum Beispiel diese:
Eichelspecht: Im Original „crimson crested woodcock“. Da die Waldschnepfe (woodcock) weder eine rote Haube hat noch Löcher bohrt und der Schwarzkehlspecht (crimson crested woodpecker) nur in Mittel und Südamerika heimisch ist, handelt es sich vermutlich um ein Wortspiel, im etwa „der Hahn des Waldes mit dem hochroten Kamm“. Gemein ist wohl der vor allem in Kalifornien beheimatete acorn woodpecker.
Allein die Anmerkungen steigerten meine Leselust erheblich.
Die Naturkunden sind eine wundervolle Reihe des Verlags Matthes und Seitz, die von Judith Schalansky herausgegeben wird und die mit der Einzigartigkeit des haptischen, optischen und intellektuellen Reizes angesichts eines Buches spielt. In dieser Reihe ist auch der Band erschienen, um den es hier im Weiteren gehen soll. Da ich zum Glück kein Sammler bin und Bücher als, wenn auch virtuelle aber dennoch essentielle Erweiterung meines Aktionsradius begreife, musste ich aus den Angeboten der Reihe wählen. (Ein Sammler hätte wohl mit Recht alle bestellt). Ich wählte eben gerade dieses Buch, weil mir Brôcan als Lyriker, Übersetzer und Essayist bereits ein Begriff war und ich seine Arbeit sehr schätze. Von Muir hatte ich indes noch nie etwas gehört oder gelesen. Der Weg ins Abenteuer beginnt an einer vertrauten Bahnstation.

Die Reihe Naturkunden bei Matthes und Seitz
Allerdings ist mein Abenteuer als Leser wesentlich anders geartet als das des Autors. Ich sitze, wenn man so will, im Trockenen. Aus Brôcans Essay erfahre ich, dass Muir 1838 in Schottland als Sohn eines religiösen Fanatikers geboren wurde, der seine Kinder eher mit Schlägen als mit Worten erzog. Nachdem er mit seiner Familie nach Amerika ausgewandert war, gab dieser Vater Land und Familie auf, um sich als Wanderprediger ganz seinem religiösen Wahn hinzugeben. Die Natur war dem Sohn immer ein Fluchtpunkt vor Schlägen und Predigt gewesen. Der Kindheit schloss sich eine jugendliche Odyssee an, die von Brôcan wunderbar beschrieben, eben irgendwann nach Kalifornien führt. Zu erwähnen wäre noch eine Augenverletzung, die Muir zeitweilig erblinden ließ.
Das Buch aber nimmt den Leser vom ersten Augenblick an hinein in die Kalifornische Landschaft, als hätte Gott die Berge aufgerichtet um den herum, der sie betrachtet. Und so auch der erste Satz:
Wohin man sich in den grenzen Kaliforniens wendet, stets sind Berge in Sichtweite, die eine jede Landschaft verzaubern und erstrahlen lassen.
Der Text des Buches reduziert sich jedoch nicht auf Bewunderung und Anbetung der Schöpfung, dann wäre er nur eine Spielform des väterlichen religiösen Wahns, sondern er schildert in einem ungeheuren, fast beängstigendem Detailreichtum die Landschaft und ihre Pflanzen und Tiere, immer wieder durchbrochen von Naturhistorischen Erläuterungen und Philosophischen Reflexionen, die sich aber nie allzu weit vom Ausgangspunkt entfernen. Wissen trifft in diesem Text auf Wissen, das eine, das tradierte, in lateinischen Pflanzennamen sichtbare auf das frische Erfahrungswissen, das aus dem eben erst Geschauten resultiert, und sie vereinigen sich mit dem kulturellen Wissen des Übersetzers und Herausgebers.
Der Text ist aber auch ein Text des neunzehnten Jahrhunderts, als die Technik, die Reisen möglich machte auch ihr zerstörerisches Potential entfaltete. Und wie für die Natur, hatte Muir auch für die Technik einen scharfen Sinn entwickelt, erfahren wir von Brôcan. Wie es scheint gehört es zur Dialektik der Beziehung, dass dem Menschen im Moment, da er antritt, sie zu vernichten, sich die Augen sich für Schönheit der Natur erst öffnen. Andererseits setzte der Fortschritt der Zerstörung die Naturkenntnis in bestimmten Maß voraus. Auch Darwins Schriften entstehen in dieser Zeit. Wie Muirs Buch sowohl intellektueller als auch ästhetischer Genuss, der von der Wissenschaftsprosa lange nicht mehr eingeholt wird. Und Nobel erfindet gleichzeitig das Dynamit und einen Preis.
Angesichts der Gletscherwiesen versagt es Muir für einen Moment lang die Sprache. Eine Passage, die im Kapitel VII zu finden ist:
Das einflussreichste der Gräser, aus denen die Narbe besteht ist ein zierliches Reitgras mit fadenförmigen Blättern und lockeren luftigen Rispen, die über die Blumenwiese wie ein violetter Nebel zu schweben scheinen. Doch was ich auch schreibe, ich kann keine adäquate Vorstellung von der vortrefflichen Schönheit dieser Gebirgsteppiche geben, die flach ausgebreitet in der rauhen Wildnis liegen. Welche Worte wären hinreichend, um sie abzubilden? Womit sollen wir sie vergleichen?
Diese Betrachtung, diese Überlegung führt uns geradewegs an die Schnittstelle von Wissenschaft und Kunst, an den Punkt, an dem der Essay überhaupt arbeitet. Letztlich steht die Frage, wie wir sprechen oder schreiben sollen, wenn uns das Vokabular versagt, wenn das Geschaute oder Erkannte, die sprachlichen Möglichkeiten übersteigt. Das ist wohl der Moment, die Metaphern zu öffnen, den Vergleich zu erweitern, und letztlich macht es Muir ja so auch, den Gegenstand nicht zu be- sondern zu umschreiben, das heißt die Sprache so lang um ihn herum zu schicken, bis sie ein Bild gestrickt hat, das dem Geschauten und Gemeinten nahe ist.
Übrigens eröffnet mir dieser Text von Muir auch eine Tradition, die Tradition des Nature Writing in der auch Gary Snyder steht, dessen Buch Lektionen der Wildnis mich tief beeindruckt hat und das ich an dieser Stelle vor einiger Zeit besprochen habe.
John Muir: Die Berge Kaliforniens [The Mountains of California] Mit zahlreichen Fotografien in Duoton von Eadweard Muybridge, Oktav-Format 352 Seiten, flexibler Einband, fadengeheftet, mit farbigem Kopfschnitt und Lesebändchen. Aus dem amerikanischen Englisch sowie mit einem Nachwort von Jürgen Brôcan. ISBN: 978-3-88221-050-7 Preis: 34,00 € Matthes & Seitz Berlin 2013
Jan Kuhlbrodt hat zuletzt über »Kein Schweigen bleibt ungehört«. Gedichte von Horst Samson auf Fixpoetry geschrieben.
Anm. der Redaktion:
Aus der Reihe Naturkunden haben wir Ihnen bereits folgende Bücher vorgestellt:
»Krähen« herausgegeben von Cord Riechelmann und Judith Schalansky, besprochen von Martin A. Hainz
»Die Entdeckung der Natur« von Jürgen Goldstein, vorgestellt von Elke Engelhardt.
© Fixpoetry.com 2013
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung von Fixpoetry.com
Sie können diesen Beitrag gerne verlinken