Ende Juli, kurz vor Abgabe des neuen, mich extrem fordernden, anstrengenden Buchs ›Die siebte Woge‹: ein psychosomatisches Sperrfeuer, mit Verkrampfungen vor allem im Gürtelbereich, die selbst das Drehen im Bett, das Aufstehen zum schmerzhaften Problem machten. Einige Nächte habe ich im Liegestuhl verbracht, da war das Aufrichten, Aufstehen ohne Wenden und Winden möglich. Der Spuk löste sich von selbst auf, nach einigen Tagen, dann aber das bald sichere Gefühl: Es hat mein Herz lädiert. Bei Stress, bei beschleunigter Bewegung: Atemnot. Und so kam es im Münchner Bahnhof zu sekundenkurzem Kollaps. Positive Erfahrung: die spontane Hilfsbereitschaft von Mitmenschen. Ein schwerer Anfall von Atemnot sodann, als ich mit Freunden zu einem der Brühler Schlosskonzerte gehen wollte: blieb stehen, rang nach Luft, das Auto musste geholt werden. Zuweilen, nachts, recht unregelmäßig die Herzschläge: »Rumpeln im Karton ...«. Bereits in Bayern hatte drastische Abmagerung eingesetzt – und viel hatte ich als bewegungshungriger Mensch nie zusetzen können. Alle Symptome schienen, gleichsam konzentrisch, hinzuweisen auf Herzinsuffizienz. Das ließ sich auch rückschließen aus Homepages, aus Printmedien von Herzkliniken. Die (Selbst)Diagnose schien schlüssig, schien stimmig.
Ich ließ mich, nach der Rückkehr vom Chiemsee, im Herzzentrum der Uniklinik Köln untersuchen. Mein angeborener »Herzfehler«, von jedem der bisher abhörenden Ärzte sofort registriert, erhielt nun eine genaue Bezeichnung: Aortenklappenstenose. Das heißt: die Durchflussöffnung des aufgefrischten Blutes ist zu gering, es bildet sich mit jedem Herzschlag ein gewisser Rückstau. Mehr- und Schwerarbeit für die Pumpe. Und nun, so befürchtete ich, eine schadenstiftende Rückwirkung vor allem auf den Herzmuskel? Meine Schritte wurden kleiner, mein Bewegungsspielraum schrumpfte. Sobald sich das Herz bemerkbar machte, sich betonte, deutlicher umriss, reduzierte ich Aktivitäten. Und es empfahl sich nach diversen Untersuchungen, in Köln vom Chefarzt nahegelegt, die Implantation einer neuen, »biologischen« Herzklappe. Nebenbei angekündigt wurde die (konventionelle) Öffnung des Brustkorbs – Besprechung bei gleichsam wehendem Weißkittel des jungen Chefarztes, es war noch nicht einmal Zeit, sich hinzusetzen, die Tür zum Flur blieb offen. Das alles missfiel mir, und so hörte ich auf Empfehlungen, die zur Herzklinik im Schwarzwald führten, nach Lahr: In Veröffentlichungen des Hauses werden verfeinerte, schonend invasive Methoden erörtert. Auch bei der Lektüre von Papieren aus Lahr: meine Selbstdiagnose schien sich Punkt für Punkt zu bestätigen. Selbst der extreme Verlust von zehn, zwölf, fünfzehn Kilo Gewicht, der simultane Verlust an Kraft als mögliche, akut radikalisierte Folge einer notorischen Herzinsuffizienz.
Erneute Untersuchungen im Herzzentrum Lahr. Und es wurde bestätigt, was im Kölner Arztbericht fachterminologisch verklausuliert, damit interpretationsbedürftig war: Dass mein Herz noch keine erkennbaren Schäden davongetragen hat; keine Verdickung des Herzmuskels, erst recht keine Entzündung, als Problem nur die eine der vier Herzklappen: die ständige Zusatzleistung kann auf weitere Dauer den Herzmuskel schädigen.
Der junge Arzt, der die Ultraschalluntersuchung des Herzens durchgeführt hatte, setzte sich an seinen Schreibtisch, zeichnete auf. Ich blieb noch auf der Liege. Mit dem Ersatz der Herzklappe, so höre ich nun oder höre ich heraus, eilt es bei der Gesamtverfassung des Organs letztlich nicht so sehr. Eine als subjektiv, als unverbindlich bezeichnete Anmerkung – die Entscheidung des Führungsteams steht schließlich noch aus. Dennoch meine Frage: Woher dann aber dieser dramatische Verlust an Körpersubstanz? Diese dürren Arme, dünnen Beine? An meiner Stelle würde er vorrangig klären, woher die erhöhten Blutwerte (LDH und PSA) kommen: »Etwas zehrt in Ihnen.« Ich, noch auf der Liege, auf dem ausgerollten Papier: »Meinen Sie: Krebs?« Und wieder ein kurzes Zögern, dann, das Wort nur andeutend wiederholend: Erst einmal klären, woher die beiden stark erhöhten, nun ausgedruckt vorliegenden Blutwerte kommen.
Also sagte ich die avisierte Herzkatheter-Untersuchung ab, die als Vorleistung für die OP gilt. Schon waren die Handgelenke rasiert, die Beugen rechts und links vom Geschlecht, dies auch noch unter der Androhung, vor der Operation werde eine Ganzkörperrasur durchgeführt. Da sähe ich ja aus wie ein gerupftes Huhn! Keine Reaktion, man hält es so in Lahr.
Doch siehe da, es tauchte der zweite, dafür zuständige Chefarzt am Kantinentisch des Krankenhauses auf, setzte sich zu uns, erklärte klipp und klar, er würde in meiner Situation genauso handeln: Aufschub der OP. Kam hinzu das Engagement eines jungen, palästinensischen Stationsarztes, der mir sofort einen Termin beim Chef des Hauses vermittelte. Und da war rasch und klar abgesprochen: OP-Termin wird in Anbetracht der neuen Werte und Erkenntnisse erst mal gestrichen. Gute Heimreise! Das überwiegend osteuropäische, vor allem rumänische Stationspersonal war nach unseren Plaudereien beinah traurig.
Nun bin ich also wieder in Brühl, es ist Ende Oktober. Erleichterung erst einmal, weil ich nicht als Behandlungsobjekt in der Intensivstation liege. Psychosomatisch interessant: Seitdem nicht mehr die geballte Aufmerksamkeit auf das Herz gerichtet ist, spüre ich es kaum noch, es hat sich gleichsam integriert – keine Arhythmien mehr, es setzt, gleichsam verstummt, seine jahrzehntelange Tätigkeit unauffällig fort. Was mir als schlüssige (Selbst)Diagnose erschienen war, es hat sich aufgelöst, verflüchtigt wie ein Spuk. Neue Erkenntnisse über mich selbst, reichlich spät. Ich habe psychosomatische Wechselwirkungen unterschätzt, der Schwerpunkt hat sich verlagert. Ich muss, beschwerten Gemütes, erneut nach der zehrenden Ursache des rapiden Verlustes von Körpergewicht und Körperkraft suchen lassen. So rasch wie möglich. Vor meinem Achtzigsten muss Klarheit herrschen!
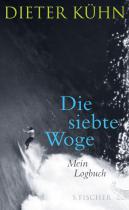
Nach seiner Autobiographie ›Das Magische Auge‹ legt Dieter Kühn den zweiten Teil seines Lebensbuchs vor – ein »Logbuch« aus Werkstattberichten, dokumentierten Gesprächen und Erinnerungen als Selbstporträt eines Schriftstellers. Dabei steht jedoch nicht das Entstehen der eigenen Bücher im Vordergrund, sondern lebensbegleitende Schreibprojekte, die bisher noch nicht in Buchform realisiert wurden: »Projekte, bei deren Entwicklung ich spezifische Erfahrungen machte, dies zuweilen grenzwertig.« Sieben solcher Projekte sind es – darunter die literarische Übertragung von einer Sprache in die andere und der Versuch einer Verschmelzung von Literatur und Naturwissenschaft –, die wie riesenhafte Wogen den Autor unter sich zu begraben drohen.






 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /