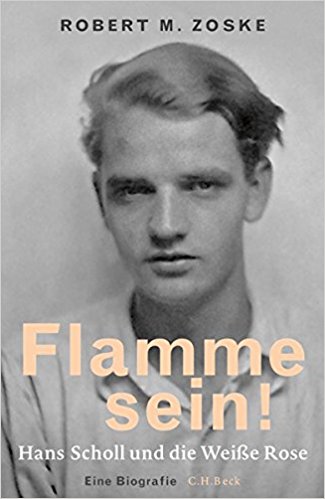Alles für den Plot
In Agatha Christies Kriminalroman „Das krumme Haus“ trifft unterhaltsame Spannung auf zweifelhafte Psychologie
Von Rebekka Sons
Das „pure Vergnügen“ sei es gewesen, Das krumme Haus (The Crooked House) zu schreiben, erklärt die Queen of Crime in ihrem Vorwort. Ob der Leser, so fragt sie weiter, dem Buch anmerken könne, welche Freude das Schreiben bereitet habe? Tatsächlich macht die Lektüre von Agatha Christies 39. Kriminalroman erstaunlichen Spaß. Erstaunlich deshalb, weil einem die Bewohner des krummen Hauses schlichtweg unsympathisch sind. Zudem sind sie alle tatverdächtig. Das Haus selbst scheint düster, auch bedingt durch das Foto auf dem Buchcover, wo es wolkenverhangen im Hintergrund droht, und dennoch umfängt es den Leser mit einem eigentümlichen Charme.
Dieser Charme muss es auch gewesen sein, der zu der vorliegenden Neuübersetzung des zuerst 1949 erschienenen Klassikers führte. Zwar hätte eine genauere Durchsicht der Neuauflage wohl einige orthografische Unstimmigkeiten ausgemerzt, dennoch wird man von der Übersetzung (verantwortet vom erfahrenen Duo Giovanni und Ditte Bandini) elegant in die englische Nachkriegszeit geleitet. Auch eine Verfilmung steht der Neuausgabe zur Seite. So ziert das Buchcover den Cast von Gilles Paquet-Brenners Romanadaption, die 2017 anlief. Nicht nur scheinen die Figuren darauf wesentlich imposanter als im Buch, auch oben erwähntes wolkenverhangene Anwesen weist darauf hin, dass Paquet-Brenner Christies vergnügliche Vorlage deutlich dramatischer und dunkler gestaltete.
Das titelgebende krumme Haus aber wird erst nach einigen Kapiteln Schauplatz und eigener Kosmos der Geschichte. Zu Beginn mutet der Krimi recht romantisch und international an. Sophia Leonides und Charles Hayward, zwei junge Menschen, die beide für das englische Außenministerium arbeiten, lernen sich in Ägypten kennen und verlieben sich. Doch ihrer Liebe stehen die Wirren des Krieges und die politische Komplexität ihrer Arbeit für das Königreich entgegen. Erst zwei Jahre später ist ein Wiedersehen in England möglich. Wer hier auch weiterhin eine Handlung erwartet, die von Diplomatie, nationaler Verantwortung und der großen Liebe erzählt, wird enttäuscht. Denn zurück in England stirbt Sophias Großvaters Aristide Leonides, und damit werden alle möglichen Handlungsstränge und Schauplätze in genau einem Ort kondensiert: dem krummen Haus.
Hier lebte und waltete besagter Aristide Leonides, ein eingewanderter Grieche, der es in England durch die Fähigkeit, jede erdenkliche Gesetzeslücke zu seinen Gunsten zu durchschlüpfen, zu großem Reichtum brachte. Nun jedoch wurde er mit einer Insulinspritze, die vorsätzlich mit seinen tödlichen Augentropfen befüllt wurde, ermordet. Er hinterlässt ein gewaltiges Erbe, was alle seine im Haus lebenden Angehörigen schlagartig tatverdächtig macht: seine Schwägerin, seine Söhne, deren Frauen und Kinder und nicht zuletzt seine 50 Jahre jüngere neue Frau und deren mutmaßlichen Geliebten. Charles wird nun als Ermittler eingeschleust, sowohl von seinem Vater, der bei Scotland Yard arbeitet, als auch von Sophia, die verkündet hat, ihn nur dann zu heiraten, wenn der Mord aufgeklärt wird. Für den Leser ein etwas befremdlicher Ansporn, doch er scheint zu wirken, denn Charles, plötzlich erschreckend gefühlsarm und taktlos, sieht es nicht ein, „warum der plötzliche Tod eines alten Mannes“ seine Hochzeitspläne durchkreuzen soll.
Als Ermittler aber wirkt Charles sehr blass, auch die Liebe zu Sophia gerät in den verwinkelten Ecken des krummen Hauses völlig außer Sicht. Dagegen nehmen nun die Angehörigen allen Raum ein, die nacheinander vorgestellt und befragt werden: Die exzentrische Schwiegertochter und Schauspielerin Magda, die alles dafür tun würde, mehr Dramatik in die skurrile Inszenierung zu bringen, die sie aus ihrem Leben macht. Der verhuschte Hauslehrer Laurence, den alle gern als Mörder sehen würden. Die stolze Tante Edith, die ungleichen Söhne, der wütende Enkel und die Hobbydetektivin Josephine. Dabei zeigt sich, dass Christies Stärke nicht in tiefgreifenden Charakterbeschreibungen liegt, dafür aber in ihrer herausragenden Fähigkeit, einen spannenden Whodunit zu konstruieren. Immer wieder warten überraschende Wendungen auf, Geheimnisse geraten an die Oberfläche, man rätselt mit, verdächtigt, um dann alle Vermutungen wieder als vollkommen unwahrscheinlich abzutun. Zwar wirkt keine der Figuren wirklich böse, niemandem traut man einen Mord zu (weshalb auch die Angst, dass der Mörder noch im Haus ist, nie greifbar wird), doch die Tatsache, dass man bis zum Ende gespannt auf die Auflösung wartet, lässt viele Oberflächlichkeiten entschuldigen.
Nur Charles versucht sich immer wieder an psychologischen Erklärungen. Ein Mörder nämlich, so im Gespräch mit seinem Vater, sei schlichtweg „anders“. Er könne nicht anders als zu töten, da er „moralisch unreif“ bleibe und weder wisse noch spüre, dass seine Tat unrecht ist. Im Lichte dessen müsste man annehmen, die Frage nach einem triftigen Motiv sei obsolet. Dennoch forscht Charles in all seinen Gesprächen mit den Hausbewohnern nach deren möglichen Gründen, Aristide ermordet zu haben. Eine seltsame Schieflage.
Der Schluss selbst lässt den Leser, trotz einer umfangreichen Aufklärung, rätselnd zurück. Denn gerade angesichts der von Charles und seinem Vater entwickelten Tätertypologie besänftigt die Lösung nicht, sondern erschreckt nur noch mehr. Um des Plots Willen lässt Christie Abgründe entstehen, die mit leichtfertigen Erklärungen übersprungen werden. Was bei so mancher oberflächlichen Charakterbeschreibung noch annehmbar war, wird hier schmerzlich vermisst und hinterlässt den Leser mit einem gewissen Unfrieden.
Trotz allem – man spürt, dass Christie Freude beim Schreiben hatte. Wer vergnüglich schreibt, der müht sich vielleicht weniger mit komplexen Innenleben und menschlichen Untiefen, der Frage nach Glaubwürdigkeit und Plausibilität ab. Stattdessen aber erhält man einen Krimi, der größtmöglich überrascht, der kurzweilig, amüsant ist und bei Laune hält.
|
||