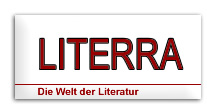
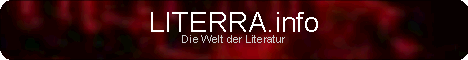
|
|
Startseite > Rezensionen > Thomas Harbach > Science-Fiction > Punktown |
Punktown
| PUNKTOWN
Jeffrey Thomas Festa SF |
Jeffrey Thomas „Punktown“ beschließt sehr wahrscheinlich das ambitionierte Projekt der Festa Science Fiction. Zusammen mit dem für die Reihe verantwortlichen Herausgeber Michael Nagula hat sich das Leipziger Verlagshaus bemüht, sehr gute Autoren wie Orson Scott Card und Nancy Kress – die für ihre neuen Werke trotz jahrelanger Arbeit für Häuser wie Bastei und Heyne – oder den in Deutschland immer noch ignorierten Robert J. Aawyer zu veröffentlichen.
Da Science Fiction in Deutschland mehr und mehr zu einem Bahnhofsgeschäft wird, haben die Taschenbücher nicht den Weg zum Käufer gefunden.
„Punktown“ ist auch keine komplette deutsche Erstveröffentlichung. Zwölf der Geschichten erschienen mit einem Vorwort von Michael Marshall Smith, aber vor allem Illustrationen von H.R. Giger in einer signierten, limitierten Auflage. Der 1957 geborene Jeffrey Thomas hat seit den frühen achtziger Jahren an seinen „Punktown“ Geschichten gearbeitet. Nach der Ausbildung hat er in einem cheimischen Labor gearbeitet. Seine künstlerische Karriere begann als unter anderem auch als Illustrator, inzwischen hat er sich ganz auf den Schreiben konzentriert. Neben einigen Kurzgeschichtensammlungen veröffentlichte er in den letzten Jahren mehrere Horrorromane.
„Punktown“ selbst hat sich aus einer einzelnen Vision über vier bestellte Geschichten für eine Veröffentlichung in einem kleinen Verlag, die Neuauflage mit Gigers den Text sehr gut ergänzenden Bildern zu dem kompletten Taschenbuch mit insgesamt fünfzehn Geschichten gemausert.
Die ursprünglichen Storys sind sorgfältig überabreitet worden, auch wenn das unfertige, das rudimentäre Element sicherlich den Eindruck von Rohheit und einer fremden Welt unterstrichen hätte. Denn „Punktown“ liegt auf einem fernen Planeten zwischen den Sternen. In einer fernen Zukunft auf dem Planeten Oasis liegt die Siedlung Paxton. Die Ureinwohner der Welt Choom haben ihr Kleinod – Spuren der ursprünglichen Siedlung finden sich als Museen und bilden in einigen der Geschichten eine Art mystischen, aber niemals expliziert ausgearbeiteten Hintergrund – den Menschen überantworten müssen. Wie in der amerikanischen Geschichte haben die Ureinwohner ihre Identität verloren. Jahrhunderte später spielen in diesem Schmelztiegel Jeffrey Thomas Geschichten. Allerdings ist seine Zukunft in erster Linie biogenetisch extrapoliert. Es gibt zwar Roboter – die modernen Sklaven – und die sozialen Strukturen beginnen sich in einer Hommage an Fritz Langs „Metropolis“ in einer Unter- und Oberwelt zu sammeln, aber die eigentlichen Probleme, die Thomas in seinen Texten anspricht, sind allgegenwärtig. Das macht auch den Reiz dieser Storysammlung aus. Im Vergleich zu anderen an einem Ort spielenden Episodenromanen sind alle Texte abgeschlossen, nur der Hintergrund ist das verbindende Element.
In der ersten Geschichte „Das Spiegelbild von Geistern“ begegnet der Leser einem Künstler, der Klone von sich selbst schafft, diese genetisch manipuliert und als Kunstwerke verkauft. Als er einer verstümmelten Inkarnation von sich selbst begegnet, beginnen seine Zweifel. Diese verstärken sich, als er für ein reiches Ehepaar zum ersten Mal einen weiblichen Klon seiner selbst schafft und die emotionale Barriere zwischen Original und Kopie zu zerbrechen droht. Wie in vielen anderen Geschichten der Sammlung untersucht Jeffrey Thomas schon in der Auftaktstory das labile emotionale Innenleben seiner Charaktere. Dabei dienen in erster Linie Freunde und Verwandte als Reflektionskörper, mit ihren pointierten, sicherlich Teile einer fragwürdigen Wahrheit enthaltenden Bemerkungen verbinden sie den Leser und den Protagonisten. As insbesondere dieser Geschichte fehlt ist allerdings der zweite Schritt. Der Künstler setzt sich zu Beginn sehr distanziert mit seiner Körperkunst auseinander, hält sich einen deformierten Klon als Zimmerschmuck. As die Distanz zwischen seinen Geschöpfen und ihm selbst zu schwinden beginnt, hätte ein routinierter Autor aus dieser neuartigen Situation deutlich mehr Emotion herausarbeiten können, den Zweifel säen. Hier blickt Thomas in dieser intensiven Geschichte an der Oberfläche.
„Zeit der Häutung“ in diesem Punkt deutlich befriedigender, eine junge Frau hat sich ihr Gedächtnis nach einer brutalen Vergewaltigung löschen lassen. Als sie einem attraktiven Mann begegnet, stellt sie sich unwillkürlich die Frage, ob es sich um einen der Täter oder vielleicht sogar ihren ehemaligen Ehemann handelt. Thomas setzt sich intelligent mit der Frage auseinander, ob auch körperliches und seelisches Leid Bestandteile der eigenen Persönlichkeit bleiben müssen. Obwohl sie sich vor ihren Erinnerungen fürchtet, sehnt sich seine Protagonistin danach, zumindest Hinweise von ihrer Umwelt zu erhalten. Das Ende der Story ist frustrierend offen, ein Beweis, dass auch der Autor im Grunde keine Antworten auf die hier aufgeworfenen Fragen hat. In „Wakizashi“ fügt Jeffrey Thomas seinen Geschichten expliziert ein weiteres Element hinzu. Das außerirdische Wesen. Ein Diplomat muss – nachdem seine mitgebrachten Opfer „aufgebraucht“ worden sind – Menschen töten, um sein Gesicht zu wahren. Ein anderes außerirdisches Wesen hat die Vergewaltiger seiner Frau getötet und wartet in der Zelle auf die Vollstreckung seines Todesurteils. Er stellt sich als weiteres Opfer zur Verfügung. Dazwischen ein Polizist, der die fremdartigen Rituale der Außerirdischen zu verstehen sucht. Neben dieser bizarren Ausgangssituation nimmt das alte japanische Ritual der Ehre – auch in der vorangegangenen Geschichte findet sich auf die moderne Inkarnation eines eher rituell überzeichneten Japans in Person des Schriftstellers Mishima ein Hinweis – einen sehr breiten Raum auf. Diese fast groteske Gegenüberstellung von Fremden und einem irdischen Volk, das den meisten Menschen auf der Erde immer fremd sein wird, beinhaltet eine ungewöhnliche Faszination. Der Text selbst ist eher fragmentarisch angelegt, es gelingt dem Autoren aber, die unterschiedlichen Standpunkte eher sachlich und emotionslos, aber pointiert darzustellen.
„Edelmetall“ hebt schließlich die Distanz zwischen den Maschinen und dem Menschen auf. Die Vorurteile gegenüber den perfekten Kopien bleiben. Thomas manifestiert diese am Jazz, der sich aus reiner Emotion und Improvisation zusammensetzt. Eine im Mafiamilieu spielende tragische Liebesgeschichte. Ganz geschickt benutzt der Autor die einzelnen Genreversatzstücke inklusiv einer bitteren Anspielung auf den Fritz Lang Klassiker „Metropolis“, um eine im Nachhinein kitschige und in seiner Anlage zu wenig erklärte Geschichte zu erzählen. Bis auf das abrupte, unbefriedigende und vor allem zu optimistische Ende ist „Alles aus Liebe“ eine der am meisten abgerundeten Geschichten der Sammlung. Jeffrey Thomas lässt sich Zeit, die beiden Protagonisten – er mittelloser Künstler auf der Suche nach dem Erfolg, sie Straßenmädchen – zu entwickeln, eine romantische Liebesgeschichte trotz oder gerade wegen der inneren Narben, welche sie mit sich trägt. Die Bedrohung kommt in Form unbezahlter Rechnungen, die Erlösung im Verkauf seiner lebenden Kunst, in deren Mittelpunkt seine Freundin steht. Die skrupellose Ausnutzung ihres Körpers durch den neuen Besitzer und schließlich die schon im Vorwege erkennbare Katharsis. Alle klassischen märchenhaften Elemente sind vorhanden, werden mit Jeffrey Cyberpunkstil ein wenig verfremdet und updated. Die Mischung funktioniert allerdings sehr gut, da Jeffrey Stärke – die Erschaffung einer grotesken, was surrealistischen Zukunftswelt voll erstaunlicher Details – von einer soliden Handlung sehr gut unterstütz wird. Motive aus den ersten Geschichten werden interessant variiert und runden das Lesevergnügen ab.
Während „Opferung“ die Elemente des Film Noirs in eine geradlinige, ein wenig tragische, aber vorhersehbare Handlung integriert, gehört „Bibliothek der Leiden“ zu den Texten, in denen Jeffrey Thomas Symbiose aus Melancholie und biologischer Technik nicht funktioniert. Ein Polizist mit einem Gedächtnischip schaut die vielen Opfern eines perversen Massenmörders an, seine Mutter liegt in einem Krankenhaus im Sterben und er möchte sein perfektes Gedächtnis wieder verlieren. Die Elemente wirken nicht harmonisch, zu sehr wird im Grunde eine dunkle, eine traurige Stimmung erzeugt, die allerdings aufgrund der fehlenden Sympathie zwischen Leser und Protagonist nicht überspringen kann. Der Handlungsaufbau ist unnötig fragmentarisch dargestellt und die Idee des Segens/ Fluchs des perfekten Gedächtnis nicht in Ansätzen ausgearbeitet. Spätestens seit „Das Böse kommt auf leisen Sohlen“ verfügt das Zirkus über eine beängstigende Faszination.
Mit „Auf einem Meer aus Milch“ versucht sich Jeffrey Thomas an einer ureigenen Vision. Herausgekommen ist weniger ein verstörender Bericht über die Attraktion des Zirkus, sondern eine Story von sich stetig steigender Besessenheit. Ein Junge erhält bei einem Besuch eine geheimnisvolle lebende Puppe. Er tut sie erst als Bauerntrick ab, beginnt sie zu quälen. Als sie aus seinem Zimmer flieht, setzt er zur Verfolgung an. Handlung und Stimmung passen bei dieser Geschichte deutlich besser zusammen als in einigen der vorangegangenen Texte. Je surrealistischer die Atmosphäre ist, welche der Autor entwirft, um so besser passen einfache, handlungstechnisch stringente Versionen dazu. „Die Farbe Schrain“ ist eine der längsten Geschichte. Sie beginnt als klassische Kleingangsterstory. Ein Mann kauft sich einen besonderen Anzug, um seinem Milieu zumindest äußerlich zu entkommen und erhält einen im Grunde sehr einfachen Auftrag, Er soll ein bestimmtes Bild entwenden. Der Diebstahl gelingt, allerdings kann er das Bild nicht pünktlich übergeben. Aus dieser banalen Situation heraus entwickelt Thomas eine interessante, nuancierte und vor allem sowohl im Hintergrund als auch bei der Charakterisierung der wenigen Protagonisten befriedigende Geschichte.
„Das unerträgliche Sein des Lichts“ zeigt Thomas in seiner ganzen Verspieltheit. Die zugrunde liegende Handlung dient nur noch als Einführung und latenter roter Faden zu einer Reihe von immer abstrakter werdenden Bildern. Wenn sich schließlich der Auftragskiller seiner Monsterverkleidung entledigt, hat man nicht unbedingt das Gefühl, als käme das wahre Wesen zum Vorschein. Es ist, als läge sich der Mensch nur eine weitere Maske auf. „Die Hassmaschinen“ ist im Grunde eine Variation von Michael Douglas Film „Falling Down“ in einer unmenschlichen Zukunft, welche den Menschen zu einem Objekt zwischen virtueller Realität und geisttötender Arbeit reduziert. Die Eruption der Gewalt findet zwar noch durch einen Katalysator statt. Dieser ist aber unnötig und ein Kompromiss gegenüber den Lesern.
Der Alptraum des biogenetischen Lebens erwacht in „Sweaty-Betty- die Termitenkönigin der Verdammten“. Der Titel ist im Grunde die Zusammenfassung der Geschichte, der Plot wird im Vorwege angesagt, alleine die grotesken Kreaturen, welche Jeffrey Thomas in dieser offensichtlichen Hommage an Giger und die „Alien“- Filme erschaffen hat, bleiben dem Leser im Gedächtnis. In der nächsten satirischen Story „Völlig vertiert“ betont der Autor das außerirdische Element. Immerhin ist Punktown auf einer fremden Welt erbaut worden, die ursprünglichen Fremdrassen sind inzwischen verdrängt und in der sozialen Hierarchie ganz ans Ende durchgereicht worden. Der ungewöhnliche Polizeieinsatz wird mit Spuren von bodenständigem Humor beschrieben, die fast gotischen Beschreibungen auf ein sinnvolles Maß reduziert. Es ist vielleicht die unauffälligste Story de ganzen Sammlung, aber ein Mainstreamtext, der am ehesten interessierten Fans die ungewöhnliche Welt des Jeffrey Thomas vermitteln kann.
„Hydra“ schließt im Grunde den Kreis zum Beginn der Sammlung. Der Künstler schafft aus seinen Klonen Kunstwerke, welche von den neuen Besitzern benutzt werden können. Der Killer tötet seine eigenen Klone. Ist der Mord an sich selbst eine Straftat? Wie im klassischen Horrorfilm werden allerdings die eigenen Abbilder zu eigenständigen Persönlichkeiten, die ihre eigenen Ziele verfolgen. Die letzte Story der Sammlung
„Die Monster“ ist eine ironische Umkehrung der menschlichen Lebensart. Wie kein anderer Text dringt diese kurzweilig zu lesende Satire unter die Oberfläche der Schmelztiegelstadt und entlarvt insbesondere die Menschen als moderne Parsitäten, egoistisch, eitel und aggressiv. Durch den Spiegel der Fremden betrachtet erhalten viele der hier versammelten Geschichten freiwillig oder unfreiwillig eine andere Note.
In der Tradition von VanderMeer „Die Stadt der Heiligen und Verrückten“ oder Kleugdens „Cosmogenesis“, aber in den einzelnen Kurzgeschichten autarker und weniger verschachtelt entwickelt der Autor Jeffrey Thomas in seinen Texten eine faszinierende, fremdartige, aber auch verstörende Zukunft. Die Mischung aus Biogenetik, Cyberpunk mit einem gewissen Retrolook, Anleihungen bei Locecraft und den abstossenden Geschöpfen eines Gigers findet er überraschend selbstsicher eine eigene Stimme, die in den dunklen Gassen der auf einer fremden Zivlisation gebauten Stadt wiederhalt. Nicht jede Begegnung ist furchtbar, grausam oder gruselig.
Es ist überraschend, mit welchem Einfühlungsvermögen einige dieser Geschichte verzweifelte Liebesgeschichten sind, melancholische Dramen oder alltägliche Tragödien.
Nicht jeder Text ist als reine Geschichte befriedigend, manchmal wirkt das Ende zu abrupt oder konstruiert, manchmal erdrückt die Stimmung den nur latent vorhandenen Plot, nicht selten erscheinden die einzelnen Charaktere als zu eckig oder sperrig, aber in ihrer Gesamtheit betrachtet ist „Punktown“ eine der interessantesten New Wave Veröffentlichungen in der Twilight Zone zwischen Science und Weird Fiction.
http://www.sf-radio.net/buchecke/science_fiction/i...
Der Rezensent
Thomas HarbachTotal: 732 Rezensionen
März 2018: keine Rezensionen
Weitere Rezensionen
|
|
Punktown - Geschichten einer Stadt
Jeffrey Thomas - PUNKTOWN |
[Zurück zur Übersicht]
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info






