Die teilweise heftigen Diskussionen um die jüngste Vergabe des Literaturnobelpreises an Bob Dylan zeigen, dass der Preis immer noch eine gewisse Strahlkraft hat. Ansonsten würden sich die Emotionen nicht derart hochschaukeln. Wenig Beachtung findet dabei, dass die Schwedische Akademie jedes Jahr ein kleines bisschen ihr Archiv öffnet. Mit dem je nach Temperament wohltuenden oder obsolet-hinhaltenden Abstand von 50 Jahren werden die Nominierungen zu den Nobelpreisen veröffentlicht. Das Finden auf der Webseite ist etwas kompliziert. Hat man sich aber erst einmal eingegroovt, wird man mit interessanten Erkenntnissen belohnt.
Derzeit gibt es Zugriff auf die Nominierungslisten zu den Nobelpreisen von 1901 bis 1965. Die Suche kann leicht sowohl über den Namen als auch über das Vergabejahr durchgeführt werden. Insgesamt waren bis dahin 3005 Nominierungen für den Literaturnobelpreis eingegangen. 1901 lagen 37 Nominierungen vor, 1965 waren es bereits 90. (Die Zahl ist inzwischen deutlich höher.) Ein Blick auf die Listen zeigt, dass neben Einzelvorschlägen auch Sammelnominierungen mehrerer Persönlichkeiten für einen Kandidaten gab, die allerdings nur einmal gezählt wurden. Studiert man die Listen genau, so gab es keine Garantie für den »Unterlegenen« bei einer der nächsten Preisvergaben berücksichtigt zu werden.
1902, als womöglich auf Empfehlung von 18 Mitgliedern der »Preussischen Akademie der Wissenschaften« der Historiker Theodor Mommsen den Nobelpreis bekam, tauchte auch zum ersten Mal der Name Gerhart Hauptmann auf. 1906 machten sich 35 deutsche und österreichische Professoren für ihn stark. Ob dann 1912 die Nominierung von Erich Schmidt den Ausschlag gab oder ob da etwas »abgearbeitet« wurde? Dreimal schlug Hauptmann danach selber vor: 1916 für Verner von Heidenstam, 1919 Hugo von Hofmannsthal und 1924 Thomas Mann. Von Heidenstam, der selbst Mitglied der Schwedischen Akademie war, bekam den Preis tatsächlich 1916. Thomas Mann erst 1929. Einzig Hugo von Hofmannsthal wurde nicht berücksichtigt.
Das Studium der Nominierungen und Vorschläge zeigt: Die reine Anzahl der Vorschläge spielte keine Rolle. Manche Gewinner wurden sogar nur ein Mal vorgeschlagen wie beispielsweise William Faulkner. Oder auch der Philosoph Rudolf Eucken 1908 (dem Vater des heute noch bekannteren Wirtschaftswissenschaftlers Walter Eucken). Er wurde nur einmal vorgeschlagen, Selma Lagerlöf hingegen erhielt 6 von insgesamt 23 Vorschlägen. Noch erdrückender waren die Stimmen für Lagerlöf 1909, so dass sie dann den Preis bekam. Umgekehrt gibt es auch Dauerkandidaten wie etwa der spanische Historiker Ramón Menéndez Pidal, der in 34 Jahren 149 x nominiert war – aber nie den Preis erhielt (allerdings auch 6 x selber vorschlagen durfte). Anders Halldor Laxness, dem 25 Nominierungen binnen sieben Jahren genügten.
André Gide, der 1947 den Preis bekam, schlug 1951 Pär Lagerkvist vor, der auch prompt ausgezeichnet wurde (allerdings schon mehrmals Vorschläge auf sich vereinen konnte). Gides und Hauptmanns Treffer täuschen: Die Vorschläge der Nobelpreisträger selber fanden eher selten Berücksichtigung. Romain Rollands Kandidaten gingen leer aus; alleine drei Mal setzte er sich für den heute unbekannten Rudolf Maria Holzapfel ein und auch Sigmund Freud bekam den Preis nicht. Fünf Mal schlug Pearl S. Buck Kandidaten vor – stets erfolglos. Thomas Mann musste 15 Jahre warten bis sein Vorschlag Hermann Hesse ausgezeichnet wurde. Es gibt übrigens keinen Hinweis darauf, dass man 1946 zwischen Hesse und Brecht entschieden hatte, wie es in einer Legende heisst. Brecht wurde nur ein Mal, 1956, seinem Todesjahr, vorschlagen. Hesse hingegen wurde immer wieder vorgeschlagen, auch in den Kriegsjahren als es nicht zur Preisvergabe kam.
Fast noch interessanter ist ja, wer den Preis nicht erhalten hat. Darunter Klassiker wie Henrik Ibsen und Émile Zola (sie starben vielleicht zu früh). Oder Alfred Döblin, Ezra Pound, Leo Tolstoi (zuletzt versuchte man es mit dem Freidensnobelpreis) und James Joyce (nicht ein einziges Mal wurde er vorgeschlagen); die Liste kann fast endlos erweitert werden. Auch Ernst Jünger wurde bis 1965 5 x vorgeschlagen. Und man kann sicher sein, dass es bei den 9 Vorschlägen für Max Frisch bzw. 11 für Friedrich Dürrenmatt nicht geblieben ist.
In den 1960er Jahren wurden nur wenige deutsche Autoren vorgeschlagen, darunter Marie-Luise Kaschnitz, Ina Seidel und Arnold Zweig. Nur einer stach mit damals bereits 10 Nominierungen heraus: Heinrich Böll – darunter 1961 von Walter Höllerer; dessen einziger Vorschlag.
Höllerer blieb nicht der einzige Deutsche nach dem Krieg, der Vorschläge unterbreitete. Besonders häufig trat Friedrich von der Leyen in Erscheinung. Erich Kästner war
sowohl nominiert als auch Vorschlagender (da sein Name genannt wird und nicht die Organisation [der PEN], dürfte es sich um »private« Vorschläge gehandelt haben).
Manche brauch(t)en den Nobelpreis nicht. Irgendwie setz(t)en sie sich durch. Aber es gab auch Autoren, die in ihrer Zeit sehr bekannt waren und häufig vorgeschlagen wurden wie Rudolf Kassner oder Paul Ernst. Sie sind längst vergessen. Aber dieses Schicksal teilen sie auch mit etlichen Nobelpreisträgern. Und bei so manchem Kandidaten ist es nachträglich ziemlich gut, dass sie langfristig ignoriert wurden (etwa hier oder hier).
Von 1962 an erlaubt die Akademie noch tiefere Einblicke in den Entscheidungsprozess. Auch hier lohnt das Nachforschen.
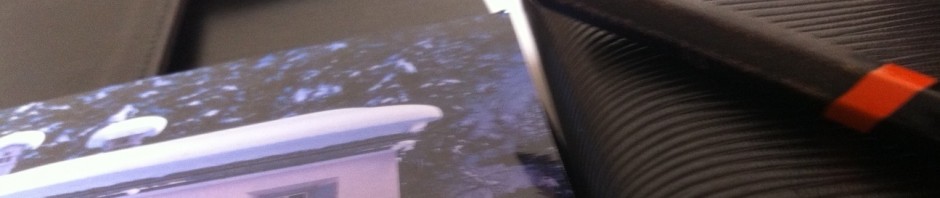


















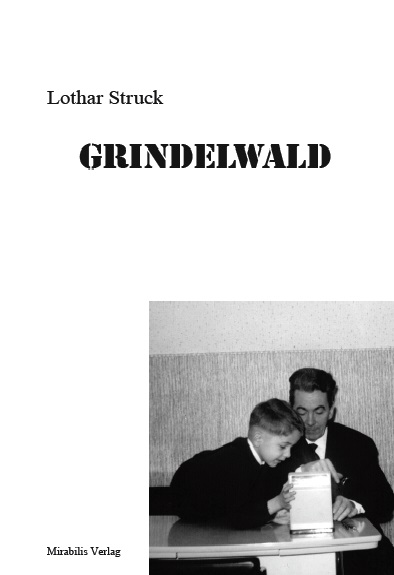
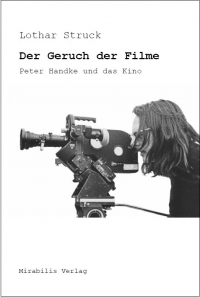
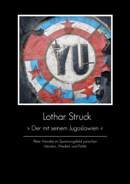
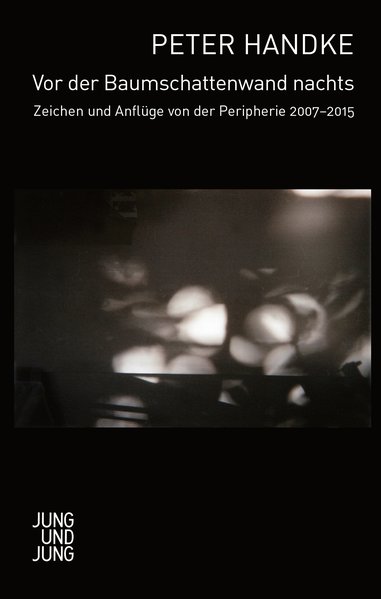
»Walter Mommsen« hieß richtig: Theodor Mommsen!
#1
So ist es. Danke.
#2
Liest sich spannend, aber mir stellt sich die Frage: welche Hürden muss denn eine Nominierung nehmen?! Wer darf nominieren?!
Abgesehen von den Formalia und der Seriösität des Vorschlags, kam mir die Überlegung, ob es nicht womöglich eine »anonyme Interessengemeinschaft« rund um das Kommitee, rund um den Globus, geben könnte, die gewissermaßen eine Selektion der Kandidaten nach den Regeln der Freundschaft (also der Sozialpsychologie) bewirkt.
So wären auch fehlende Vorschläge prominenter Autoren oder Überraschungssieger erklärbar.
»Endlich hat jemand den Faulkner vorgeschlagen!«
Ist vielleicht eine Trivialität, die ich hier erwäge, aber kann es sein, dass neben der Weltöffentlichkeit, die die Preisvergabe beobachtet auch so eine Art »Lobby« gibt, also literarisch und akademisch bestens bestallte Leute, die ein wesentliches Interesse, nämlich die »richtige Vergabe des Literatur-Nobelpreises« verbindet…
Ich kenne sehr viele Menschen, die sich darüber überhaupt keine Gedanken machen, also wen interessiert das sozusagen schon im Vorfeld?!
Ist das psychologisch gesehen, nicht ein sehr »verdächtiges« Interesse, der Preis für jemand anderen, dessen Auszeichnung mir sehr am Herzen liegt?!
Ich frage mich, ob mit dem Literatur-Nobelpreis gerade in Hinsicht auf die Nominierungen der psychologische Begriff der »Objekt-Besetzung« eine zentrale Rolle spielt…
Demnach wären hochnotable Persönlichkeiten in der außergewöhnlichen Lage, Prestige-Objekte meta-narzisstisch zu besetzen.
Der wichtige Preis (Besetzung) für die richtige Person (Alter-Ego)…
Oder fehlt mir Elends-Nietzscheaner einfach nur der Glaube an den Edelmut der Haut-Voleé und deren praktisch buddhistische Vollkommenheit?!
#3
Es ist klar definiert, wer Vorschläge unterbreiten darf (bzw. wessen Vorschläge überhaupt Berücksichtigung finden) Auf der Seite der Akademie heisst es:
Und natürlich ist es eine Illusion zu glauben, dass die Vorschlagenden keine Sympathien damit verbinden…
#4