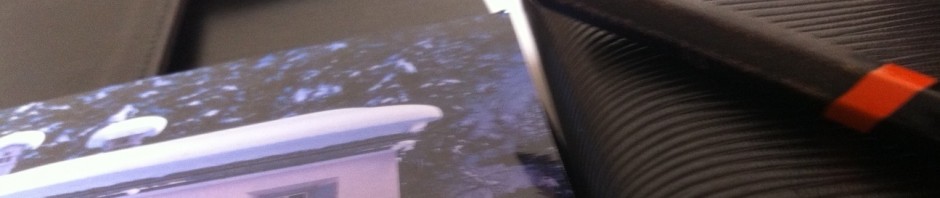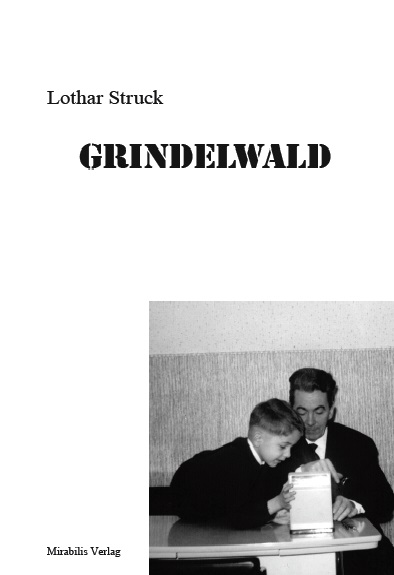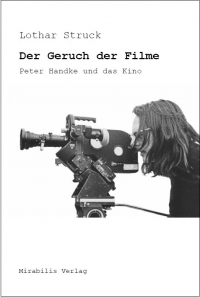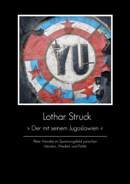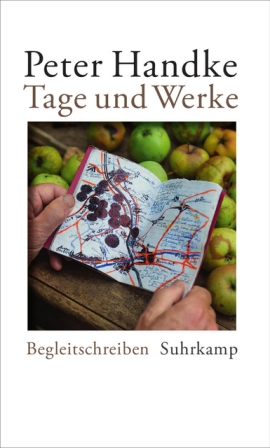6
Mehrfach hat Nietzsche seine eigene Entwicklung rückblickend zusammengefaßt und eine Zukunft für seine Person oder eines seiner Alter Egos skizziert. Oft handelt es sich dabei um einen Dreischritt, wobei der dritte Schritt immer erst zu setzen bleibt. So zum Beispiel in Zarathustras Rede von den drei Verwandlungen, die fiktionalen und allegorischen Charakter hat, aber eindeutig Parallelen zu Nietzsches geistiger Biographie erkennen läßt. Da ist zunächst der Wahrheitssucher, der seinen Erkenntnisdurst stillt, dabei aber seelisch Schaden leidet und sich nur solche Freunde macht, die ihn nicht verstehen können. Danach verwandelt sich der Denker zu einem Wollenden, der sich »tausendjährige Werthe« aneignet und unter ihren Imperativen leidet, weil die überlieferten Systeme ihm keine schöpferische Tätigkeit erlauben. Auf einer dritten Stufe findet die Figur »zum Spiele des Schaffens« und wird zum unschuldigen Kind, das alles neu beginnt, als gäbe es noch gar nichts, nur eine tabula rasa. (Za 29-31) Dasselbe Ideal hatte Nietzsche schon in der Fröhlichen Wissenschaft formuliert; die Zarathustra-Rede legt den Akzent auf Schöpfung und Spiel, wodurch die kommende (oder werdende) Gestalt einerseits als göttlicher Weltenschöpfer erscheint, als deus faber und creator ex nihilo, andererseits als Künstler, der sich jene Fiktionen erzeugt, deren er bedarf. Der kindliche Künstler-Gott umgibt sich mit seinen Gespinsten: Fraglich, ob er auf diese Weise die Einsamkeit des Kamels, der ersten Stufe des geistigen Werdens, zu lösen vermag. Im Bereich der Phantasie mag dies gelingen, etwa so, wie Genet – oder André Reybaz in Un chant d’amour – sie in der Gefängniszelle löste. Das rhetorische Hämmern von Nietzsches Spätwerk und sein wachsender Hang zur Paranoia lassen sich vielleicht dadurch erklären, daß die dritte Stufe, der ersehnte Neubeginn, nicht Wirklichkeit werden konnte, sondern Fiktion blieb in Schriften, die niemand lesen wollte. Eigentlich hätte Nietzsche künstlerische Werke – Musikstücke, Tänze – schaffen sollen, oder apollinische, traumhafte Filme, die dionysische Gestalten herbeizaubern. Lichtgestalten für Lichtspiele… Es blieb bei philosophischen Schriften, die mit der Poesie liebäugelten.
Genet selbst zählte den Verrat neben dem Diebstahl und der Homosexualität zu den drei Kardinaltugenden seines Wertesystems. (TD 162) Man findet die Kardinaltugend nicht nur auf der Inhaltsebene seines Werks, in den zahllosen Lobliedern auf Gesten des Verrats, sondern zugleich im Akt des Schreibens selbst. Genet hat mehrmals klargestellt, daß es ihm nicht um Wahrheit, nicht um die Dokumentation einer harten, für die Häftlinge erniedrigenden Gefängniswirklichkeit geht. Und genausowenig handelt es sich um teilnehmende Beobachtung des Milieus von Schwulen, Zuhältern, Prostituierten. Moralisch gesprochen läuft sein Schreiben einerseits auf eine Umkehrung des herrschenden Wertesystems, andererseits aber auf einen Verrat der erfahrenen Wirklichkeit hinaus. »Was folgt, ist falsch«, schreibt er, als er sich anschickt, eine Episode aus der Erziehungsanstalt zu erzählen. »Die Wahrheit ist nicht meine Sache. Aber ‚um wahr zu sein, muß man lügen.'« (NDF 201) Das knappe Paradoxon steht zwischen Anführungszeichen, doch offenbar handelt es sich nicht um ein Zitat (in Frankreich wird der Satz zuweilen als geflügeltes Genet-Wort zitiert). Noch das Zitat entpuppt sich hier als Fiktion. Während Genet aber die Lüge – im Sinne einer vorsätzlichen referentiellen Täuschung, einer Nicht-Entsprechung – verteidigt, zielt er doch auf eine andere Wahrheit, und er gebraucht in diesem Zusammenhang ein Wort, das uns wiederum auf Nietzsche verweist: Spiel. Der wahre Dichter ist ein unschuldiger Spieler, und als solcher schafft er neue Werte. Wenn es wahr ist, daß ich ein Häftling bin, der Szenen aus seinem inneren Leben spielt (für sich spielt)…« Die sonst meist überzeugende Übersetzung Gerhard Hocks ist hier wesentlich ärmer als das Original. Das Wortspiel »un prisonnier qui joue (et qui se joue)« verweist darauf, daß die Lüge bei Genet von existentieller Bedeutung ist. Existentiell nicht nur im philosophischen Sinn, sondern zunächst im Sinn einer Überlebensnotwendigkeit: Genet meint, er hätte sich sonst, »ohne eitle Ausschmückung der Tat, vergiftet.« (NDF 100) Das ästhetische Spiel der Wunscherfüllung arbeitet mit einem Großaufgebot von Ornamenten – Metaphern, Vergleiche, Hyperbeln – an der Errichtung einer alternativen Welt, der eine andere Wahrheit entspricht. Zu Beginn von Wunder der Rose beschreibt Genet den Kontrast zwischen der nackten Gefängniswelt und den »heiligen Verzierungen«, die dem Ort eine Aura verleihen, die er in der Wirklichkeit nicht besaß. Im Kontrast ist die Kälte, mit der Genet die »nackte Wirklichkeit« kurz und bündig benennt, als wollte er sie abhaken, fast erschreckend – nicht sosehr wegen der faulen Zähne und spuckenden Münder, sondern durch die Bemerkung über die »Langeweile, die mir die Nähe ihrer unvergleichlichen Dummheit verschafft hat.« (WR 43) Der Dummheit und Häßlichkeit der Mithäftlinge setzt der Autor in seiner Zelle schlicht und manichäisch die Schönheit und Schläue seiner erfundenen Verbrecher entgegen, nicht anders als ein christlicher Prediger, der dem Laster die Tugend entgegensetzt. Die Wünsche aber, die er sich schreibend-imaginierend erfüllt, stehen in enger Verbindung mit einem rohen körperlichen Bedürfnis, das auch in der Gefängniszelle befriedigt sein will. Onanie zählt im christlichen Moralsystem zu den Sünden; Genet tut sich dadurch hervor, daß er die masturbatorische Praxis nicht nur eingesteht, sondern ohne erkennbare Schuldgefühle erwähnt und mit seinem literarischen Projekt, der Ruhmbegierde, verknüpft. »Ich bin ausgelaugt von diesen erfundenen Reisen, den Diebereien, Einbrüchen, Verhaftungen, Notzucht und Verrat. (…) Kraftlos: Krämpfe im Handgelenk. Die letzten Tropfen der Wollust vertrocknet.« (NDF 36) Entkräftet vom Schreiben? Von der Onanie? Beides. Beides zugleich…
Eine Frage, vielleicht die entscheidende, die die Gestaltungsversuche alternativer Welten aufwerfen, erhebt sich bereits angesichts von Nietzsches unerfüllt gebliebenem Umwertungsprojekt: Was ist daran so anders, was ist neu? Kann die Umwertung überhaupt von den überlieferten Werten absehen, oder braucht sie diese als Sprungbrett für ihre antimoralischen Kunststücke? Bleibt sie am Ende nicht an dem kleben, wovon sie sich abheben will? Zum einen entsprechen manche der von Genet propagierten Werte denen, die auch in der Mehrheitsgesellschaft gelten, oft zwar nicht offiziell, nicht im ideologischen Überbau, sondern in der Praxis. Und zum anderen wiederholt seine Darstellung in vielen Fällen bekannte Konstellationen, nur daß die wertmäßigen Vorzeichen ausgetauscht werden: an die Stelle von Plus tritt Minus, und umgekehrt. Genet stellt zwar keineswegs den Anspruch, auf diese Weise etwas »Neues« zu schaffen; dennoch erhebt sich im Kontext des von Nietzsche eingeleiteten Denkens einer anderen Moral (oder Antimoral) der Zweifel, ob hier tatsächlich ein gültiger Gegenentwurf geschaffen wird. Die Frage der Umwertung haben Nietzsche und Genet nicht beantwortet, sondern nur verschoben.
Am augenfälligsten sind in diesem Zusammenhang die zu Halbgöttern stilisierten, angehimmelten Figuren aus dem von Genet bevorzugten Milieu. Die Rollenverteilung – Unterwerfung des femininen Schwulen unter den autoritären, kräftigen, oft gewalttätigen Mann – ist mindestens ebenso streng wie in der bürgerlich-heterosexuellen Welt, und die Verbrecher verhalten sich nicht anders als die Polizisten und Gefängniswärter. Es ist nur der Zufall, der die Tunten auf die eine, die Machos auf die andere Seite gestellt hat (trotz der Symmetrie kommt ein Seitenwechsel nicht in Frage). Es gibt in Genets Universum keine persönliche Entwicklung, keinen Auf- und keinen Abstieg, sondern lediglich ein für alle Mal fixierte und zugewiesene Orte innerhalb einer Hierarchie. Auch unter diesem Gesichtspunkt erscheint Sartres Akzentuierung der freien Wahl des eigenen Schicksals fragwürdig. Wenn er von einem »Labyrinth von Gut und Böse« spricht (Sartre 211), hat er wohl eher seine eigenen Denkbewegungen im Kopf als Genets Biographie, die seinem Blick immer wieder entgleitet. In der zugehörigen Fußnote behauptet Sartre, daß es sich »eher« um eine »hegelianische Aufhebung« handle als um ein »nietzscheanisches Jenseits von Gut und Böse«. Worauf aber beziehen sich diese Sätze? Auf Genets Umwertungsnotwendigkeit – oder doch »eher« auf Sartres eigenes, abstraktes Denksystem? Der Wortlaut Genets erinnert durchaus nicht an Hegel, es gibt bei ihm keine höheren Ebenen, keine Fortschritte, sondern eiserne Rangordnungen wie bei Nietzsche, an denen nicht gerüttelt wird und nicht gerüttelt werden soll (Nietzsche beklagt den Verfall, Genet bekräftigt die Gültigkeit der Hierarchien). Der Wortlaut erinnert an die prägnante Formel des amor fati, die Nietzsche so beredt propagierte. Den Horizont dieser Rede bildet die ewige Wiederholung des Gleichen, eine Art Postulat, das Nietzsche zumeist in Form erbitterter Zustimmung zu allem Seienden (einschließlich der dekadenten Phänomene) vorbringt und in seinen Spätschriften mit einer geheimnisvollen Aura umkleidet. Bulkaen, einer der Halbgötter in Genets Wunder der Rose, versichert dem Erzähler, »daß er das Gefängnis liebe«; das Gefängnis aber ist nur »die Form, die das unheivolle Schicksal hatte entstehen lassen«. Genet will den Schrecken, der auf Bulkaen lastete, auf sich nehmen, »wie andere die Sünden der Menschen auf sich genommen haben«. (WR 442, 443) Der christologische Tonfall ist hier unüberhörbar. Natürlich handelt es sich um ein Christentum mit verkehrten Vorzeichen; der Mechanismus der Erlösung ist aber derselbe.
7
Für wen spricht Genet eigentlich? Sicher nicht für »uns«, die in seinen Romanen immer wieder angesprochenen Leser. Eher schon für seine buchfernen, womöglich analphabetischen Freunde, die eine genau definierte, von der Gesellschaft ausgeschlossene Gruppe bildeten. Falls er nicht überhaupt nur im eigenen Namen und zu sich selbst spricht und so jede Erlösungsgeste ad absurdum führt: Genets Romane als Junggesellenmaschinen… Deleuze und Guattari attestieren solchen Maschinen, die sich von paranoiden Mechanismen befreit haben, »ein Vergnügen, das man als autoerotisch oder automatisch bezeichnen kann, so als setzte die maschinelle Erotik andere, schrankenlose Kräfte frei.« (Deleuze/Guattari 25) Diese Beschreibung, so allgemein sie gehalten ist, trifft auf Genets Romane zu. Die halluzinatorischen Bilder, stimuliert durch die Verbrecherfotos an der Zellenwand, sind der sinnliche Ausdruck jenes Stroms reiner Intensitäten, der sich der Dialektik von Moral und Antimoral entzieht.
Zu wem, für wen spricht Nietzsche? Für alle und keinen, wie es im Untertitel des Zarathustra-Buchs heißt. Zur kommenden, erwünschten Allgemeinheit – und im nächsten Augenblick schon wieder zu niemandem: die Verkündigungen sind Selbstgespräch. Nietzsche schwankt zwischen dem Anspruch der Stiftung eines neuen, quasi-religiösen Wertesystems und der angewiderten Abwendung von jedem erdenklichen Gesprächspartner. Die Stiftung eines neuen Systems richtet sich zunächst an die Vertrauten, die potentiellen Jünger (Paul Rée, Lou Andreas-Salomé). Zarathustra setzt mehrmals zu pädagogischen Aufschwüngen an, die er jedesmal wieder abbricht. Was Nietzsche zu bestimmten Zeiten seines Lebens ins Auge faßte, war eine heranzubildende Avantgarde, deren Form und Funktion er nicht genauer bestimmte und nach einer Weile aus dem Auge verlor. Alles in allem können die Gedanken Zarathustras erst in ferner Zukunft greifen. Der neue Gott – oder wie immer Zarathustras Rolle definiert wird – hat sich mit seiner Einsamkeit abzufinden. Nietzsche-Zarathustras Wertestiftung verzögert sich endlos, das Buch selbst ist nichts anderes als die Spur dieser Verzögerung und damit allenfalls ein Vorschein des hypothetisch Kommenden. Allerdings stellt sich auch hier wieder die Frage, wie neu das Angekündigte, Angedeutete, Verschwiegene eigentlich ist. Bei Nietzsche verbindet sich der Erneuerungsanspruch mit einem konstanten Blick nach hinten. Zentralwörter wie »Macht«, »Stärke« und »Kraft« verweisen auf einen Tapferkeitskult, eine Verherrlichung der virtus im römischen Sinne, die Nietzsches sozialpsychologischer Analyse zufolge von der christlichen Lehre mit Füßen getreten worden ist. Virtus läßt sich mit »Männlichkeit« übersetzen; Nietzsches Frauenhaß wäre nicht zuletzt in diesem »moralgeschichtlichen« Zusammenhang zu sehen. Ein erster großer Wertewandel hat Nietzsches zufolge am Ende der Antike stattgefunden, die bevorstehende, angekündigte Umwertung ist zu einem Gutteil – nicht ausschließlich – eine Rückkehr zu jenen alten Werten.
Im vierten Teil des Zarathustra kommt es zu einem Disput zwischen dem »Gewissenhaften« – im 18. Jahrhundert hätte man ihn wohl als Pedanten bezeichnet – und der Hauptfigur. Der ängstliche, vorsichtige Mann wirft den »höheren Menschen«, also Zarthustras potentiellen Schülern, vor, es gelüste sie »nach dem schlimmsten gefährlichsten Leben (…), nach dem Leben wilder Thiere«. Zarathustra bestätigt diese Aussage, indem er sie umwertet: »Muth aber und Abenteuer und Lust am Ungewissen, am Ungewagten, – Muth dünkt mich des Menschen ganze Vorgeschichte. Den wildesten und mutigsten Thieren hat er alle ihre Tugenden abgeneidet und abgeraubt«. (Za 377) Solche Sätze schreibt ein Altertumswissenschaftler und Philosoph, dem zu körperlichen Mutproben alle Voraussetzungen fehlen. Das weiß er, und nicht zuletzt aus diesem Grund verlegt er Tapferkeit und Grausamkeit in die geistige Tätigkeit des Menschen: jedes »Tief- und Gründlich-Nehmen ist eine Vergewaltigung«, und »schon in jedem Erkennen-Wollen ist ein Tropfen Grausamkeit.« (JGB 167) Unter dem, was Nietzsche als menschheitliche Evolution skizziert, verbergen sich seine persönlichen Voraussetzungen, Bedürfnisse und Konflikte. In seiner eigenen geistigen Entwicklung werden Kampfbegierde und Selbstbehauptungstrieb in einen zunehmend polemischen Schreibstil hinein sublimiert, in letztlich halluzinatorische Gefechte mit historischen Größen wie den Hohenzollern, Richard Wagner oder Jesus Christus. Es ist wiederum ein Dreischritt, den uns Nietzsche theatralisch vorführt: von der virtus zum Christentum zum kommenden Reich. Die christliche Umwertung hat zu jener décadence geführt, die Nietzsches Gegenwart kennzeichnet und die es zu überwinden gilt. Das Wort »Dekadenz« hat in Nietzsches Gebrauch einen biologischen Beigeschmack; gemeint ist ein Verfall, eine chronische Körperschwäche sei es der Individuen, sei es des Gesellschaftsganzen (das Wort »Entartung« liegt durchaus auf dieser Denklinie).
Nietzsche schwankt in seinen Entwürfen zwischen Züchtungsphantasien, die einen Typus von neuen Menschen vorstellen, also eine Gruppe von Individuen, die man »Volk« oder sonstwie nennen mag, und einer elitären Konzeption mit dem Ziel, einzelne Individuen – die starken, die mit den besten Anlagen – zu stärken. Die Masse betreffend geht es dann einzig darum, sie soweit im Zaum zu halten, daß sie die Entfaltung der Auserlesenen nicht behindert. Vom heutigen Standpunkt aus, nach den diversen Erfahrungen des 20. Jahrhunderts, läßt sich hier einwenden, daß das Wohlergehen der Mehrheit für die Heranbildung hochqualifizierter Minderheiten nicht hinderlich sein muß, sondern diese sogar förden kann. Dieser Gedanke, im Sport eine Binsenweisheit, scheint Nietzsche nicht einmal gestreift zu haben. Nietzsche zog es vor, sich über das angeblich bedrohte Schicksal der Starken zu ereifern. »Fast Alles, was wir ‚höhere Cultur‘ nennen, beruht auf der Vergeistigung und Vertiefung der Grausamkeit – dies ist mein Satz«, erklärt er in Jenseits von Gut und Böse. »Jenes ‚wilde Thier‘ ist gar nicht abgetödtet worden, es lebt, es blüht, es hat sich nur – vergöttlicht.« (JGB 166) Man kann Nietzsches Haupt-Satz im Sinne der Freudschen Sublimierungstheorie verstehen, sollte dabei aber auch bedenken, daß sämtliche Bestrebungen Freuds auf eine Förderung des Geistigen hinausliefen, während Nietzsche – natürlich nur verbal, oder fiktional – immer wieder damit spielt, den rohen Anteil der Gewalt zu reaktivieren. Den Philosophen, also sich selbst, sieht er »als Künstler und Verklärer der Grausamkeit« walten. Oftmals zitierte, für unterschiedliche Zwecke gebrauchte Worte wie das von der »blonden Bestie« sind keine Entgleisungen, sondern bildhafte Zuspitzungen eines Gedankenkomplexes, mit jenem Haupt-Satz in der Mitte.
An einer anderen Stelle derselben Schrift bezeichnet Nietzsche sich und die Seinen – zu diesem Zeitpunkt, 1886, sind es eher die »Keinen« – als »wir Umgekehrte«, was sich der lateinischen Etymologie folgend auch als »wir Pervertierte« formulieren läßt (Genet sollte diesen Aspekt der Umkehrung als vorsätzlicher Perversion später hervorheben). Die Elite der Umgekehrten hat ihren Lebenswillen – das entscheidende Kriterium – in der Gefahr immer nur gesteigert. Was uns nicht umbringt, macht uns stärker: dieser von Nietzsche geprägte Spruch ist in der Nazi-Zeit in den Schatz volkstümlicher Weisheiten eingegangen. Die »Guten« sind für Nietzsche die Vornehmen, das heißt die Starken, die es verstehen, sich dem sozialen Zwang zu entziehen. Sie treten dann »in die Unschuld des Raubthier-Gewissens zurück, als frohlockende Ungeheuer, welche vielleicht von einer scheusslichen Abfolge von Mord, Niederbrennung, Schändung, Folterung mit einem Übermuthe und seelischen Gleichgewichte davongehen, wie als ob nur ein Studentenstreich vollbracht sei, überzeugt davon, daß die Dichter für lange nun wieder Etwas zu rühmen und zu singen haben.“ (GM 275) In Genet haben diese Ungeheuer den Dichter, der sie zu rühmen versteht; auch bei ihm steht der Mord in der Hierarchie der Verbrechen – also Tugenden – an erster Stelle. Die »lüstern schweifende« Bestie, wünscht Nietzsche, »muss wieder heraus, muss wieder in die Wildniss zurück…« Man könnte hier Adalbert Stifter zitieren, einen Dichter, der ausgehend von einem ähnlichen Befund die gegenteilige Schlußfolgerung zog. In seiner Erzählung Zuversicht behauptet ein alter, lebenserfahrener Mann, wir alle hätten »eine tigerartige Anlage, so wie wir eine himmlische haben«. Auch er widmet sich der Ausmalung der Gefahr, um dann folgende Maxime aufzustellen: »Der größte Mann – ich meine den Tugendhaften darunter, widersteht nur dem geweckten Tiger und läßt ihn nicht reißen, während der Schwache unterliegt und rasend wird.« (Stifter 356) Praktizierte Ethik ist nach diesem verbreiteten, christlich gefärbten Modell die Zähmung einer unausrottbaren rohen Natur.
8
Nietzsches Äußerungen erweisen sich, wie jene Genets, vor diesem Hintergrund zunächst als antimoralisch. Auf den zweiten Blick wird aber klar, daß Nietzsche dem Lob der Barbarei immer wieder seine Hochschätzung geistigen und ästhetischen Raffinements beimengt, wodurch sich sehr eigentümliche Kontraste, Paradoxien, auch Ungereimtheiten ergeben: schillernde Figuren oder Typen in einem fiktionalen Feld, deren ausgereiftester Vertreter Zarathustra ist (der dennoch immer vage bleibt). Und es zeigt sich weiters, daß Genet, wenn er die literarische Maschine der Umpolung einmal in Gang gesetzt hat, an die Stelle der alten Werte zwar die alten Unwerte, also die negativen Pendants von Werten wie Redlichkeit, Sanftmut, Treue, Demut, Beständigkeit setzt, seine Gegenwelt aber in erster Linie nach ästhetischen Kriterien aufbaut, die sich unmerklich an die Stelle der moralischen setzen. Was also stattfindet, ist keine Revolution, kein Umsturz, sondern eine Verschiebung. Schon bei Nietzsche deutet sich die Privilegierung der Form vor den Inhalten an. Einer seiner »obersten Sätze« lautet, »dass, um Moral zu machen, man den unbedingten Willen zum Gegentheil haben muss.« (GD 102) Ich gebe hier einmal eine der zahllosen Hervorhebungen Nietzsches wieder; »machen« hat er wohl deshalb unterstrichen, weil weil es ihm um den Aspekt des Schöpferischen, der creatio, zu tun war.
Das Gegenteil um seiner selbst willen zu sagen oder zu tun ist im Grunde genommen ein kindliches Verhalten, das Eltern manchmal zur Verzweiflung bringen kann. Für Kinder ist es meistens ein Spiel, das Ernst werden, jedenfalls aber die ernsthafte Erwachsenenwelt stören kann. Auch wenn man die Aufwertung des Kindlich-Spielerischen nachvollziehen und goutieren mag, so genügt sie doch nicht, um eine fiktionale oder wirkliche Welt zu schaffen; von Inhalten kann allenfalls die Musik gänzlich absehen, nicht aber die Literatur, noch weniger eine Welt, die sich als »Gesellschaft« versteht. Die oft zitierte Passage, in der Genet Bewunderung für das Hitler-Regime äußert, wirkt salopp hingeschrieben und verfolgte wahrscheinlich keine andere Absicht, als im Nachkriegsfrankreich zu provozieren. »Nur den Deutschen in der Zeit Hitlers gelang es, gleichzeitig die Polizei und das Verbrechen zu sein.« (TD 207) Einen Ansatz zur Analyse der damaligen deutschen Verhältnisse bietet diese 1946 niedergeschriebene Behauptung nicht. Beim Wort »Verbrechen« hatte Genet vermutlich die systematische Judenvernichtung im Auge. Sieht man vom praktizierten Rassismus ab, kann man nicht sagen, daß im deutschen Zivilleben damals das Verbrechen blühte. Wohl aber erinnern diese und ähnliche Sätze Genets an Verhältnisse in Ländern, wo Korruption herrscht und der Bürger oft vom Regen in die Traufe kommt, wenn er sich in einer Notlage an die Polizei wendet. Die Aussage Genets läßt sich eher auf solche Verhältnisse als auf den Nationalsozialismus beziehen. Was Genet fasziniert, ist die formale Austauschbarkeit gegensätzlicher – oder scheinbar gegensätzlicher – Positionen. »Diese meisterliche Synthese der Gegensätze, dieser Klotz von Wahrheit war schreckenerregend, geladen mit einem Magnetismus, der uns noch lange verstören wird.« Polizist und Verbrecher sind ein doppeltes Spiegelbild, wobei sich nicht entscheiden läßt, welches das Original ist. Beide sind selbstverständlich aufeinander angewiesen. Kommt es in der Wirklichkeit des Strafvollzugs zu Reformen, zu »Humanisierungen«, lehnt Genet diese ab, weil das System, das ihm die Entfaltung seiner Fiktion ermöglicht, dadurch in Frage gestellt wird. In Splendid’s, einem der Theaterstücke, mit denen sich Genet zur Zeit seines ersten Erfolgs nach dem Abschluß der Romanserie herumplagte (angeblich zerriß er das Exemplar, das er für das einzige hielt, in kleine Stücke), in Splendid’s hält ein auf die Gegenseite übergewechselter Polizist, also ein Verräter, einen langen Sermon. »Ich werde vom Bullen zum Gangster. Ich drehe mich um wie einen Handschuh, und ich zeige euch die andere Seite des Bullen, den Gangster. Polizei. Die Polizei! Ich war zwei Jahre dabei. Ich habe sie geliebt, Jungs, und ich liebe sie jetzt schon wieder, und zwar mit noch mehr Leidenschaft, seit ich auf Bullen geschossen habe.« (Spl 239) Edmund White attestiert dieser Stelle eine unfreiwillige Komik. Wer die Verhältnisse in gewissen Ländern der sogenannten dritten Welt kennt, wird sie nicht komisch finden.
Was Genet bestätigt, was er preist und notfalls verteidigt, sind die Machtverhältnisse, mit denen er in der Realität – in zahlreichen Ländern, nicht nur in Frankreich – Bekanntschaft geschlossen hat. Diese Verteidigung mag in den Ohren der Vertreter der Macht wie Hohn klingen, und tatsächlich enthalten die barocken Fiktionen Genets einen harten Kern, der die Verhältnisse bloßstellt, ohne sie eigentlich zu beschreiben. Im Unterschied zu Nietzsches literarischen Aufschwüngen und Andeutungen sind diese Fiktionen frei von Utopie, frei von jeder Art von Zukunftsdrang, frei auch vom Versuch des handelnden Subjekts, sich eine Vorgeschichte zurechtzulegen. Der Schwule/Bettler/Landstreicher/Gauner mag in seiner Kindheit wurzelnde Schuldgefühle mit sich herumschleppen, zu rechtfertigen hat er sich dennoch nicht, weil die Welt, die er selbst geschaffen hat und immer neu erschafft, sich selbst genügt und, leibnizianisch gesprochen, die beste von allen denkbaren ist. Wie sollte es auch anders sein, wenn sich der Autor in den Stand eines deus faber gesetzt hat? Die alternative Welt der Fiktion hebt die Gegensätze nicht auf, sondern bringt die extremen Positionen zu einer Ambivalenz, bei der es einzig und allein darum geht, sie ästhetisch und affektiv zu besetzen und ihr in der Gestaltung eine Intensität zu verleihen, die den eigentlichen Wert anstelle der »zusammengefallenen« inhaltlichen Werte ausmacht. Im Grunde ist diese Möglichkeit seit jeher in der christlichen Ethik angelegt. Ihre radikale Umsetzung stellt allerdings das System selbst in Frage, so daß der Gedanke in der Religionsgeschichte nur eine marginale Rolle spielt. Winfried Menninghaus verweist auf die Osterliturgie der römisch-katholischen Kirche, in der die felix culpa der Menschen bejubelt wird, da die Sünde ja erst die Erlösungstat Christi ermöglichen würde. (Menninghaus 543f.) Schon die Geste Christi auf dem Höhepunkt der Passion, zwei Verbrecher mit sich in den Himmel zu nehmen, ließe sich als Freibrief zum Sündigen deuten, und die Formel, wonach die Letzten die Ersten sein werden, mußte einem Umkehrungsakrobaten wie Genet ins Konzept passen, auch wenn die »Letzten« in diesem Fall nicht unbedingt Vertreter der Unterwelt sein müssen.
Im übrigen muß man gar nicht die Ekelkunst von Baudelaire über Benn bis Josef Winkler heranziehen, um zu verstehen, wie reizvoll und fruchtbar das christliche Paradox für das ästhetische Spiel sein kann. Auch bei einem »bürgerlichen« Autor wie Thomas Mann wird man fündig. Für Adrian Leverkühn, die Künstlergestalt mit Zügen Nietzsches, ist das Paradox von Sünde und Gnade ein Anlaß, die Mittelmäßigen, also die große Mehrheit, abzukanzeln. »Die Mittelmäßigkeit führt überhaupt kein theologisches Leben. Eine Sündhaftigkeit, so heillos, daß sie ihren Mann von Grund aus am Heile verzweifeln läßt, ist der wahrhafte theologische Weg zum Heil.« (Mann 390) Ästhetischer Wert, der in letzter Instanz als ein ethischer verbucht werden könnte, ist nur aus der Spannung der Extreme zu gewinnen. In den Genuß überströmender Gnade kommt nur derjenige, der sie entschieden herausfordert und ihre Quelle befehdet. Daß Manns Faustus am Ende auch an dem skizzierten Weg des Verzweifelten zweifelt, steht auf einem anderen Blatt. Im Rückblick bekennt er, er habe »einen verruchten Wettstreit mit der Güte droben« getrieben und sei wegen seiner Neigung zum Spekulieren »verdammt«. (Mann 666) Genet, wie er sich in seinen Fiktionen darstellt, zweifelt nicht an seiner Bestimmung; vielleicht nur deshalb nicht, weil ihm stets bewußt bleibt, daß sein einziger Ausweg, um ein Heil zu erlangen, das er als irdisches definiert, im Spiel mit den Werten und Machtverhältnissen liegt. In diesem, nur in diesem Sinn strebt er nach Heiligkeit. Sie ist bei weitem nicht so schwer, so unmöglich zu erlangen ist wie die Heiligkeit der »echten« Heiligen oder der verruchten gottgläubigen Künstler, denn es genügen Entschlossenheit und Konsequenz. Die Heiligkeit, sagt Genet frohgemut, »geleitet zum Himmel über den Weg der Sünde.« (WR 58) Der Heilige in der Zelle kann sich bei seinen religiösen Übungen der Phantasie überlassen wie der Schwule bei seinen kleinen Eroberungen auf öffentlichen Toiletten. Die Ausschweifung wird dem »Pervertierten« zur Tugend.
Genets realbiographische Grunderfahrung, ob sie nun den Tatsachen Rechnung trägt oder nicht, ist die des Ausgeschlossenenseins aus einer Ordnung, die er anfangs nicht ablehnt, sondern, im Gegenteil, bewundert. Das Ausgeschlossensein gipfelt im Eingeschlossensein in der Gefängniszelle, und genau darauf läuft die fiktionale – wenigstens teilweise auch die reale – Bewegung der Ich-Figur und ihrer Alter Egos hinaus: auf die Einschließung und die Umkehrung durch das Phantasieren. Genet lebte »nach einer Moral, welche der herrschenden entgegengesetzt war« (TD 200), doch die Gegensetzung (oder der Widerstand) beschränkt sich auf eine Umkehrung der Vorzeichen, wobei die furchterregende Strenge der herrschenden Ordnung nicht nur abgebildet, sondern noch überboten wird. Stilitano, der angehimmelte Kraftmensch dieses Abschnitts von Tagebuch des Diebes, ist brutal zu seiner Frau, und der Ich-Erzähler beneidet ihn um diese Gewalttätigkeit. Stilitano arbeitet mit der korrupten Polizei zusammen; die scheinbaren Gegenspieler stecken unter einer Decke: »Gemeinsam waren sie Verräter und Betrüger«, was für Genet nur ein Grund mehr ist, seiner »Gottheit aus Schlamm und Rauch« zu huldigen. Zusammen mit einem anderen Paria »dient« er Stilitano. Die Machtstrukturen in der alternativen Gesellschaft grenzen an Sklaverei (auch Nietzsche lobte gelegentlich die Sklavenhaltergesellschaft), doch die Sklaven unterwerfen sich freiwillig, ja sogar mit Freuden. »Robert und ich dienten Stilitano, wie man einem Priester dient – oder einer Artillerie-Kanone. Vor ihm kniend, schnürte jeder von uns beiden einen Schuh des Mannes zu.« (TD 154) Merkwürdig ist das Bild der Kanone, in dem Stilitano als göttliche Kriegsmaschine erscheint. Männliche Potenz und martialischer Kampf werden in diesem Vergleich kurzgeschlossen. Homosexualität vollzieht sich bei Genet in einem Feld von Macht und Gewalt. Auch in der heterosexuellen Mehrheitsgesellschaft war und ist das tendenziell so. Der kleine Unterschied liegt im Vorzeichen, in der Vorsilbe.
Nietzsches ethische Umwertung läuft auf die Affirmation – zu deutsch: Bekräftigung – des Lebens hinaus. »Leben« versteht er, durchaus im biologischen Sinn, als Körperkraft und feinere Vitalität, als Behauptung und Steigerung des Selbst, als Kampf gegen alles, was seine vitale Entfaltung behindert. Da Nietzsche seine gegenwärtige Epoche als dekadent – lebensschwach, verfallend, sterbend – beurteilte, kann sich die Affirmation nicht auf diese Epoche und schon gar nicht auf die zeitgenössische Gesellschaft, in der er Phänomene wie Demokratie und Sozialismus als Gefahren heraufdämmern sah, beziehen. Die nietzscheanische Affirmation richtet sich in eine unbestimmte Zukunft (und schielt in die Antike und Prähistorie zurück). Sie ist eher Antizipation als Affirmation, eher Idealisierung als Selbstausdruck.
In Genets Romanen ist Vitalität eine Voraussetzung, die nicht eigens thematisiert, beschworen oder herbeigeredet werden muß. Die Lebenskraft ist einfach gegeben, auch und erst recht an den Rändern der Gesellschaft, in Armut, Schmutz und moralischer Verkommenheit. Die Affirmationsleistung Genets bezieht sich auf die gesellschaftliche Organisation seiner Epoche, auf die Machtstrukturen, die am deutlichsten und härtesten im Gefängnis, in der Armee und bei Schiffsbesatzungen zum Ausdruck kommen. Im ersten Ansatz negiert sein literarisches Projekt die Verhältnisse, die den Autor und seine Hauptfiguren insofern geprägt haben, als sie sie an den Rand gedrängt oder ausgeschlossen haben. Doch die Realisierung erweist sich als Bekräftigung des Gegebenen, als Überhöhung oder, nietzscheanisch gesprochen, als Steigerung in einem geschlossenen – ästhetisierten – Bereich. Noch der Verrat, zur Tugend stilisiert und zur Gewohnheit automatisiert, gewinnt eine Berechenbarkeit, die ihn der Treue – Treue zu Prinzipien, zum Partnern usw. – ähnlich macht. Genets Biograph führt aus, wie der provokationsfreudige, auf seine Weise opportunistische Autor den französischen Antifaschisten gegenüber die Kollaboration mit den Deutschen befürwortete, den Kollaborateuren gegenüber jedoch linke Gesinnungen hervorkehrte. Daß sich in letzteren sein »wahres Gesicht als Mann der Linken« (White 261) zeigte, scheint das spätere Engagement Genets für Black Panthers und palästinensische Kämpfer zu bestätigen. Zweifel erheben sich jedoch angesichts der Tatsache, daß Genet immer wieder, von den Romanen der vierziger Jahre bis zur Prosa von Un captif amoureux, an der er in seinen letzten Lebensjahren schrieb, mit dem Antisemitismus kokettierte. Die Zweifel verstärken sich, wenn man sich entsinnt, daß Genet seinem langjährigen Freund, dem Rechtsanwalt Jacques Vergès, zustimmend schrieb, als dieser die Verteidigung des Nazi-Henkers Klaus Barbie übernahm. (White 551) Beide, Genet und Vergès, gefielen sich in der Ambivalenz, und beide sahen ihr politisches Handeln als ästhetische Gesten, als Teil eines Lebenskunstwerks. Ihr Kult von Gefahr und Gewalt erinnert an die Sehnsucht nach einem »gefährlichen Leben« jenseits des bürgerlichen Alltags, wie sie Ernst Jünger im Anfangskapitel seiner Stahlgewitter beschrieb, um seine handfesten, im Buch aber auch idealisierten Kriegserfahrungen später in den utopischen Entwurf einer »Arbeitsgesellschaft« nach militärischem Muster umzumünzen. Die gedanklichen Ursprünge dieser politisch gewordenen Sehnsucht liegen in den Schriften Nietzsches, und das Werk Genets, der diese Schriften wahrscheinlich erst nach der Abfassung seiner Romane und Theaterstücke las, ist eine, wenn auch kuriose und extreme, Blüte dieser geistesgeschichtlichen Vorgänge.
© Leopold Federmair
Verwendete Literatur.
Teil III
Die Kommentarmöglichkeit besteht im dritten und letzten Teil des Essays. (G. K.)