Jerzy Jedlicki, Jahrgang 1930, Historiker an der Polnischen Akademie der Wissenschaften und spezialisiert auf Ideengeschichte, hat mit der Aufsatzsammlung »Die entartete Welt« ein aufschlussreiches Buch vorgelegt. Sein detailreicher, aber nie erdrückender Blick auf die Ideengeschichte des 19. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg, speziell auf die Degeneration d’anglaise, deren Schilderung mehr als die Hälfte des Buches ausfüllt, ist erfrischend unaufgeregt. Da wird nicht in jedem dritten Satz eine Kontinuität in das 20. Jahrhundert hinein konstruiert, behauptet oder nachgewiesen. Jedlicki baut auf die geschichtsbewusste Kompetenz des Lesers und dessen Fähigkeit, Fäden aufzunehmen und ggf. weiterzuspinnen oder zu verwerfen.
Und wenn er – wie im Vorwort – die Brücke zur Neuzeit schlägt und feststellt, dass der Begriff der »Krise« heute gnadenlos überstrapaziert wird und dadurch seine klaren semantischen Konturen verliert, kommt dies nie als primitives Zeitgeistbashing daher – eher im Gegenteil. Jedlicki zeigt speziell am Beispiel Englands und Frankreichs, dass ungefähr seit der industriellen Revolution parallel zu den enthusiasmierten, teilweise futuristisch oder anderswie ideologisch beeinflussten Fortschrittsgläubigen und –hörigen heterogene Gegenbewegungen hervortreten, die in einer Mischung zwischen historisch argumentierendem Geschichtspessimismus, verzweifelten Restaurationsbemühungen (insbesondere der Romantiker, die Jedlinki als Gegenaufklärer begreift und mit denen er vergleichsweise scharf ins Gericht geht) und nihilistischen Weltuntergangsprophezeiungen das mehr oder weniger baldige Ende der Zivilisation und/oder Kultur befürchten (gelegentlich auch herbei zu beschwören scheinen).
Der »Diskurs über die Krise« beginnt mit der Aufklärung
Zwar wird auf hohem Niveau die praktisch seit Existenz der Schriftkultur messbare Zivilisationskritik in vielen (westlichen) Kulturen erläutert, Jedlicki plädiert aber nachdrücklich für eine klare zeitliche Abgrenzung des Diskurses über die Krise. Von dem Zeitpunkt an, als die Menschen auf den Gedanken kommen und das Bewusstsein entwickeln selbst ihre Geschichte [zu] machen, also in dem Moment, als die Verantwortung des Menschengeschlechts oder zumindest seiner aufgeklärten Führer für diese Zivilisation und für Europa anerkannt wird, beginnt das, was er zusammengefasst Degeneration…der Fortschrittsidee nennt.
Diese beginnt also mit der Aufklärung (und dem damit verbundenen sukzessiven Zurückweichen der Religionen) Ende des 18./Anfang des 19. Jahrhunderts. Sie ist unweigerlich mit der zunehmenden, später rasant sich entwickelnden Industrialisierung verbunden, dem mechanischen Zeitalter, und wird durch sie befeuert. Einer der ersten, die im Menschen das »entartete Tier« sahen, war Rousseau. Auch für Schiller galt die »geistige Aufklärung« bereits als Verderbnis. Für andere war der Mensch des Fortschritts eine »moralisch recht primitive Spezies« mit »schier unglaublichem« – primär destruktiv empfundenen – »Potential«.
Die Zitate, die Jedlicki von den nachfolgenden Katastrophisten und Utopisten, den Apokalyptikern mit ihren negativen Obsessionen, den Kritikern von Ökonomie und Industrialisierung bringt, sind teilweise derart »aktuell«, dass sie – mit kleinen Abänderungen – auch heute noch mühelos in kapitalistisch-kulturkritische Feuilletons übernommen werden könnten. Ein Höhepunkt dieser Ideengeschichte ist natürlich Oswald Spengler und dessen »Untergang des Abendlandes«. Hier verband sich das schwülstige, großsprecherische Pathos der deutschen Geschichtsromantik – deren harter, nietzscheanischer Variante jegliche Sentimentalität abging – mit dem prophetischen Grössenwahn eines Mannes, der absolut davon überzeugt schien, sein Werk löse alle Rätsel der Menschheitsgeschichte. Jedlicki greift hier eine der wenigen Male wertend ein. Er sieht den (kurzzeitigen [wirklich?]) Erfolg des Buches sowohl in dem Moment der ersten Veröffentlichung (der erste Band erschien 1918) als auch in einer Mischung eines Mythos vom Untergang des Abendlandes, einer Beschwörung preussische[r] Härte und mitreissende[m] Stil – kann aber mit dem Resultat wenig anfangen und hält das Buch letztlich für eklektizistisch an alte Thesen andockend, die entsprechend pointiert vorgebracht wurden.
Ein kultureller Wert in sich: unablässige Selbstkritik
Als Résumé des Aufsatzes »Drei Jahrhunderte Verzweiflung« ergreift Jedlicki dann emphatisch Partei für die Zweifler und Grübler – ohne das Geschäft der Hysteriker betreiben zu wollen: Die wie auch immer definierte Krise der Kultur ist nicht die Ausnahme, sondern ihr Normalzustand…Das ist auch gut so – erwächst doch jeder Fortschritt aus Unglück, Entsetzen und Auflehnung. Aus der Auflehnung gegen die Hilflosigkeit der Menschen angesichts der Pest entstand die Medizin. Aus dem Entsetzen, dass sich unser Globus in eine stinkende Kloake verwandelt, entstanden die Umweltbewegung und ihre Erfolge. Aus dem Einspruch gegen Unterdrückung und Erniedrigung entstanden die Menschenrechte und die Humanität der Strafgesetzgebung. Aus dem Gefühl der Wertekrise entsteht der Wille zur Verteidigung dieser Werte, der nur dann zu einer Bedrohung wird, wenn er nach Perfektion strebt. Hierfür entwickelt Jedlicki den Topos der segensreichen Krise.
Weiter: Dieser kontinuierliche Disput über die Gebrechen des Jahrhunderts, die moralischen Mängel der Moderne, die geistige Leere der technologischen Gesellschaft [mag] zwar gelegentlich monoton, naiv, voller Klischees und Stereotype sein, ist jedoch – laut Jedlicki – ein kultureller Wert in sich. Freilich verwirft er eine Regression in einen »Hoffnungsglauben« aus Religionen. Das wäre erst recht der Tod der europäischen Kultur, zu deren schönsten und hoffentlich unveräusserlichen Eigenschaften ihre unablässige Selbstkritik gehört.
Und in dem Essay »Das negative Stereotyp des Westens«, in dem Jedlicki die Interdependenzen zwischen der englischen und französischen Moderne auf der einen Seite und der Ablehnung dieser durch grosse Teile der polnischen Intelligenz auf der anderen Seite untersucht (man bekommt hier und in dem Beitrag »Der Prozeß gegen die Stadt« sehr schön auf knappstem Raum eine Übersicht über die polnische Gemütslage rekurrierend aus den historischen Traumata und gipfelnd noch heute in zyklisch auftretenden antimodernistischen und nationalistischen Phasen) steht am Ende, dass unablässige Selbstkritik und Selbstzweifel konstante Merkmale der westlichen Kultur sind. Seit fast dreihundert Jahren (hier widerspricht sich der Autor ein bisschen) nehmen die Zeitgenossen (und nicht nur die Historiker) ihre Zeit auch als eine Epoche der Krise, der fundamentalen Erschütterung der gesellschaftlichen Ordnung und der moralischen Werte wahr. Man kann sagen, so Jedlicki, dass die permanente Krise der Aggregatzustand der neuzeitlichen wissenschaftlich-technischen Zivilisation ist, die niemals einen Zustand des Gleichgewichts oder der Stabilisierung ihrer Institutionen, Theorien und Praktiken erreicht.
Optimismus und Angst
Sehr informativ dann der bereits angesprochene, umfangreiche Beitrag über die »Degeneration d’anglaise«. Jedlicki beschreibt von Anfang des 19. Jahrhunderts beginnend chronologisch und dezidiert die unterschiedlichen, kulturkritischen Strömungen hauptsächlich Englands – mit kleinen Ausflügen auf das französische Festland. Selbst auf dem Höhepunkt des viktorianischen Fortschrittsoptimismus wuchterten die Ängste und Obsessionen. Parallel zum Enthusiasmus wachsender Industrialisierung wuchsen die Abneigungen gegen diese Entwicklungen (die Worte begannen fast alle mit »De und sie werden akribisch aufgezählt).
Da gab es diejenigen, welche die Arbeiter als entwürdigt und degradiert betrachten (was dann später im Marxismus gipfelte); die (diesem Denken verwandten) Ängste der Philosophen; die Kritik eines William Morris, der die Wissenschaft (gemeint sind die Naturwissenschaften im weitesten Sinn) zur Sklavin eines widerlichen Buchhalter-, Drill- und Zwangssystems sah; die unterschiedlichen Interpretationen des Darwinismus (inklusive der Ablehnung desselben und der »Weiterentwicklung« zum »Sozialdarwinismus«); der Vorbehalte selbst honoriger Philosophen, Politiker und Intellektueller gegen das allgemeine Wahlrecht (die Ängste vor dem »Pöbel«; der Masse und deren Mitbestimmung); die teilweise hellsichtigen Prognosen von John Stuart Mill in Bezug bezüglich Massenkultur und Journalismus (das Aufkommen der Boulevard-Presse!); Aldous Huxleys Kritik eines ethischen Darwinismus; die Anfänge dessen, was man später als »Eugenik« bezeichnete – der Begriff, der damals jedoch eine ganz andere Konnotation hatte – kurz: Jedlicki fächert all die divergierenden Strömungen, Tendenzen und Ängste auf, widmet sich auch ausführlich der Bedeutung des Prozesses gegen Oscar Wilde und dessen Leiden an der Gesellschaft, referiert über Toynbees »neuem Liberalismus« (der das Gegenteil dessen ist, was wir heute darunter verstehen), zeigt die Dekadenz und die gefühlte Degeneration Frankreichs seit 1870 und streift den aufkommenden Anarchismus (und diese kursorischen Aufzählungen sind abermals nur ein Ausschnitt).
Exemplarisch: »Entartung« von Max Nordau
»Entartung« hiess das Buch von Max Nordau (1895 in Englisch erschienen; zwei Jahre vorher auf Deutsch), welches Jedlicki zum Beispiel ausführlich bespricht. Nordau, Arzt, Schriftsteller, Literaturkritiker und Publizist, in Budapest geboren, lebte in Paris und schrieb auf Deutsch. Er war einer der Mitbegründer der zionistischen Weltorganisation. Nordau ist voller Bewunderung für die Erfolge der Naturwissenschaften und er war der Meinung, das »Fin de siècle«-Gefühl sei eine Stimmungslage übersättigter Greise, die die Jugend um ihre Frische und Lebensfreude beneiden und daher versuchen, sie mit ihrem Pessimismus zu vergiften. Nordaus Furor richtet sich gegen alle Künstler, die mit …der Affirmation des Fortschritts in der Kulturphilosophie gebrochen hatten, begonnen mit Baudelaire, Gautier, Mallarmé, aber auch Verlaine, Tolstoi und Wagner, Wilde, Ibsen, Zola, Hauptmann, und viele andere. In dieser Atmosphäre, so Jedlicki über Noraus Buch blüht eine entartete, selbstverliebte Kunst – alle möglichen Mystizismen, Symbolismen, Pessimismen und Diabolismen. Nordau sah eine »geistige Volkskrankheit«, eine »Art schwarze Pest von Entartung und Hysterie«, sein Buch sei eine »Wanderung durch das Krankenhaus«, wobei mit »Krankenhaus« die gesamte europäische Kultur des Jahrhundertendes gemeint ist.
Man ist schon geneigt, dieses Machwerk in den Orkus zu verbannen, aber Nordau schloss seine Ausführungen mit einem furiosen Manifest, das ihn als Liberalen alten Stils zeigt: »Wir besonders, die es uns zur Lebensaufgabe gemacht haben, alten Aberglauben zu bekämpfen, Aufklärung zu verbreiten, geschichtliche Ruinen vollends niederzureißen und ihren Schutt wegzuräumen, die Freiheit des Individuums gegen den Druck des Staates und der gedankenlosen Philister-Routine zu vertheidigen, wir müssen uns entschlossen dagegen wehren, daß elende Streber sich unserer theuersten Losungsworte bemächtigen, um mit ihnen Bauernfängerei zu treiben. Die ‚Freiheit‘ und ‚Modernität‘, der ‚Fortschritt‘ und die ‚Wahrheit‘ dieser Bursche[n] sind nicht die unsrigen [… ] Daran mag Jeder die echten Modernen erkennen und von den Schwindlern, die ich Moderne nennen, sicher unterscheiden: wer ihm Zuchtlosigkeit predigt, der ist ein Feind des Fortschritts und wer sein Ich anbetet, der ist ein Feind der Gesellschaft. […] Die Emanzipation, für die wir wirken, ist die des Urtheils, nicht die der Begierden«.
Nordaus Buch galt vielen damals als eines der wichtigsten Dokumente des europäischen »Fin de siècle« – und ist heute vergessen, allerdings aus einem Grund: Es ist eben gerade nicht »gängig« fortschrittskritisch, vielfach strukturkonservativ und individualismusfeindlich und dadurch nicht eindeutig »zuzuordnen«. Einhundert Jahre später waren die von Nordau kritisierten Künstler und Schriftsteller kanonisiert – und der Kritiker widerlegt.
Bittere Genugtuung
Unter Zitation etlicher solcher nur Experten bekannten Werke wird deutlich, wie differenziert und vor allem kompliziert die Materie im Detail ist. Da ist nicht jeder, der das Wort »Neger« benutzt automatisch schon ein Rassist. Und nicht jeder, der in Wohltönen den Kapitalismus besingt und die Chancen ausmalt (und verklärt) per se ein Ausbeuter. Tatsache ist: Moderate Kritiken, wie die von Charles M. Pearson, die sich kritisch aber nicht destruktiv mit der Kultur auseinandersetzten und auch nicht einer gewissen Exaltiertheit anheim fielen, sind heute unbekannt – entweder wegen ihrer »mangelnden Originalität«, oder weil sie – für uns heute – schlichtweg auf der »falschen Seite« standen.
Jerzy Jedlickis zitiert aus vielen unterschiedlichen Schriften, ohne erhobenem Zeigefinger (ausser – gelegentlich einmal – bei denen, die schon damals alles besser wussten), so dass der Leser manchmal das Gefühl einer Art Zeitreise hat. Eines der (vielen) kleinen Pretiosen in seinem Buch ist die Analyse des Romans »Die Zeitmaschine« des heute noch bekannten Romanciers H. G. Wells.
Und fast am Ende dieses Essays heisst es: Der alte Traum der Liberalen, die Massen durch Bildung und Verbesserung der Lebensbedingungen schrittweise auf die Teilhabe an Kultur und Bürgerrechten vorzubereiten, [ging] auf ironische Weise in Erfüllung: in Form einer vom Kommerz entwerteten Kultur und einer von Demagogie korrumpierten Politik. Selbst der Sport […] unterlag der Kommerzialisierung […]. Die Propheten des Niedergang hatten ihre bittere Genugtuung – hatten sie es doch schon immer gewusst.
Alleine Jedlickis kurzer Aufsatz über Geschichte und Ausblick des europäischen Intellektuellen würde schon die Anschaffung des Buches lohnen. Insgesamt ist »Die entartete Welt« lehrreich, klug und verständlich geschrieben, dabei aber keinesfalls trivial. Wohltuend, dass der Autor jedem affektierten Alarmismus abschwört, aber im Zweifel für den Zweifel Partei ergreift. Jeder, der seine Weltuntergangsprophezeiungen noch »perfektionieren« möchte, sollte hier erst einmal nachschlagen – es gibt fast nichts, was nicht schon vor einhundert oder einhundertfünfzig Jahren prognostiziert wurde.
Alle kursiv gedruckten Stellen sind Zitate aus dem besprochenen Buch.
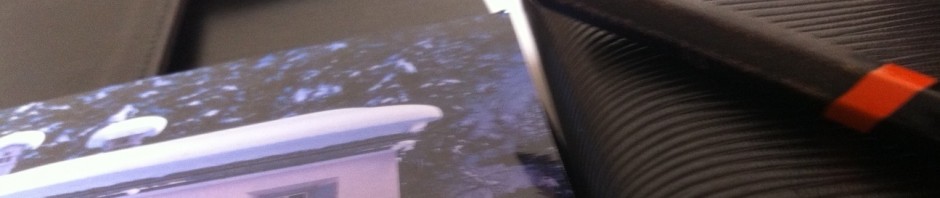
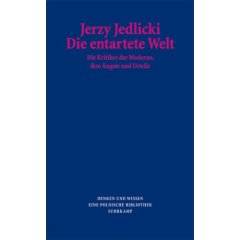


















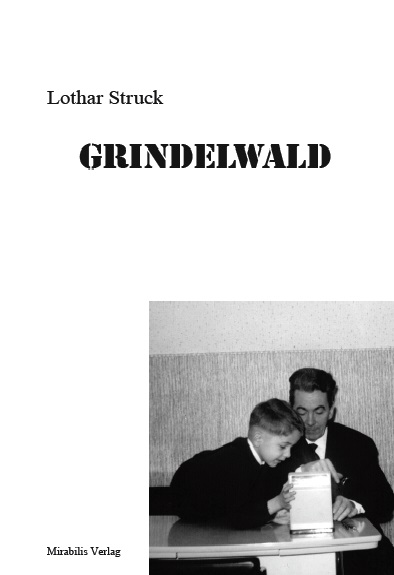
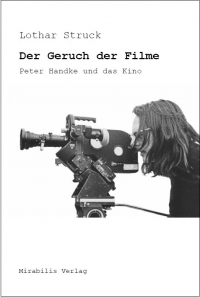
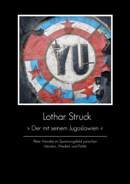

Danke, ein sehr spannender Beitrag. Salopp zusammenfassend: Eine meiner Grundüberzeugungen: Die »Krise« ist immer da besonders schmerzhaft, wo wir sind – und das ist oft auch gut so, sonst wären wir individuell, mikro- und makrosoziologisch betrachtet auf der Stelle erstarrt … wird hier wunderbar in Beispielen historisch ausgeführt auf die ich so nicht gekommen wäre … eine perfekte Argumentationshilfe …;
Oder ganz kurz: Nur aus wahrgenommener Krise oder antizipiertem Krisenpotential entsteht Bewegung … manchmal allerdings leider auch negative ..
#1
Nun, Krisengeschrei hin oder her: es könnte doch auch sein, daß der schon so oft prognostizierte Untergang in den Augen derer, die ihn prognostizierten, längst stattgefunden hat, wir also (wieder in den Augen der Prognostizierenden) bereits in einer postapokalyptischen Zeit leben. Es kommt immer darauf an, was man unter dem Untergang versteht, welche Ereignisse und Veränderungen bereits diesen Titel verdienen.
#2
Erinnert mich an den beliebten Spruch – ‚«Gestern standen wir noch vor dem Abgrund – heute sind wir schon einen Schritt weiter« ,) (und plumps ;) .. alles eine Frage der Defintion/Perspektive …
#3
Das ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil des Krisendiskurses: Nicht nur die Prognose, sondern das Beschreiben des aktuellen Zustands. Freilich leben die Untergangspropheten von einer Drohkulisse, d. h. es wird immer noch »schlimmer« kommen, als es jetzt ist.
In diesem Zusammenhang ist interessant, dass langfristig die Pragmatiker, d. h. diejenigen, die zwar u. U. eine gewisse Krisenhaftigkeit erkannt haben, aber immanent gegensteuerten, den Apokalyptikern und auch den »Romantikern« überlegen sind. Allerdings nicht in der öffentlichen Wahrnehmung – da wird der Diskurs immer von den jeweiligen Antipoden dominiert.
#4
.. mediensoziologisch ist das das klassische Newswert-Thema: Je überraschender eine Neuigkeit die dennoch auf einem bekannten Thema aufsetzt (weitergedacht gilt das auch für: je extremer eine Theorie), um so größer die Wahrscheinlichkeit, dass sie es schafft, aus dem Themendschungel aufzutauchen und Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen … + (zynisch ich gebe es zu) die Provokationen lassen sich in Schlagzeilen und Slogans fassen, bei den pragmatischen Standpunkten muss man immer so »lästig« viel erklären … ,)
#5
Das meinte ich nicht. Im Augenblick, da sie die Wirklichkeit des Untergangs erkennen, schweigen die von mir angesprochenen Progostizierer. Es gibt ja nichts mehr zu Warnen, es bleibt nur der (aussichtslose) Protest. Was ich meinte ist: Daß es Untergänge gibt, die, außer in den Augen der Propheten, unsichtbar bleiben, oder nicht als Untergänge erkennbar werden.
#6
Jedlicki meint allerdings – wenn ich ihn richtig interpretiere -, dass die prognostizierten Untergänge (der Moderne) eher nicht stattgefunden haben. Das ist zum Teil ein Verdienst des Krisendiskurses, der gewisse Entwicklungen antizipierte.
#7
Selbstkritik vs. Kritik
Geht es Jedlicki eigentlich nur um Selbstkritik, oder um Kritik im allgemeinen? Selbstkritik bedarf doch immer der Ergänzung durch die Kritik eines/der anderen, sonst läuft sie in Gefahr blinde Flecken zu übersehen. Warum also nicht: unablässige Kritik als kultureller Wert an sich.
#8
Ich glaube,
die Grenzen zwischen Selbstkritik und Kritik sind fliessend, wobei vielleicht Selbstkritik eher schon eine gewisse Akzeptanz impliziert. Die reine Kritik an der Moderne, der »Zivilisation«, kommt bei Jedlickis Betrachtungen natürlich auch vor, insbesondere, was die restaurativen Kräfte angeht oder die Apokalyptiker.
#9
Jedlickis Buch, vor allem der angesprochene Aufsatz über Geschichte und Ausblick der europäischen Intellektuellen erscheint mir auch aus postmoderner Perspektive eine vielversprechende Lektüre. Ich suche gelegentlich, aber schon seit längerem immer wieder Parallelen zwischen der selbstlähmenden Ablehnung »großer Erzählungen« und objektiver Erkenntnisse einerseits und der kulturpessimsitischen Rückzugshaltung der frz. Décadence andererseits. Aus beidem – vor allem den postmodernen Variationen – kann ich stellenweise nicht mehr als intellektuellen Reaktionismus herauslesen. Jedlickis Relativierung dieser Kritik unter dem Begriff der segensreichen Krise, die man dem gefühlten Untergang gesellschaftlicher Eliten gegenüberstellen kann, ist da ein sehr schöner, feinfühliger Zug. Und doch frage ich mich, ob Jedlickis seinen Horizont nicht doch zu eng abgesteckt hat. Die dramatisierten Untergangsstimmen waren und sind europäische Stimmen, die über Europa lamentieren. Die unvollendete Projekte der Aufkläung und Moderne – samt ihrer befürchteten Ab- und Umbrüche – haben allerdings auch weitreichende Konsequenzen für die Neuordnung der Welt außerhalb Europas bedeutet – Konsequenzen wie den Imperialismus, die wohl kaum jemand als segensreich bezeichnen dürfte. Diese postkoloniale Perspektive, diese weiterreichende Relativierung europäischer Ängste gegenüber der tatsächlichen Reichweite Europas fehlt mir hier, oder irre ich mich?
#10
Zu eng gesteckt?
Schwer zu sagen. Natürlich beschränkt sich Jedlicki in der Darstellung primär der englischen und ein bisschen der französischen Philosophie und Politik der damaligen Zeit. Gelegentlich fliesst ein bisschen Nietzsche und natürlich Spengler ein. Ich vermag diese Fokussierung nur dann jemandem vorzuwerfen, wenn er den Anspruch erheben würde, ein umfassendes Bild zeichnen zu wollen – das negiert Jedlicki allerdings ausdrücklich.
Insofern ist diese Betrachtungsweise natürlich ein bisschen eurozentristisch.
#11