Nachdem die Hörer des Deutschlandfunks am 19.3. schon Stefan Austs Meinung über den Schulz-Hype im Interview erklärt bekamen, folgte zwei Tage später ein Gespräch mit ihm über den Journalismus und den »Wahrheits«-Begriff.1 Aust, Herausgeber und Chefredakteur der Tageszeitung Die Welt und demzufolge immer noch an zentraler Stelle des deutschen Journalismus, bekennt, dass er ein Problem mit diesem Begriff habe. Dieser ist allerdings nicht philosophisch gemeint, sondern, so Aust, liegt darin begründet, dass man viele Informationen auf unterschiedliche Art interpretieren könne. Es sei immer im Auge des Betrachters, wie man etwas sehe. Demzufolge, so die Schlussfolgerung, kann es keine »Wahrheit« geben bzw. der Wahrheitsbegriff sei dehnbar.
Die Äußerung ist interessant, weil sie das Grunddilemma des Journalismus auf den Punkt bringt. Aust ist mit dieser Sicht nicht alleine. Auch ein Roland Tichy (der mit Aust außer seiner Profession nicht viel gemeinsam haben dürfte) vertritt diese These: Ein Journalist informiert sich über einen Sachverhalt und bewertet diesen. Diesen Extrakt publiziert er dann.
Ersetzt man den Begriff »Wahrheit« durch »Fakten«, so offenbart sich der Trugschluss – und das nicht erst nach Ausrufung des postfaktischen Zeitalters. Wer »Wahrheiten« oder »Fakten« nur als Interpretationsknetmasse von Sachverhalten begreift, kann auch irgendwann behaupten die Erde sei eine Scheibe oder bei ein Ereignis habe gar nicht bzw. nicht im tradierten Maße stattgefunden. Da es keine »Wahrheit« gibt, braucht er (sie) auch dafür keinerlei Belege anzubringen. Aust geht davon aus, dass Journalisten die ihnen bekannten Sachverhalte stets auch immer interpretieren, also mit einer Deutung und demzufolge auch Meinung versehen. Journalistische Pluralität zeichnet sich dadurch aus, dass es möglichst viele (divergierende) Interpretationen gibt.
Der Rezipient entscheidet demzufolge am Ende, welche (journalistische) Deutung er bevorzugt. Die Kriterien obliegen dabei vollständig bei ihm und sind selber wiederum höchst subjektiv. Vielleicht mag er den einen Journalisten lieber als die andere Journalistin. Oder die Bewertung von X passt besser in sein Weltbild als die von Y. Im Zweifel hat er kaum genügend Zeit, sich alle oder sehr viele unterschiedliche Deutungsangebote zu beschaffen.
Wie fatal ein solches Handeln ist, zeigt sich immer in Extremsituationen wie beispielsweise Kriegsberichterstattungen. Wer verübt sogenannte Kriegsverbrechen? Wer hat welche Kriegsgründe? Welches Videomaterial wird für die Deutung herangezogen? Die Frageliste ließe sich noch beliebig erweitern. Gerade solche Fragen sind von Journalisten in der Regel nie aus der jeweiligen Lage heraus zu beurteilen. Sie sind immer auch Deutungen. Wenn allerdings die Fakten nicht von den Deutungen expressis verbis unterschieden werden, wird der Rezipient am Ende auch manipuliert. Und er kann nicht mehr unterscheiden, was Meinung und was (halbwegs) gesichertes Faktum ist.
Journalisten sollen verbreiten »was ist und was man sieht«, so Aust. Dass dies ein Unterschied sein könnte, kommt ihm nicht in den Sinn. Glücklicherweise fällt ihm noch ein, dass der Schreiber »möglichst durchsichtig […] machen« müsse, »wie man zu diesen Informationen gekommen ist« aber »nicht die Messlatte allzu hoch setzen« solle. Also dann ist etwas vielleicht »ein bisschen« faktisch? Und was, wenn er nur schreiben kann, er habe es »gesehen«? Was bedeutet eigentlich »was man sieht«? Die Übertragung der Brutkastenlüge und die Berichterstattung hierüber war sicherlich nach den »Aust-Regeln« korrekt. Dennoch wurde eine Lüge verbreitet, die einen Krieg rechtfertigen sollte. Und wenn Journalisten zu Ortsterminen in Kriegsgebieten eingeladen werden, können sie sicher sein, dass das, was sie sehen sollen, entsprechend arrangiert ist. Aber es bedeutet nicht, dass es sich um Fakten handelt. In diesen Fällen können Journalisten nicht anders als »berichten«; jede Interpretation wäre Spekulation. Aber der Konjunktiv ist nun mal für beide Seiten – Journalisten und Rezipienten – auf Dauer unbefriedigend. Und dann gibt es ja noch den journalistischen Herdentrieb. Es ist kein Zufall, dass die Skepsis an den Medien immer dann am größten ist, wenn die Massenmedien einen homogenen Meinungsstrom erzeugen.
Aust entkommt dem Dilemma auch nicht dadurch, dass er mehr Selbstbewusstsein für die Branche einfordert und postuliert, man solle sich von »Lügenpresse«-Vorwürfen nicht einschüchtern lassen. Mein Eindruck ist, dass das Selbstbewusstsein immer noch sehr stabil vorhanden ist. Anders sind die permanenten Selbstdeklarationen als »Qualitätsmedien« nicht zu erklären. Und unlängst feierte sich die Branche selber und es gab Goldene Kameras für Nachrichtensendungen.
Der Rest ist das übliche Bashing auf das Internet, so als gebe es die »Sau-durchs-Dorf-Treiber« nur bei den anderen. Immerhin: Am Ende rekurriert er dann doch wieder auf den Fakten-Journalismus. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass man schon einmal weiter war.
Bis 27.9.2017 im Netz verfügbar. ↩
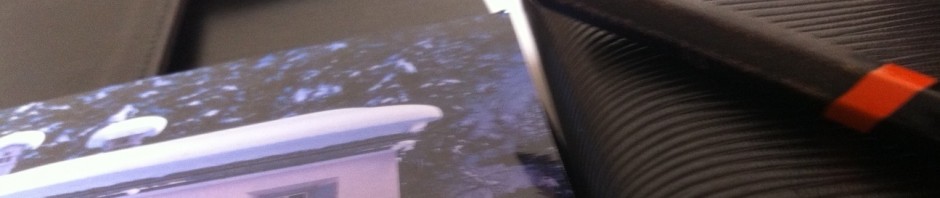


















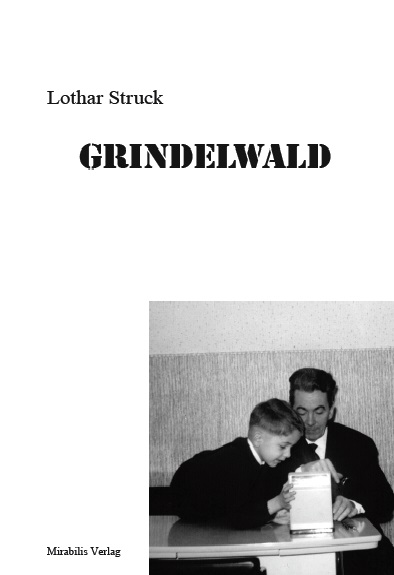
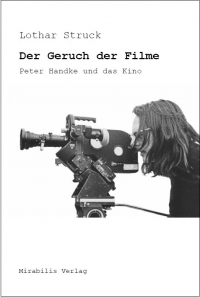
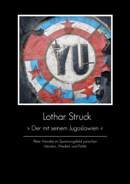
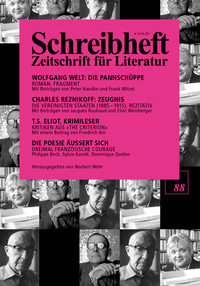
Aust hat schon recht, wenn er den Wahrheits-Begriff zur Disposition stellt, schließlich sind alle epistemischen Verwirrungen der letzten tausend Jahre damit konnotiert. Auf diese Diskussion will man sich ja schließlich nicht einlassen.
Aber eine Eigenart der Kommunikation besteht darin, dass man »der anderen Seite« einen großen Spielraum für Annahmen, Setzungen, Implizitheiten einräumen muss, und daher lässt sich der psychologische Kommunikations-Begriff so schlecht auf Medien oder »Pressesprecher« anwenden.
Sprich: Kommunikation ist ein Spaß für Jung und Alt, aber wehe es geht um etwas, wie z.Bsp. Geld, Ansehen, oder Macht. Da sieht es dann gleich ziemlich düster aus.
Alternative Fakten sind nichts anderes als eine Konfrontation mit einer anderen Meinung, das ist keine völlig neue Erfindung. Allein die Formulierung ist wunderbar ironisch.
Der Spagat, den der politische Journalismus leistet, ist eindeutig zu groß: man möchte sprachlich klar und vertrauenswürdig rüberkommen, wie zuhause am Küchentisch, aber man »kommuniziert« ständig heiße Ware, eben Geld, Ansehen und Macht. Beides ist unvereinbar, es bleibt ein Spannungsverhältnis übrig, und das resultiert nicht von der Möglichkeit der Unwahrheit. Das resultiert von den Konsequenzen des Irrtums. Schließlich ist Macht auf der Dichotomie von Vertrauen und Misstrauen errichtet. Da kann ein Irrtum gewaltige Folgen haben. Am Küchentisch hat er das in der Regel nicht.
#1
Dass der Point of View ebenso so gefährlich ist, wie eine Falschmeldung, hatte der Guardian schon 1986 in seiner berühmt gewordenen Werbung gezeigt. Von TAZ, FAZ, Zeit oder Welt auch nur ansatzweise The whole picture zu erwarten, erscheint mir völlig absurd. Einer Quelle traue ich schon lange nicht mehr, erst viele Puzzlesteine ergeben ein Bild. Gerade bei »homogenem Meinungsstrom« findet man manchmal abseitig Anstöße, um weiter zu recherchieren. Ich bin mir da auch nicht zu schade z.B. RT oder PI zu konsultieren. Selbst so kann man zu dem ein oder anderen Ah-Erlebnis kommen. Das vorher Gesagte konterkarierend, finde ich es manchmal geradezu irritierend, wenn auf SPON mehrere sich widersprechende Artikel gleichzeitig online gehen. Der Wahrheit nahe zu kommen, ist harte Arbeit.
#2