Vom Zaudern der Anfänger und Zauber des Anfangs
Hermann Hesses Gedicht „Stufen“ kennt fast jeder, vor allem die Zeilen
„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, / Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.“
Mit ihrer – ja, was? – Handreichung und Einführung ins autobiografische Schreiben, vor allem aber auch mit ihren vielen kleinen Erzählungen und Erinnerungen macht Doris Dörrie vor, dass der nie endende Weg ins literarische Schreiben mit ersten Notizen zum eigenen Leben beginnen könnte.
Gegen die hochstapelnden Versprechen umsatzfixierter Kreativitätsapologeten plädiert Dörrie jedoch ungleich bescheidener dafür, erst einmal die Lust am Schreiben überhaupt wiederzugewinnen, das Vertrauen in die eigenen Ausdrucksmöglichkeiten neu zu entdecken, Fantasie wie sprachliches Können behutsam zu entwickeln, Und dann auch auszuhalten, was so zu Sprache und Bewusstsein kommt, das Glück, den Schmerz, die Angst und die Hoffnung.
Schritt für Schritt üben: das rechte Maß mit rechtem Mut
Dörrie empfiehlt eindringlich, den inneren Zensor zunächst rigoros auszuschließen, dazu vor allem das Stimmengewirr von Lehrern, Literaturkritikern oder eifersüchtigen Schriftstellern, die oft allein zu wissen glauben oder verklären möchten, wie das geht: ein von der eigenen Biografie ausgehendes Schreiben, das ins Literarische führen könnte.
Doris Dörrie selbst allerdings macht nie den Fehler, Schreiben und Literatur, Schreiben und Veröffentlichen allzu schnell gleichzusetzen. Über den Vergleich der Ergebnisse erster Schreibversuche mit meisterhaften Texten der Weltliteratur ließe sich noch so ziemlich jeder Schreibnovize schnell mundtot machen, ob begabt oder nicht. Dörrie interessiert zunächst nur der Prozess des Schreibens, d. h. wie das ist, sich selbst schreibend auf die Spur zu kommen:
„Es geht hier nicht darum (...) Literaturpreise zu gewinnen, sondern darum, aufmerksam und vorurteilsfrei dem eigenen Gehirn zuzuschauen und zuzuhören. Was dort wild aufflackert, aufzuschreiben. In all seiner Banalität und Komplexität, denn das gehört zusammen.“
Den Alltag des Schreibens üben
Dörrie ist selbstverständlich viel zu klug, um etwas gegen kritische Reflexion zu haben. Aber eben alles zu seiner Zeit. Für den Anfang schlägt sie tägliche Etüden in einer Art Écriture automatique vor, die offensichtlich auf die Surrealisten zurückgeht.
„Der Schlüssel zum Schreiben ist, nicht nachzudenken, um die Inspiration nicht zu unterbrechen. (...)
Dafür drei Regeln:
1. Schreib zehn Minuten ohne Pause. Am besten mit der Hand. Lass dich treiben.
2. Denk nicht nach. (Wenn man zu viel nachdenkt, hört man prompt auf zu schreiben.)
3. Kontrollier nicht, was du schreibst. Mach Schreibfehler, Grammatikfehler, schreib Blödsinn.“
Doris Dörries Buch verblüfft nicht zuletzt mit über 50 Schreibanregungen, die von ihr zwar als Imperative ohne Ausrufezeichen formuliert werden, aber letztlich ein Set von Starthilfekabeln anbieten, die allesamt dabei helfen können, die Erinnerungs- und Fantasiemotoren der Schreibwilligen ans Laufen zu kriegen. Unter diesen Anregungen darf jede/r selbst aussuchen, was anregt, je nach Temperament, Lebenslage, aktueller Befindlichkeit. Ein vordergründig unscheinbares „Schreib über deine Mutter“ könnte ebensolche Zündfunken in sich tragen wie das sprachspielerische „Schreib über Wörter, die sonst niemand gebraucht“.
„Alles kann zum Schreiben inspirieren. Alles an das eigene Leben erinnern. (...) Und ich habe keinen Rat, nur die Praxis des täglichen Schreibens und wilden Assoziierens. In den verzweigten Stollen der eigenen Erinnerung graben, kratzen, schürfen: Manchmal findet man ein Goldnugget. Manchmal auch nur ein altes, vergammeltes Chicken-Nugget.“
Die Unzuverlässigkeit des Erinnerns und die Macht der Fantasie
Ganz nebenbei erzählt Doris Dörrie auch davon, wie wir unsere Erinnerungen konstruieren, zurechtbiegen, umdeuten. Dennoch bleibt diese Erinnerung, das Pfund, mit dem es zu wuchern gilt. In ihr verborgen liegen Bilder, Gerüche, Figuren, Glücksmomente oder Abgründe, Verdrängtes und Vergessenes ebenso wie Aufbrüche ins Fantastische. Dörrie spricht sich dezidiert fürs Übertreiben und Lügen aus; wer kennt sie nicht, den messerscharfen Übertreibungskünstler Thomas Bernhard oder die herrlichen Geschichten von Münchhausen bis Käpt’n Blaubär. Dörrie öffnet gern den Horizont vom Erlebten ins Ersehnte, vom Wirklichen zum Möglichen. Mit dem Erinnern beginnt bei ihr alles, doch muss damit nichts enden. Wir alle sind multiple Persönlichkeiten, nehmen viele Rollen ein, probieren Identitäten und Sprachen aus. Übers Erinnern hinaus brechen wir auf ins Universum der Geschichten, diesen „Kosmos menschlicher Erfahrungen, den es immer neu zu füllen gilt“. Einzigartigkeit und das große Ganze gehören da ebenso zusammen wie Widersprüchlichkeit und Veränderung.
Machen Muster Mut?
Eine kritische Anmerkung habe ich dann doch an Dörries Anleitungs- und Kurzgeschichtensammlung. Dass Doris Dörrie eine wunderbare Erzählerin ist, hat sie über ihre Bücher und Filme oft bewiesen. Und sie beweist es im vorliegenden Buch erneut. Zwar geht sie in ihren Texten durchaus auf die Entstehung ebendieser Texte ein, macht so den Prozess des oft auch holprigen Schreibens transparent und nachvollziehbar, doch im Ergebnis sind ihre Meister- und Mustererzählungen immer hochkomplex, doppelbödig, voller Erfahrungs- und Sprachreichtum.
Macht deren Lektüre also den Schreibanfängern, an die sich Dörries Buch wendet, nun eher Mut zum Selberschreiben oder rückt sich das Vorbild Dörrie in so unerreichbare Ferne, dass man letztlich auch ihrem flotten Motivationstraining zu misstrauen beginnt? Eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Immerhin aber kann ich eine Erfahrung beisteuern. Ich selbst saß neben der Lektüre von „Leben Schreiben Atmen“ auch an einer Geschichte für eine Anthologie. Tatsächlich gaben mir Dörries Ermunterungen dabei die Lizenz, erneut frischen Anfängergeist zu entwickeln, Spontaneität zuzulassen und gleichzeitig mich selbst und mein Schreiben ernst zu nehmen, also nicht gleich die Schere im Kopf bei jedem Satz zuschnappen zu lassen. Immerhin.
Mit Fontane auf ins weite Feld der Sprache
Dörries „Einladung zum Schreiben“ ist in der Tat eine weitgehend geglückte und notwendige Ermunterung für alle, die mit dem Schreiben (wieder) beginnen wollen. Gelingt dieser Wiederbeginn, wächst das Selbstvertrauen, hat man sich sogar etwas literarisches Handwerk angeeignet, dürfte man hier zufrieden stehenbleiben und so tun, als ob einem das reiche. Man könnte es getrost etwa mit Theodor Fontane halten, der sich selbstironisch einmal so kommentierte: „Alles flink, knapp, unterhaltlich, soweit espritvolles Geplauder unterhaltlich sein kann; wer auf Plots und große Geschehnisse wartet, ist verloren. Für solche Leute schreib‘ ich nicht.“
Aber dann wäre man auf Fontanes gespielte Bescheidenheit ziemlich naiv hereingefallen. Man sollte eben nicht vergessen, dass dies auch jener Fontane war, der als Journalist und Schriftsteller die manchmal qualvolle Mühe des Lohn- und Lustschreibers durchaus kannte. Jener Fontane also, der mit Artikeln und Kritiken, Dramen, Poesie und Prosa auf Öffentlichkeit genauso zielte wie auf eigene sprachliche Meisterschaft. Kein Wunder, dass er so aus tiefer Erfahrung auch diesen Satz zu formulieren wusste, einen Satz, der allzu verträumte Schreibadepten blitzschnell ernüchtern dürfte:
„Dreiviertel meiner literarischen Zeit ist überhaupt Korrigieren und Feilen gewesen.“
Aber wie gesagt: Alles zu seiner Zeit. Man muss sich erst einmal trauen, Texte zu schreiben, bis Texte gelingen, an denen es sich zu feilen lohnt.
Fixpoetry 2020
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung von Fixpoetry.com und der Urheber
Dieser Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Sie dürfen den Artikel jedoch gerne verlinken. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.



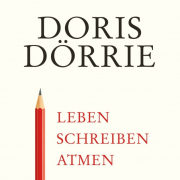





Neuen Kommentar schreiben