Das jüdische Mädchen in finsteren Zeiten
1
Hertha Pauli, 1906 in Wien geboren, war Halbjüdin. Die einschlägigste aller Enzyklopädien, zu der Wikipedia in unserer aufgeklärten Epoche geworden ist, teilt uns mit, daß Paulis Vater Arzt und Universitätsprofessor war, ihre Mutter Journalistin und Frauenrechtlerin, ihr Bruder Physiker. Dieser erhielt 1945 für seine wissenschaftlichen Leistungen den Nobelpreis; seine Schwester hatte schon vorher eine Biographie des Stifters des Preises geschrieben, fast so, als hätte sie dem Ereignis entgegengefiebert. Wolfgang Pauli war seit 1928 an der Technischen Hochschule in Zürich tätig; nach dem Anschluß Österreichs an Deutschland sollte er wie alle Bewohner der Ostmark deutscher Staatsbürger werden, lehnte dies jedoch ab und stellte in der Schweiz einen Antrag auf Einbürgerung. Der Antrag wurde abgelehnt, Pauli ging in die USA, erst nach dem Krieg, als bekannt wurde, daß er den Nobelpreis erhalten würde, klappte es mit der Schweizer Einbürgerung. Es ist seltsam, daß Hertha Pauli den Bruder in ihrer Autobiographie der Jahre 1938 bis 1940 kein einziges Mal erwähnt. Sie war unmittelbar nach dem Anschluß Österreichs an Deutschland, mit dem Zug die neutrale Schweiz durchquerend, wo ihr Bruder immer noch seinen Arbeitsplatz hatte, nach Paris geflohen. Als ihr und ihren Schicksalsgenossen in Frankreich die Felle davonschwammen, dachte sie an mögliche Helfer, um den Ozean überqueren und ihre Haut retten zu können, u. a. an Thomas Mann, aber offenbar kein einziges Mal an ihren Bruder, der in Princeton am Institute for Advanced Studies lehrte und forschte.
2
Hertha Pauli nennt ihre Autobiographie im Geleitwort ein „Erlebnisbuch“, was ein wenig naiv klingt, als handelte es sich um eine „Erlebniserzählung“, wie sie in Österreich die Volksschüler einst zu üben hatten. Die noch junge, mädchenhaft wirkende Hertha, wie sie die Autorin mehr als ein Vierteljahrhundert nach ihrer Flucht erinnert, versprüht mitten in der finstersten Zeit der neueren europäischen Geschichte, bedroht von Deportation und physischer Vernichtung, eine Unbekümmertheit, die in dieser gleichsam natürlichen Opposition gegen die faschistische Bedrohung den eigenwilligen Reiz dieses Buchs ausmacht. Die junge Hertha Pauli war in der Literaturszene der dreißiger Jahre ein weiblicher Adabei, eine Kommunikatorin, die die Leute zusammenbrachte und der unter Emigranten grassierenden Tendenz, sich zu entzweien, entgegenwirkte. Sie kannte zahlreiche mehr oder minder berühmte Leute; die Geschichten und Geschichterln, die sie von ihnen, oft humorvoll, erzählt, sind eine Facette des Reizes, der von ihrem Erinnerungsbuch ausgeht. Joseph Roth, der volkstümlich-intellektuelle Exilkaiser, an seinem Stammplatz im Café Tournon residierend; Ödön von Horvath, der Ex- oder Immer-noch-Geliebte Herthas, und sein trauriges Ende auf den Champs-Elysées (ein Kapitel des Buchs ist nach der breiten Allee benannt, wo er von einem Ast erschlagen wurde); der zwergenhafte, in entscheidenden Situationen aber sehr tatkräftige Walter Mehring, der nie aufhört, zu dichten, auch nicht nach dem Verlust seiner Manuskripte, die er in einem Koffer aus Wien mitgebracht hat; Franz Werfel den sie zufällig in Lourdes in einer Buchhandlung trifft.
Zufällig in Lourdes? Das Buch ist voll von solchen glücklichen Zufällen. Hin und wieder fragt man sich, ob das denn möglich und wirklich gewesen sei. Aber letzten Endes kommt es darauf nicht an. Das Buch ist mehr ein Erinnerungsbuch als ein Erlebnisbuch (über den Zusammenhang von Erinnerung und Erlebnis ließe sich trefflich streiten), aus großem zeitlichem Abstand geschrieben. Die Zeit wirkt bei solchen Unternehmungen als Agent der Fiktion, die Erfindung hilft der Darstellung dessen, was wirklich gewesen ist. Wobei Erfindung in erster Linie Verdichtung heißt: zeitliche ebenso wie räumliche Verdichtung, Zusammenlegung, Verknappung. Die Episoden, die kleinen Geschichten und die Wirkung der großen, grausamen Geschichte wie auch der Widerstand gegen diese spielen aufs glücklichste zusammen, weil die Erzählerin den rechten Abstand hat, nicht zu nah, nicht zu fern. Glücklich auch die grundsätzliche Entscheidung der Erzählerin, sich auf die drei Jahre der Flucht aus Wien und der unsicheren Existenz in Frankreich bis zur Überfahrt an die amerikanische Ostküste zu beschränken und nur wenige Rückblicke auf die Zeit davor sowie ein paar Ausblicke auf die Zeit danach einzufügen.
Glücklich auch die phasenweisen geradezu idyllischen Kapitel in einem Dorf in der Gascogne, fern der Hauptstadt, die schon von den Deutschen besetzt ist. Dort verliebt sie sich in einen jungen Tischler, der – passend zu den Zeitumständen – vor allem Särge herstellt. Von den jungen Franzosen gehen nicht wenige in den Widerstand oder arbeiten mit der Résistance zusammen, so auch Gilbert, der Tischler. Paulis Sätze haben meist diesen frohsinnigen Gestus, frei und geradeheraus, nicht zu komplex, das wirkt in diesem Buch erfrischend. Für eine Feministin, als welche heutigen Feministinnen sie gern sehen wollen, ist sie mitunter ein wenig gar naiv, einem männlich bestimmten Frauenbild verhaftet. Ärgerlich zum Beispiel ihre Beschreibung einer Kellnerin in Clairac, des „Häschens“, das der halben Dorfjugend als sexuelle Beute dient. Aber wie in jüngster Zeit, in unseren friedlichen Zeiten, wieder öfter betont wird: Die Zeiten ändern sich, und was man früher normal fand, ist nicht mehr normal.
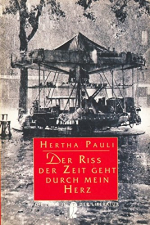 Die zweite Liebesgeschichte von Der Riß der Zeit geht durch mein Herz beginnt im Rückblick, und sie wirkt bis in die Gegenwart des Erzählten (1938) fort, möglicherweise sogar bis weit darüber hinaus, denn die Begegnung mit Ödön von Horvath scheint Hertha Pauli für den Rest ihres Lebens geprägt zu haben. Ihn hatte sie 1931 in Berlin kennengelernt, als sie eine kleine Rolle in der Uraufführung seiner Geschichten aus dem Wiener Wald spielte. Sie wurde seine Geliebte, doch dann – Horvath war ein Frauenheld –, teilte er ihr im Wiener Café Museum mit, er werde in acht Tagen heiraten. Daß es sich um eine bald darauf wieder geschiedene Scheinehe mit einer deutsch-jüdischen Sängerin handelte, der die frisch erworbene ungarische Staatsbürgerschaft zur Flucht verhalf, wußte sie damals nicht. Sie fuhr nach Hause und versuchte, sich das Leben zu nehmen. Auch diese Episode wird frisch von der Leber weg erzählt, ein kleiner Zwischenfall unter zahllosen anderen. Als die Freundin, mit der sie sich eine Mansardenwohnung teilte, zu einem Rendezvous ausging, schloß sie „sorgfältig die Fenster und drehte den Gashahn auf. Dann legte ich mich mit einem angenehmen Gefühl aufs Sofa. Die Geisterbahn im Wiener Prater fiel mir ein, und ich lächelte; Ödön war oft mit mir im Prater gewesen, und wenn mir in der Geisterbahn eiskalte nasse Hände wie mit Leichenfingern ins Gesicht griffen und ich aufschrie, dann lachte er. Jetzt war kein Grund zum Schreien, auch wenn es Ödön Spaß gemacht hätte.“
Die zweite Liebesgeschichte von Der Riß der Zeit geht durch mein Herz beginnt im Rückblick, und sie wirkt bis in die Gegenwart des Erzählten (1938) fort, möglicherweise sogar bis weit darüber hinaus, denn die Begegnung mit Ödön von Horvath scheint Hertha Pauli für den Rest ihres Lebens geprägt zu haben. Ihn hatte sie 1931 in Berlin kennengelernt, als sie eine kleine Rolle in der Uraufführung seiner Geschichten aus dem Wiener Wald spielte. Sie wurde seine Geliebte, doch dann – Horvath war ein Frauenheld –, teilte er ihr im Wiener Café Museum mit, er werde in acht Tagen heiraten. Daß es sich um eine bald darauf wieder geschiedene Scheinehe mit einer deutsch-jüdischen Sängerin handelte, der die frisch erworbene ungarische Staatsbürgerschaft zur Flucht verhalf, wußte sie damals nicht. Sie fuhr nach Hause und versuchte, sich das Leben zu nehmen. Auch diese Episode wird frisch von der Leber weg erzählt, ein kleiner Zwischenfall unter zahllosen anderen. Als die Freundin, mit der sie sich eine Mansardenwohnung teilte, zu einem Rendezvous ausging, schloß sie „sorgfältig die Fenster und drehte den Gashahn auf. Dann legte ich mich mit einem angenehmen Gefühl aufs Sofa. Die Geisterbahn im Wiener Prater fiel mir ein, und ich lächelte; Ödön war oft mit mir im Prater gewesen, und wenn mir in der Geisterbahn eiskalte nasse Hände wie mit Leichenfingern ins Gesicht griffen und ich aufschrie, dann lachte er. Jetzt war kein Grund zum Schreien, auch wenn es Ödön Spaß gemacht hätte.“
Der Selbstmordversuch als Amüsement mit Risikofaktor… Wie sie gerettet wurde, erzählt Pauli nicht. Auch dieses Darüberhinweggehen ist Teil ihrer vermutlich kaum bewußten Erzählstrategie, die Dinge zusammenzurücken und sich das Weiterleben durch nichts, nicht einmal durch die Nazis mit ihren Bombern und Konzentrationslagern, und natürlich auch nicht durch einen von den Frauen umschwärmten Dichter, vermiesen zu lassen.
3
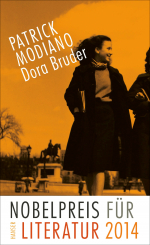 Die Geschichte von Dora Bruder, wie sie der 1945 in Paris geborene Patrick Modiano erzählt, spielt etwa ein Jahr, nachdem Hertha Pauli im September 1940 Frankreich und damit die deutsche Einflußzone endlich verlassen konnte. Modiano schreibt nicht über sich, auch nicht über ein früheres Ich, sondern über eine Unbekannte, von der wir auch am Ende seines Buchs nicht sehr viele „Fakten“ wissen. Seine halb jüdische Abstammung wird Modianos Neugier für das Schicksal dieser Person gelenkt, jedenfalls eine Rolle gespielt haben. Wäre er einige Jahre früher geboren, hätte er womöglich das gleiche Schicksal erlitten wie Dora Bruder. Modiano konnte nicht einfach „sich erinnern“, und auch in Archive zu gehen und Dokumente zu konsultieren, nützte in diesem Fall wenig. Dora Bruder war eine Unbekannte, ein fünfzehnjähriges Mädchen, 1926 in Paris in eine arme jüdische Familie geboren. Der Vater Ernest – ursprünglich vielleicht Ernst? – stammte aus Wien, Modiano vermutet, daß er seine Kindheit und Jugend in der Leopoldstadt verlebte, ehe er nach dem ersten Weltkrieg zur französischen Fremdenlegion ging und in irgendwelchen Gefechten verwundet wurde. Später kam Dora in ein von Nonnen geführtes Internat im 12. Pariser Arrondissement, zu ihrem Guten oder Schlechten, auch darüber läßt sich nur mutmaßen, denn einerseits konnte sie eine Zeitlang ohne das Damoklesschwert der Verhaftung und Deportation leben, andererseits war eben auch das Internat eine Art Gefängnis, aus dem sie mehrmals floh. Modiano stellt sich vor, daß sie vor ihrer Verhaftung und dem Transport nach Auschwitz einige Wochen der Freiheit durchlebt haben könnte. Immerhin.
Die Geschichte von Dora Bruder, wie sie der 1945 in Paris geborene Patrick Modiano erzählt, spielt etwa ein Jahr, nachdem Hertha Pauli im September 1940 Frankreich und damit die deutsche Einflußzone endlich verlassen konnte. Modiano schreibt nicht über sich, auch nicht über ein früheres Ich, sondern über eine Unbekannte, von der wir auch am Ende seines Buchs nicht sehr viele „Fakten“ wissen. Seine halb jüdische Abstammung wird Modianos Neugier für das Schicksal dieser Person gelenkt, jedenfalls eine Rolle gespielt haben. Wäre er einige Jahre früher geboren, hätte er womöglich das gleiche Schicksal erlitten wie Dora Bruder. Modiano konnte nicht einfach „sich erinnern“, und auch in Archive zu gehen und Dokumente zu konsultieren, nützte in diesem Fall wenig. Dora Bruder war eine Unbekannte, ein fünfzehnjähriges Mädchen, 1926 in Paris in eine arme jüdische Familie geboren. Der Vater Ernest – ursprünglich vielleicht Ernst? – stammte aus Wien, Modiano vermutet, daß er seine Kindheit und Jugend in der Leopoldstadt verlebte, ehe er nach dem ersten Weltkrieg zur französischen Fremdenlegion ging und in irgendwelchen Gefechten verwundet wurde. Später kam Dora in ein von Nonnen geführtes Internat im 12. Pariser Arrondissement, zu ihrem Guten oder Schlechten, auch darüber läßt sich nur mutmaßen, denn einerseits konnte sie eine Zeitlang ohne das Damoklesschwert der Verhaftung und Deportation leben, andererseits war eben auch das Internat eine Art Gefängnis, aus dem sie mehrmals floh. Modiano stellt sich vor, daß sie vor ihrer Verhaftung und dem Transport nach Auschwitz einige Wochen der Freiheit durchlebt haben könnte. Immerhin.
Berührend ist Modianos Roman nicht sosehr durch die Fakten, die er bereitstellt; diese sind, wie gesagt, spärlich. Berührend ist er durch die stille Ausdauer, mit der Modiano versucht, ein fünfzehnjähriges Mädchen, dessen gesamte Verwandtschaft von der Erde verschwunden ist, vor dem Vergessen zu retten, und durch die Zuneigung, die dabei im Lauf der Jahre des Ermittelns und Nachfragens und wiederholten Aufsuchens der Orte, der „Schauplätze“, entsteht und sich auf den geneigten Leser überträgt. Es ist ein geduldiges Umkreisen dieser Orte und der möglichen Geschichten, ein Tasten und Annähern, ähnlich dem Verhalten eines Detektivs, aber mit anderen, umgekehrten Vorzeichen. Modianos Nachforschungen, und mehr noch sein Warten, sein Nachdenken, dienen nicht der Dingfestmachung und Verurteilung eines Subjekts, sondern der Rettung, der Befreiung eines Individuums. Dora Bruder war eine Unbekannte; jetzt lebt sie in der Imagination von Leuten – von Lesern – wie dir und mir. Seit 2015 gibt es in Paris, im 18. Arrondissement, sogar eine Promenade Dora Bruder, zwischen zwei Straßen, von denen die eine den Namen eines berühmten Philosophen und Mathematikers trägt (Leibniz), die andere den eines Kavalleriegenerals der napoleonischen Armee (Belliard). Sie wird also bleiben, wenigstens ein paar Jahrhunderte lang, obwohl sie nichts „geleistet“ hat wie die beiden anderen hier Erwähnten.
Die Prominenten von Hertha Paulis Erinnerungsbuch haben jede Menge Spuren hinterlassen: Aussprüche, Handlungen, Haltungen, Gesten, die aufgezeichnet wurden, und nicht zuletzt ihre Theaterstücke, Romane, Gedichte. Auch Gilbert, der junge Tischler aus der Gascogne, hat dank seiner Freundin Spuren hinterlassen, auch er bleibt im Gedächtnis. Über sie zu lesen, muß einem auf alles Literarische, Geistige, Menschliche neugierigen Menschen Vergnügen bereiten. Das Erstaunliche an Modianos Roman ist, daß durch die sanfte Macht der Fiktion aus wenigen unsicheren Umrissen ein Wesen entsteht, dessen rudimentäres Schicksal uns ebenso nahegeht wie das von Menschen oder Figuren, die wir gut zu kennen glauben.
4
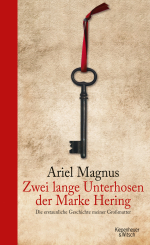 Könnte Hertha Pauli oder einer ihrer Freunde Dora Bruder über den Weg gelaufen sein, 1939/40 in Paris? Möglich wär’s, die Flüchtlinge versuchten, in Bewegung zu bleiben; sie konnten zwar im Hotelzimmer sitzen und schreiben, und einige, wie Walter Mehring, taten dies unverdrossen, aber einer bezahlten Arbeit nachgehen durften sie nicht. Könnte Emma, die Großmutter des argentinischen Schriftstellers Ariel Magnus, Dora Bruder begegnet sein, sie zumindest gesehen haben? Wahrscheinlich nicht, denn Emma kam erst 1944 nach Auschwitz, nachdem sie sich 1943 freiwillig ins Lager Theresienstadt begeben hatte, um dort ihrer blinden Mutter beizustehen. Wir wissen nicht, ob Dora Bruder wie die meisten jüdischen Deportierten sofort in die Gaskammer gebracht wurde oder ob sie noch eine Zeit länger leben durfte, oder mußte; sicher ist nur, daß sie Auschwitz nicht, wie die junge, kleingewachsene, äußerst zähe Krankenschwester Emma, überlebt hat. Ihr 1975 geborener Enkel Ariel hat seine deutsch-jüdische Großmutter in Brasilien, wohin sie nach der Befreiung emigriert war, über ihre KZ-Erfahrungen befragt und dieses Material dann mit Berichten von Reisen, auf denen er sie in Deutschland begleitete, kombiniert, so daß ein halb dokumentarischer, in vielen Passagen humorvoller Roman entstanden ist.
Könnte Hertha Pauli oder einer ihrer Freunde Dora Bruder über den Weg gelaufen sein, 1939/40 in Paris? Möglich wär’s, die Flüchtlinge versuchten, in Bewegung zu bleiben; sie konnten zwar im Hotelzimmer sitzen und schreiben, und einige, wie Walter Mehring, taten dies unverdrossen, aber einer bezahlten Arbeit nachgehen durften sie nicht. Könnte Emma, die Großmutter des argentinischen Schriftstellers Ariel Magnus, Dora Bruder begegnet sein, sie zumindest gesehen haben? Wahrscheinlich nicht, denn Emma kam erst 1944 nach Auschwitz, nachdem sie sich 1943 freiwillig ins Lager Theresienstadt begeben hatte, um dort ihrer blinden Mutter beizustehen. Wir wissen nicht, ob Dora Bruder wie die meisten jüdischen Deportierten sofort in die Gaskammer gebracht wurde oder ob sie noch eine Zeit länger leben durfte, oder mußte; sicher ist nur, daß sie Auschwitz nicht, wie die junge, kleingewachsene, äußerst zähe Krankenschwester Emma, überlebt hat. Ihr 1975 geborener Enkel Ariel hat seine deutsch-jüdische Großmutter in Brasilien, wohin sie nach der Befreiung emigriert war, über ihre KZ-Erfahrungen befragt und dieses Material dann mit Berichten von Reisen, auf denen er sie in Deutschland begleitete, kombiniert, so daß ein halb dokumentarischer, in vielen Passagen humorvoller Roman entstanden ist.
Ein Roman nicht sosehr über die Hauptfigur als um sie herum, denn im Unterschied zu Modianos Vorhaben, bei dem es darum ging, sich einer Person zu nähern, die weiter nichts als ein Name, ein Schemen in der Vorstellung war, war es für Ariel Magnus wichtig, jene Zonen, über die seine Figur – die Großmutter – nicht sprechen konnte, zwar in den Blick zu fassen, aber auch ihre Undurchdringlichkeit zu respektieren. Im Roman bleiben Leerstellen, eigentlich paßt eben dieses Wort: leere Zonen im fragmentarischen Erfahrungsbericht, eine wortlose Intimsphäre, deren Bestehenbleiben Voraussetzung ist dafür, daß überhaupt etwas mitgeteilt werden kann. Und mitgeteilt wird dann ja auch, La abuela1 ist ein Roman, den man besonders den Nachgeborenen der Nachgeborenen, den Enkeln und Urenkeln der Generation, die in finsteren Zeiten lebte, ans Herz legen kann, eben weil hier nicht bloß ein weiteres Mal Fakten wiederholt werden, die im Rahmen der Vergangenheitsbewältigung der Nachkriegsjahrzehnte irgendwann zu ermüden begannen, so schrecklich sie auch waren, sondern weil ein so weiter Bogen gespannt wird, von den vierziger Jahren über ein langes Leben in der Emigration hinein in die deutsche Wirklichkeit zu Beginn des 21. Jahrhunderts, lange nach der Wende von 1989/90. Das Zueinanderführen zweier Ebenen, zweier historischer und persönlicher Lebensphasen erzeugt hier eine Reibung, es läßt gewissermaßen die Funken, oft auch komischen Funken in Magnus’ Roman springen. Man kann das, mit einem allzu oft dem suspense reservierten Wort, auch als „Spannung“ bezeichnen.
Hertha Pauli mußte emigrieren, um der Verfolgung und, wie sich durch die weitere Entwicklung nach dem März 1938 bestätigte, der Ermordung zu entgehen. Emma überlebte das Vernichtungslager, kam aber gleich nach der Befreiung nach Schweden, wollte eigentlich in die USA emigrieren und mußte aus verschiedenen Gründen mit Brasilien als Aufnahmeland vorliebnehmen. Sie kehrte später mehrmals nach Deutschland zurück, besuchte – mit einigem Widerstreben – auch Konzentrationslager, und fühlte sich offenbar zeitlebens als Deutsche. (Ich weiß nicht, ob sie noch am Leben ist, sie würde heuer hundert Jahre alt werden. Die Neunzigjährige kann man auf einem Foto sehen, das in der deutschen Ausgabe des Romans wiedergegeben ist.) Auch Hertha Pauli kehrte zurück, nicht zuletzt, um ihr Buch, ihren Erlebnisbericht schreiben zu können; sie kehrte zurück nach Österreich, nach Frankreich, nach Deutschland, wo Wera Liessem, Horvaths letzte Geliebte und Freundin Paulis, arbeitete, und in die Schweiz, wo Walter Mehring lebte.
5
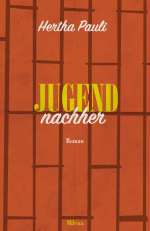 Auch die – ganz und gar fiktive – Heldin von Hertha Paulis Nachkriegsroman Jugend nachher, erstmals 1959 im Wiener Zsolnay Verlag erschienen, ist eine KZ-Überlebende, ein zur Zeit der Handlung noch minderjähriges Mädchen, über dessen Vergangenheit der Leser fast gar nichts erfährt. Ihre Mutter ist im KZ umgekommen, vermutlich werden die beiden gemeinsam dorthin gebracht worden sein, denn die Ich-Erzählerin war damals ein Kind; sie selbst sollte durch eine Spritze getötet werden, aber offenbar reichte die Dosis nicht; von jenem Vorfall nimmt sie eine schreckliche Angst vor Spritzen in die Friedenszeit mit. Warum Pauli ausgerechnet eine KZ-Überlebende als Protagonistin wählte – ich weiß es nicht; ihrer Intention, die Kälte und Grausamkeit der ersten Nachkriegszeit aufzuzeigen, dient diese Entscheidung nicht. Gewiß, Pauli wollte die ungebrochene Herrschaft faschistischer Einstellungen möglichst anschaulich gestalten. Das Setting, die Beziehungen zwischen den Figuren, die Charaktere – das alles ist wenig glaubwürdig, kippt unfreiwillig ins Karikaturhafte. Der Titel spielt überdeutlich auf Horvaths Roman Jugend ohne Gott an, den Pauli literarisch beerben wollte, indem sie die Verrohung jugendlicher Cliquen – bis hin zur Monumentalclique der Hitler-Jugend – aus der frühen Nazizeit in die Zeit nach dem Zusammenbruch des Regimes und dem leider nur scheinbaren Ende seiner Ideologie transponierte. Die Mitglieder der Räuberbande ihres Romans sind Nostalgiker des Tausendjährigen Reichs, und die Erwachsenen, jene guten Bürger, die in keiner sozialen Ordnung anecken wollen, sind es ebenfalls. Die von Pauli evozierte Atmosphäre, ist düster und schwer, sie wird im Verlauf der Lektüre immer schwerer, es gibt keine Gegengewichte, keinen Humor, keine Ironie und keine Poesie wie in Horvaths Roman in der Form von Tagebuchaufzeichnungen inklusive Protokoll von Gerichtsverhandlungen.2 Eine komplexe, widersprüchliche Figur oder unlösbare innere Konflikte sucht man hier vergeblich.
Auch die – ganz und gar fiktive – Heldin von Hertha Paulis Nachkriegsroman Jugend nachher, erstmals 1959 im Wiener Zsolnay Verlag erschienen, ist eine KZ-Überlebende, ein zur Zeit der Handlung noch minderjähriges Mädchen, über dessen Vergangenheit der Leser fast gar nichts erfährt. Ihre Mutter ist im KZ umgekommen, vermutlich werden die beiden gemeinsam dorthin gebracht worden sein, denn die Ich-Erzählerin war damals ein Kind; sie selbst sollte durch eine Spritze getötet werden, aber offenbar reichte die Dosis nicht; von jenem Vorfall nimmt sie eine schreckliche Angst vor Spritzen in die Friedenszeit mit. Warum Pauli ausgerechnet eine KZ-Überlebende als Protagonistin wählte – ich weiß es nicht; ihrer Intention, die Kälte und Grausamkeit der ersten Nachkriegszeit aufzuzeigen, dient diese Entscheidung nicht. Gewiß, Pauli wollte die ungebrochene Herrschaft faschistischer Einstellungen möglichst anschaulich gestalten. Das Setting, die Beziehungen zwischen den Figuren, die Charaktere – das alles ist wenig glaubwürdig, kippt unfreiwillig ins Karikaturhafte. Der Titel spielt überdeutlich auf Horvaths Roman Jugend ohne Gott an, den Pauli literarisch beerben wollte, indem sie die Verrohung jugendlicher Cliquen – bis hin zur Monumentalclique der Hitler-Jugend – aus der frühen Nazizeit in die Zeit nach dem Zusammenbruch des Regimes und dem leider nur scheinbaren Ende seiner Ideologie transponierte. Die Mitglieder der Räuberbande ihres Romans sind Nostalgiker des Tausendjährigen Reichs, und die Erwachsenen, jene guten Bürger, die in keiner sozialen Ordnung anecken wollen, sind es ebenfalls. Die von Pauli evozierte Atmosphäre, ist düster und schwer, sie wird im Verlauf der Lektüre immer schwerer, es gibt keine Gegengewichte, keinen Humor, keine Ironie und keine Poesie wie in Horvaths Roman in der Form von Tagebuchaufzeichnungen inklusive Protokoll von Gerichtsverhandlungen.2 Eine komplexe, widersprüchliche Figur oder unlösbare innere Konflikte sucht man hier vergeblich.
Es geht mir nicht darum, Jugend nachher mit Reich-Ranickihafter Geste zu abzuurteilen. Wundern muß man sich aber doch, daß dieser Roman überhaupt neu aufgelegt wurde; die Gründe dafür lassen sich allenfalls in falsch verstandener Frauensolidarität vermuten (der Milena Verlag nannte sich früher Frauenverlag und hat die Programmlinie im Wesentlichen beibehalten). Wenn Evelyne Polt-Heinzl im Nachwort dieses Buch als Nachweis für die Existenz einer österreichischen Trümmerliteratur vorstellen will, so desavouiert sie damit ihre Absicht eher. Kriegs- und Nachkriegstexte wie die von Wolfgang Borchert, Hans Erich Nossack oder Heinrich Böll sind hier spärlich gesät. Charakteristisch ist und bleiben für die österreichische Literatur jener Zeit doch eher H. C. Artmanns Bestreben, an die Vorkriegsavantgarden anzuschließen, und Ernst Jandls Auseinandersetzung mit persönlichen Kriegserfahrungen in Form experimenteller Gedichte wie schtzngrmm oder wien: heldenplatz; letzteres, 1962 geschrieben, sicher eines der stärksten poetischen Zeugnisse dieser Generation im gesamten deutschen Sprachraum.
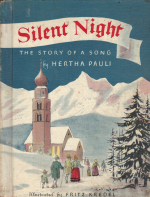 Beim Lesen von Jugend nachher frage ich mich, was mit der – manchmal tatsächlich an Horvath heranreichenden – schönen Leichtigkeit von Der Riß der Zeit geschehen ist. Hertha Pauli war durchaus imstande, Literatur zu schreiben, aber ich vermute, keine Fiktion. Auch für Schriftsteller gilt: Sie sollten herausfinden und tun, was sie können; und manchmal das, was sie nicht (nicht so gut) können, weil es dem, was sie können und was ihnen gelingt, Kontur zu geben vermag. Paulis Erfindungen, angefangen vom KZ-Mädchen, das seine Geschichte verbergen muß und doch nicht verbergen kann, weshalb sie ihrer ebenfalls nicht recht glaubhaften amerikanischen Cousine das Vorgefallene, d. h. diesen Roman, erzählt, bis hin zum einarmigen Krüppel, der stolz ist, als Kind mit einer Handgranate gespielt zu haben, oder zur ersten Liebe zwischen dem KZ-Mädchen und einem engelgleichen Jungen auf schiefer Bahn, diese Erfindungen tragen nicht, sie stürzen ab. Pauli schrieb vor ihrer Flucht eine Biographie Bertha von Suttners und danach, in den USA, eine Geschichte von Silent Night, Holy Night, jenem weltberühmten Austriakum, das für die weltgereiste Patriotin ein passendes Thema war.
Beim Lesen von Jugend nachher frage ich mich, was mit der – manchmal tatsächlich an Horvath heranreichenden – schönen Leichtigkeit von Der Riß der Zeit geschehen ist. Hertha Pauli war durchaus imstande, Literatur zu schreiben, aber ich vermute, keine Fiktion. Auch für Schriftsteller gilt: Sie sollten herausfinden und tun, was sie können; und manchmal das, was sie nicht (nicht so gut) können, weil es dem, was sie können und was ihnen gelingt, Kontur zu geben vermag. Paulis Erfindungen, angefangen vom KZ-Mädchen, das seine Geschichte verbergen muß und doch nicht verbergen kann, weshalb sie ihrer ebenfalls nicht recht glaubhaften amerikanischen Cousine das Vorgefallene, d. h. diesen Roman, erzählt, bis hin zum einarmigen Krüppel, der stolz ist, als Kind mit einer Handgranate gespielt zu haben, oder zur ersten Liebe zwischen dem KZ-Mädchen und einem engelgleichen Jungen auf schiefer Bahn, diese Erfindungen tragen nicht, sie stürzen ab. Pauli schrieb vor ihrer Flucht eine Biographie Bertha von Suttners und danach, in den USA, eine Geschichte von Silent Night, Holy Night, jenem weltberühmten Austriakum, das für die weltgereiste Patriotin ein passendes Thema war.
6
 Vielleicht ist es ein bißchen weit hergeholt, wenn ich die überindividuelle Figur des jüdischen Mädchens im Kontext des schlimmsten nationalsozialistischen Terrors nun noch in Verbindung bringe mit einer individuellen Gestalt in einem vor wenigen Jahren erschienen Roman eines zeitgenössischen österreichischen Autors, Thomas Stangl. Es handelt sich um Emilia Degen, Österreicherin, keine Jüdin, in der Leopoldstadt wohnend, dem vor dem Krieg stark jüdisch geprägten 2. Bezirk der Stadt Wien, wo aller Wahrscheinlichkeit nach der Vater Dora Bruders aufgewachsen war. Die Hauptgeschichte dieses Romans (Was kommt) spielt zwischen 1936 und 1938 unter Schülern, von denen einige eine Gruppe bilden, um gemeinsam eine Haltung zur Geschichte und zu den gegenwärtigen politischen Entwicklungen zu erarbeiten und sich in vielfacher Hinsicht zu bilden, einem humanistischen Ideal folgend, das auch die jungen Protagonisten in Peter Weiss‘ Ästhetik des Widerstands leitet, jenem Roman, mit dem sich Stangl in seinem Essay Revolution und Sehnsucht auseinandersetzt.
Vielleicht ist es ein bißchen weit hergeholt, wenn ich die überindividuelle Figur des jüdischen Mädchens im Kontext des schlimmsten nationalsozialistischen Terrors nun noch in Verbindung bringe mit einer individuellen Gestalt in einem vor wenigen Jahren erschienen Roman eines zeitgenössischen österreichischen Autors, Thomas Stangl. Es handelt sich um Emilia Degen, Österreicherin, keine Jüdin, in der Leopoldstadt wohnend, dem vor dem Krieg stark jüdisch geprägten 2. Bezirk der Stadt Wien, wo aller Wahrscheinlichkeit nach der Vater Dora Bruders aufgewachsen war. Die Hauptgeschichte dieses Romans (Was kommt) spielt zwischen 1936 und 1938 unter Schülern, von denen einige eine Gruppe bilden, um gemeinsam eine Haltung zur Geschichte und zu den gegenwärtigen politischen Entwicklungen zu erarbeiten und sich in vielfacher Hinsicht zu bilden, einem humanistischen Ideal folgend, das auch die jungen Protagonisten in Peter Weiss‘ Ästhetik des Widerstands leitet, jenem Roman, mit dem sich Stangl in seinem Essay Revolution und Sehnsucht auseinandersetzt.
Emilia verliebt sich in Georg, der zu dieser Gruppe gehört und Jude ist. Stangl erzählt das alles mit der größten Zurückhaltung und Sensibilität für Nuancen, und er erzählt, fast ganz ohne den Vorgang direkt zu benennen, von der Verschärfung des Antisemitismus in Wien bis hin zu Brandschatzung, Vertreibung, Deportation. Georgs Vater ist Buchhändler, an den Rollläden seines Geschäfts steht eines Tages Ist in Dachau, daneben ein Davidsstern. Emilia bringt nicht die Kraft auf oder hat einfach nicht die Möglichkeit, dem Schicksal Georgs und seiner Familie nachzugehen und irgendetwas für sie zu tun. Diese Erfahrung, dieses Versäumnis, wenn man es so bezeichnen will, diese Abwesenheit wird noch Jahrzehnte nach dem Ende der nationalsozialistischen Herrschaft auf ihr lasten. Auch auf der gealterten Emilia Degen, die in Stangls vorhergehendem Roman Ihre Musik immer noch dieselben Räume in der Leopoldsstadt bewohnt.
Emilia, die verhinderte Widerstandskämpferin. Die Frau, die keinen der Verfolgten hat retten können. So ohnmächtig wie damals alle oder fast alle österreichischen Bürger, die ins „Deutsche Reich“ eingegliedert wurden und nicht, wie die Mehrheit, jubelnd beistimmten oder gar jüdische Geschäfte plünderten, ihre Besitzer erniedrigten. Diese Ohnmacht herrscht auch auf den Anfangsseiten von Paulis Autobiographie, die – zunächst sogar noch recht vergnügt – mit der Darstellung eines anderen Austriakums, einer Wiener Institution beginnt: dem Kaffeehaus. Die Ereignisse überstürzen sich, die Stimmung und die Herrschaft wechseln schnell. „Als Wien noch die Weltstadt war, in der das Haus Habsburg und der Walzerkönig regierten, spielte auch das Wiener Kaffeehaus eine ganz andere Rolle…“ Dieses Wien lebte von nun an nur noch im Kopf, in den Kommentaren und in den Büchern Joseph Roths fort, der an seinem Stammtisch im Café in der Pariser Rue de Tournon residiert, bis er, im Mai 1939, den Auswirkungen seiner Alkoholsucht erliegt.
7
Dem jeweils geltenden literarischen Kanon sollte man nicht blind vertrauen. Literaturwissenschaftler und die meisten Kritiker zementieren ihn gern, Schriftsteller rütteln mitunter an seinen Säulen oder wenigstens an dem einen oder anderen Dachziegel. Der Kanon hat sicher nicht immer recht, er ist aber auch nicht ganz dumm, viele seiner Entscheidungen sind gut begründet. Hertha Pauli als Schriftstellerin ins Pantheon zu heben, scheint mir nicht sinnvoll, aber vielleicht können wir der Biographie ihrer Flucht darin einen Platz verschaffen. Ich zumindest habe es in meinem privaten, ich sage nicht Pantheon, sondern lieber: Zirkus getan. So wie 36 Gerechte auf Erden – zumeist unsichtbare, unerkannte Personen – genügen, damit Gott die Welt im Lot läßt, so genügt im Gesamtwerk eines Autors ein einzelnes Buch und manchmal ein einziges Gedicht, vielleicht sogar eine einzige Prosaseite oder ein einziger Satz, um seine Lust und Mühsal zu rechtfertigen.
Literaturverzeichnis
- Ödön von Horvath: Jugend ohne Gott. In: Gesammelte Werke, hrsg. V. Traugott Krischke. Frankfurt am Main 1988, Bd. 4 Erhältlich bei: Suhrkamp Taschenbuch 2008
- Ariel Magnus: Zwei lange Unterhosen der Marke Hering. Die erstaunliche Geschichte meiner Großmutter. Aus dem argentinischen Spanisch von Silke Kleemann. Köln , Kiepenheuer & Witsch 2012
- Patrick Modiano: Dora Bruder. Aus dem Französischen von Elisabeth Edl. München 1998, erhältlich bei Hanser München 2018
- Hertha Pauli: Der Riß der Zeit geht durch mein Herz. Erlebtes – Erzähltes. Frankfurt am Main und Berlin 1990
- Hertha Pauli, Jugend nachher. Wien 2019 Milena Verlag
- Thomas Stangl, Was kommt. Graz und Wien 2009, Literaturverlag Droschl
- Thomas Stangl: Revolution und Sehnsucht. Im Möglichkeitsraum des Vergangenen, in: Freiheit und Langeweile. Graz und Wien 2016, Literaturverlag Droschl
- 1. Die deutsche Übersetzung trägt den Titel Zwei lange Unterhosen der Marke Hering, und sie verwendet die originalen Aufzeichnungen der Gespräche, die Magnus in Brasilien auf Deutsch mit der Großmutter geführt hatte. La abuela bedeutet „Die Großmutter“, als Buchtitel scheint das aber nicht geeignet. Den vom deutschen Verlag gewählten Titel finde ich allerdings genauso unpassend.
- 2. Daß die Auflösung der Rätsel und Konflikte in Gerichtsverhandlungen erfolgt, ist eine von mehreren inhaltlichen und formalen Parallelen zwischen Jugend nachher und Jugend ohne Gott.
Fixpoetry 2020
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung von Fixpoetry.com und der Urheber
Dieser Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Sie dürfen den Artikel jedoch gerne verlinken. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.







Neuen Kommentar schreiben