Teuflische Lehren
Wer so, wie es sich die nicht selten selbsternannten Pädagogik-Experten träumen, gnadenlos alles integriert, bis die Gesamtschule eine gesellschaftspolitische Apokatastasis (eine Allauferstehung, der kein Teufelchen entginge) ist, der kann zugleich nicht differenzieren. Jeder, der sich ihnen nähert, wird ausgebildet – aber womöglich nicht gebildet, ihm wird die Fähigkeit nicht vermittelt, sich mit Fragen zu befassen, die noch nicht gestellt sind, vielleicht deshalb noch nicht gestellt, weil es jene sind, die allein man selbst sich stellt. Er wird ausgebildet, das heißt integriert, aber als Individuum, das nicht völlig Teil von etwas ist, dabei vor lauter Management-Nächstenliebe fast ausgemerzt; die Differenz wie die Kunst des Differenzierens sind unerwünscht und werden als abweichlerisch diffamiert.
Alfred Schirlbauer ist Pädagoge, aber keiner dieser Pädagogik-Experten, er setzt auf das, was die sakrosankte Vernutzung des Schülers übersieht: Diabolische Betrachtungen liefert er stattdessen, und zwar in einem Wörterbuch, das Ambrose Bierce, den Schirlbauer als maßgeblichen Denker auch sogleich anführt, gewiß gefallen hätte. Diabolos, das ist der Zerwürfnis-Stifter, der Differenzierer, der also – was längst vonnöten ist – zeigt, daß Denken mit Begriffsbildung zu tun hat, die ihrerseits nebst Oberbegriff eben auch die differentia specifica kennt, um ihre Ordnungen (und seien es postmoderne Rhizome) zu schaffen.
Das zu wissen hilft oder besser: hülfe beim Dialog – „(i)m schulpädagogischen Zusammenhang daher selten anzutreffen” (S.22) –, der dann auch diskriminiert, und ja nicht immer zu Unrecht: „Wer nicht unterscheidet, für den ist alles gleich.” (S.22) Das leugnet nicht, daß mancher Unterschied dann irrelevant ist; vielleicht sind manche Unterschiede nur virtuell, wie manche Gleichheit mit Adorno „Urform der Ideologie” ist, bloß ist es, wie Schirlbauer schreibt, auch „diskriminierend, wenn man den Begriff der Diskriminierung [...] diskriminiert” (S.24)…
Mit derlei verträgt sich das kaum, wozu Pädagogik immer wieder verkommt: einer Vereinnahmung, einer Schaffung sozial scheinbar kompatibler Idioten, die dann zu den Tätigkeiten gedrillt werden, mit denen sie dereinst Rädchen im etwelchem System sein sollen. Es ist ein Drill, es ist nichts anderes, wenn etwa beim „Lupendiktat” (S.5) – das gibt es wirklich..! – die kleinen Brave-New-Worldbürger völlig frei von Wissen und Reflexion, in Wahrheit natürlich dieser beraubt oder aufgrund planvoller Vorenthaltung nie in deren Nähe geraten, mit Bleistift und Zettel herumlaufen… Diese Demontage setzt sich heute bis in die Matura fort, wie das Abitur noch heute in Österreich heißt, als ginge es noch um Reife und nicht darum, daß die Zöglinge einst abituri sind: „fortgegangen sein werden”.
Das Abitur ist heute durch Operatoren oder „Problemlösungskompetenz” (S.71) definiert, Dinge, die der Nachwuchs zu tun in der Lage sein möge, wobei das Tun dort, wo es meßbar Begriffsleistungen belegte, vielleicht noch (irgendwie geradezu ein wenig … etc.) sinnvoll wäre; doch weil eine sprach- und gedankenlose Pseudomoderne gegenwärtig dogmatisch auf – zum Beispiel – Wissen verzichten will, gibt es zuletzt Fragestellungen, worin (auch heuristische) Begriffe und Termini, das Vermögen der Kontextualisierung und dergleichen nicht mehr vorkommen sollen. Verstehen sei ein Operator, so wird behauptet – doch worin Verstehen dann noch bestehe, wenn in Wahrheit nur mehr Routinen abgerufen werden, während alles verpönt ist, was ein Innehalten (epoche), Stille oder Muße (schole, immerhin das Wort, von dem sich Schule ableitet) verlangte: oder gar eben „Sachhaltigkeit” (S.71) und in der Folge ein In-Beziehung-Setzen, worin aber eben längst mit der Sache und dem Wissen um sie das verlorenging, wozu was auch immer in Relation stünde.
Was bleibt hernach? Man ist frei: frei vom Denken. Man ist auch frei von Autorität – welches Wort wäre unangenehmer, wenn die lieben Kinder unterrichtet werden. Nur sollte man bedenken, wer ihr Erbe ist, wenn man sie zu Grabe trägt: „Anerkennung wird ersetzt durch […] Abhängigkeit – und damit Autorität durch Macht.” (S.13) Oder durch „Sachzwänge” (S.25), über deren Alternativlosigkeit schon lange, bevor Angela Merkel über diese stolperte, Günther Anders trefflich spottete.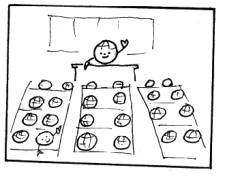
Quelle: sandran.twoday.net
Ohne Fronten geht es also nicht; und diese sind gerade dort, wo sie kaschiert sind, perfide, weshalb Schirlbauer den Frontalunterricht anempfiehlt. Und wozu? – Zurecht! Der Schüler bekommt er erklärt und erzählt, was er nicht weiß, was also zu lernen ihn in die Schule bewegen hätte müssen. Er wird in seiner „Schülerrolle ernstgenommen” (S.38), statt mit einem „unerzogenen und ahnungslosen” (S.37) Pädagogen, der nicht nur in der Klasse Nivellierung in fragwürdiger Weise praktiziert, sondern auch Mimesis an seine unbedarftesten Schützlinge betreibt, herumzuwursteln. Sonst würde Unterricht beliebig und der Lehrer das, als was er sonst vielleicht doch zu Unrecht empfunden wird: Sein problematisch-paradoxes Vorbild wäre das Kind, aber dieses ist eben „in der Regel vor allem »lästig«.” (S.44)
Es geht aber eben nicht darum – vielmehr ist Lehren ein Helfen, nämlich eines, das auf Mündigkeit zielt, nicht darauf, daß der Schüler, was er nicht kann, für ihn erledigt und vorgesetzt bekommt, es übt, wo er es nicht versteht: „Sagen, wie es geht, wäre in der Schule schon zu viel.” (S.41) Üben ist dabei freilich nicht Wiederholung, vielmehr ein Üben, bis man, was man scheinbar wiederholte, in seiner eigenen Weise versteht – wie man bei Schirlbauer angedeutet findet (S.88) und wie es Sloterdijk umfangreich 2009 in Du mußt dein Leben ändern ausformulierte.
Übung ist Vertrautheit mit Methoden. Das kann befreien: Denn zu denken bedeutet, eine Methodik zu entwickeln, das, was Methode sei, aus Wegen zu erkennen und (es für) sich als eine Souveränität des eigenen Verstehens zu entfalten. Der gute Schüler ist damit eben zuletzt kein Schüler mehr, oder mit Schirlbauers in Wahrheit fast optimistischem Schlußsatz zum Stichwort „Mündigkeit”: „Das kann nicht gutgehen.” (S.64f.)
Vor diesem Anspruch und andererseits seiner kläglichen Einlösung erklärt sich, was Schirlbauer nebst Diabolik treibt: „Kynische (zynische) Pädagogik” (S.51) ist sein sozusagen dialektisch humanes Anliegen, eine Pädagogik, die sich weder dem Alltag noch den Anliegen derer, die Schule nicht grundlos in die Unterbietung ihrer selbst zu nötigen suchen, andient. Die sich von Unterricht, Erziehung und Vorbildhaftigkeit fernhielte, wenn nicht obszönere Geister sich dieser bemächtigten, die beanspruchen, das zu sein, wovon der Kyniker immerhin weiß, es nicht sein zu können. „Eine Pflicht zum Kynismus erwächst daraus […] nicht” (S.52), doch hat sie der Verfasser dieses Buchs gründlichlich und lesenswert erfüllt.
In einem Tenor, der amüsant und akkurat ist, zerlegt Schirlbauer die Begriffe, er differenziert, verprellt, verwirft, daß es eine Freude ist, wenn auch nicht allen, doch Bildung ist eben „das, was möglichst alle erreichen sollten, aber in Wirklichkeit nur wenigen zuteil wird.” (S.15) Das hört man vor allem ungern, ist man Profiteur des Mißstandes, den man schönredet, weil er nicht zu beheben sei. Der Zyniker wird von Bierce als „blackguard whose faulty vision sees things as they are, not as they ought to be”, definiert, wo der von Schirlbauer zurecht dem Spott preisgegebene Meta- und Über-Pädagoge zuletzt glaubt, schon behoben zu haben, was man darum gar nicht mehr sehen dürfe – weshalb er an den bösen Ungläubigen den, so Bierce, Brauch der Skyther praktizieren wollte: „plucking out a cynic’s eyes to improve his vision.” Man sieht: Gläubige verstehen auch in dieser Religion nicht viel Spaß. Daran und an der Welt, die sich auch diesen Fanatikern verdankt, könnte man verzweifeln; stringenter aber ist, was Schirlbauer tut, er ruft das, was man nicht sehen soll und darf, gerade im Rahmen einer fröhlichen (Erziehungs-)Wissenschaft wieder ins Gedächtnis.
Fixpoetry 2013
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung von Fixpoetry.com und der Urheber
Dieser Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Sie dürfen den Artikel jedoch gerne verlinken. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.







Neuen Kommentar schreiben