Die Sprache vibriert in finsteren Grautönen
„Ich hab Angst davor, mich nicht zurechtzufinden, wenn ich draußen bin. Woher weiß ich, ob irgendwas richtig oder falsch ist? Wenn keiner da ist, den ich fragen kann, meine ich.“
Felix Winter leidet unter einer „retrograden Amnesie“, kann sich weder an seinen tragischen Unfall noch an sein Leben davor erinnern. Abgeschnitten von seinem früheren Ich, seiner früheren Welt, seinen früheren Gefühlen, schwebt er in einer bodenlosen Leere. Ohne Halt, ohne Bezugspunkte, ohne Sicherheiten. Nichts, absolut nichts ist ihm vertraut, schon gar nicht er selbst. Tagelang hockt oder liegt oder sitzt er im Krankenhaus „auf seinem weißbezogenen Bett vor einer weißgetünchten Wand, den Blick in ein ebenso weißes Nirgendwo gerichtet.“
Es sah nicht gut aus für Felix. Kaum jemand glaubte noch, dass er jemals wieder aufwachen würde, auch bei seinen Eltern war die Hoffnung auf ein Minimum geschrumpft. Aber dann geschieht das Wunder: Gerry, der Krankenpfleger, hat etwas gespürt, als er bei Felix im Zimmer war. Etwas Unheimliches, ihm Angst machendes, das seinen Magen krampfig in die Knie zwang. Und sein Nacken wurde heiß, „als drückte erhitzter Atem dagegen.“ Dann war da noch das Licht, „ein Aufblitzen, wo nichts war, das aufblitzen konnte.“
Lange lag Felix im Koma, genau 263 Tage. Und exakt 263 Tage war seine Mutter vor elf Jahren mit ihm schwanger gewesen. Jetzt wird er aus dem Krankenhaus entlassen, dem einzigen Ort, den er kennt. Der ihm ein bisschen vertraut ist. Soll nach Hause, ohne ein Gefühl dafür zu haben, was „zu Hause“ überhaupt ist. Mit zwei für ihn wildfremden Erwachsenen unter einem Dach wohnen, ohne eine Vorstellung zu haben, wer diese seine Eltern eigentlich sind. Freunde, Schule, Ferien – für Felix sind das nur Worthülsen, ohne Emotionen, ohne Erinnerungen. „Normal“ sollen sie ihren Sohn behandeln, schärft der Psychologe seinen Eltern ein. Geduldig sein. Ihm Zeit lassen, wieder ins Leben zu finden:
„Sie müssen sich darauf einstellen, dass er in mancherlei Hinsicht anders wird.“
Und wie er anders geworden ist. Dabei wollte doch seine überfürsorgliche, ehrgeizige und alles überwachende Mutter „ dass ihr Sohn haargenau wieder der wurde, der er vor dem Unfall gewesen war.“ Und zwar so schnell wie möglich. Stattdessen werden ihre Zukunftspläne einfach weggeschnippt, und ihr buntes Kartenhaus kommt ins Schliddern:
„Zum Sommerende, knapp sieben Wochen, nachdem er aus dem Krankenhaus entlassen worden war, überraschte Felix seine Mutter im Wäschekeller, wo er ihr nüchtern, aber bestimmt ankündigte, sich ab jetzt anders zu nennen, nämlich Anders.“
Andreas Steinhöfel, der meisterhaft mit Sprache und Ebenen spielt, ist mit „Anders“ wieder ein grandioser Roman gelungen, der vom Ausbrechen erzählt aus den Rollen, die andere für uns erdacht haben und uns glauben machen, dass wir das tatsächlich sind. Er erzählt vom Loslassen, Sich-Fallenlassen und neu erfinden, neu verorten. Langsam breitet sich die Geschichte um Anders aus. Dehnt sich pulsierend, wächst fast lautlos, aber umso beharrlicher, wie die Kreise auf dem Wasser, wenn man einen Stein hineingeworfen hat. Sie zieht in die Tiefe, in die Strudel unter der glatten Oberfläche eines fest definierten Lebens. Dorthin, wo es tobt und brüllt, so lange, bis die aufgebrachten Wogen nach oben schießen und sich gischtspritzend Luft machen. Dicht und immer dichter wird es um Anders, der Farbfernsehen nicht mehr erträgt, weil es ihm in den Augen wehtut, seine Aufmerksamkeit zerstreut. Der in Menschen schauen kann, sie wie ein Synästhetiker als Farbe wahrnimmt, ihre Krankheiten, ihre Trauer. Dessen Augen kalt und eisig grau strahlen, selbst wenn er lächelt, oder ein flüssiges Silbergrau verströmen.
Anders macht den meisten Menschen Angst mit seinem Anderssein. Sie fühlen sich von ihm ausgezogen. Nackt. Er bringt ihre Welt ins Schwanken. Und seine ist am Tosen:
„Ich muss, wenn es um mich und in mir zu laut wird, entweder ganz still sitzen, oder ich muss mich sehr schnell bewegen, denn Stillsitzen erfordert Fokussierung, Bewegen verlangt Konzentration. Doch welchen Zustand ich auch einnehme: In ihm kann ich die mich erfüllenden Farben und Töne bündeln zu Nadeln aus gleißendem Licht. In diesem Licht lese ich Menschen, und mit den Nadelspitzen steche ich ein Muster in die Haut der Welt.“
Anderen tut er gut:
„Er strahlt die Ruhe aus, wie sie unmittelbar vor dem Einschlafen in dir aufkommt, wenn du in den ersten Traum der kommenden Nacht gleitest, er verströmt Trost, wenn dein Innerstes von etwas erschüttert ist, wenn Angst dich quält oder Unrast dich erfüllt; wo deine Welt verrückt, reicht seine bloße Anwesenheit aus, sie wieder in ein Gleichgewicht zu bringen, und wo sie zerbricht, entgratet sein Lachen die schmerzhaft scharfen Kanten ihrer Bruchstellen.“
Seine ehemaligen Freunde tauchen auf, sein Mathenachhilfelehrer, und langsam verweben sich die einzelnen Geschichten. Verschmelzen zu einer, einer unheimlichen, dunkel düsteren. Wo die Symbolik von schaurig Märchenhaftem unheilvoll dröhnt und wummert, die Sprache in finsteren Grautönen vibriert und sich wie Paukenschläge im Bauch einnistet. Wo das beobachtend Erzählerische, das empathisch Distanzierte, das Krimimäßige von einer ungeheuerlich tönenden Woge philosophischer Seelentiefe überrollt wird. Auf den Leser überschwappt, mit Beklemmung füttert. Ihn berührt.
Fixpoetry 2015
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung von Fixpoetry.com und der Urheber
Dieser Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Sie dürfen den Artikel jedoch gerne verlinken. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.




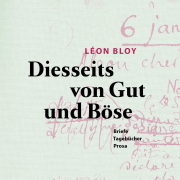
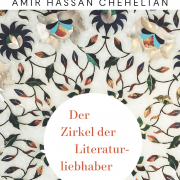



Neuen Kommentar schreiben