Von Abalone bis Zi-Fisch
Im Mittelalter verstand man unter einem „Bestiarium“ eine Dichtung, die typisch menschlichen Eigenschaften und Schwächen im Bild der Tiere einen Spiegel vorhält. Diese Form barg ein derart vielsagendes Potential, daß sie in der Neuzeit von Guillaume Apollinaire, Franz Blei, Jorge Louis Borges und anderen aufgegriffen und weiterentwickelt wurde. Der erste Gedichtband des Amerikaners Jeffrey Yang ist ein solches Bestiarium für das noch junge 21. Jahrhundert. Und was für eines!
Jeffrey Yang erweist sich als poeta doctus im besten Sinne, seine Dichtung hat sich ganz dem Sichtbaren, den Fakten und den Dingen verschrieben. Wohltuend tritt die Persönlichkeit des Autors hinter die Welt zurück und nur als ordnendes Bewußtsein des enzyklopädischen Wissens in Erscheinung. „Enkyklios paideia“, der Grundkreis der Bildung, umschließt für Yang in der Epoche der Globalisierung nicht nur die Meere, wie der Titel seines Bandes vermuten ließe, sondern den gesamten Weltkreis. Aus allen Himmels- und Fachrichtungen fließen die termini technici und Nomenklaturen in seine Gedichte, in harten Schnitten und kühnen Montagen. Trotz dieser stupenden Gelehrsamkeit fühlt man sich niemals grob geschulmeistert, oberlehrerhaft bevormundet, im Gegenteil, der Leser wird zum verblüfften Zaungast der Dinge, er darf einen (durchaus ehrfürchtigen!) Blick in das riesige Meeres-Aquarium werfen, in dem sich Abseitiges und Erstaunliches gleichermaßen tummelt.
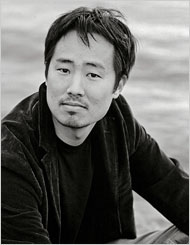
Jeffrey Yang © Nina Subin
In einem seiner berühmtesten Gedichte hatte D.H. Lawrence ausgerufen: „Man sagt, das Meer ist kalt, aber das Meer beherbergt das heißeste und wildeste und dringlichste Blut von allen.“ Wen treffen wir also? Dinoflagellaten, Foraminiferen, Mormyriden und Glassalmler. Doch das Aquarium ist eine Metapher für den Planeten, der durch den Raum schwimmt, darum begegnen wir nicht zuletzt dem italienischen Guerillakämpfer Giuseppe Garibaldi und dem Dichter Kenneth Rexroth. Oder den USA, „ein Fisch mit einem Kreislaufsystem aus schwarzem Gold“. Oder „Google, ein Bewusstseinsmeer. / Das Meer wird kleiner, dehnt es sich aus. / Wie Oz: das klügste Wesen, / das nichts weiß.“ So steht alles zueinander in Verbindung, ein Ökosystem menschlichen Wissens, das letztlich nur zu der Erkenntnis führt, daß die Dinge auch ohne uns — und vielleicht besser — existieren, jedenfalls dem abschließenden Zitat von Sir Thomas Browne zufolge: Alles also in Verbindung, verknüpft, verkettet, von Horizont zu Horizont: Philosophie (östliche und westliche), Naturwissenschaft, Religion, Geschichte, Kunst, Literatur, Politik.
Zuweilen fühlt man sich ein wenig an Ezra Pounds „Cantos“ erinnert, nur kondensierter und im Kleinformat. Nichts ist jedoch epigonal, im Gegenteil, der Band ist erfrischend in der Abwesenheit emotionalen Geplänkels und leblos wirkender Artistik, ein dynamisches Debut, wie es auch in den Vereinigten Staaten selten geschieht. Denn hier wagt einer, modernes Wissen und alte Weisheiten auf eine Stufe zu stellen, Postmoderne und alchemistische Tradition in Einklang zu bringen: „Alle irdischen Wege führen zum Krieg. Doch vergiss nicht: / Haliotis sind Hämophile — ein Schnitt und / sie bluten zu Tode. Hüte dein Herz.“ („Abalone“) In dieser mit allen Wassern gewaschenen Dichtung ist es nur ein kleiner Sprung von den Zooxanthellen zu einer langen Threnodie über die amerikanischen Atomtests im Bikini-Atoll, wobei der Autor wiederum hinter die Fakten zurücktritt und sie für sich selbst sprechen läßt — was seine Kritik umso schneidender, die Wirkung umso größer macht. Doch es gibt daneben Raum genug für die Fülle und Schönheit, die immer bedrohte, und das meditative Nachsinnen: das Gedicht „Vakuum“ zum Beispiel besteht nur aus einem Zitat über ein Vakuum, und man denkt unwillkürlich an John Cages 4’33’, in dem die Musik allein aus den Geräuschen besteht, die den reglos vorm Klavier sitzenden Pianisten umgeben.
Die Übersetzung von Beatrice Faßbender findet stets das Gleichgewicht zwischen Freiheit und Genauigkeit, in dem eine Übersetzung zu Poesie in der Zielsprache wird. So stehen sich Original und deutsche Fassung beinahe gleichberechtigt und einander ergänzend gegenüber, bei einem Buch dieses Schwierigkeitsgrades keine Selbstverständlichkeit und deshalb umso erfreulicher.
Fixpoetry 2012
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung von Fixpoetry.com und der Urheber
Dieser Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Sie dürfen den Artikel jedoch gerne verlinken. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.









Neuen Kommentar schreiben