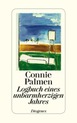weitere Infos zum Beitrag
Roman
Die Frau, die dem Tod zu nah kam. »Logbuch eines unbarmherzigen Jahres« von Connie Palmen.
17.05.2013 | Hamburg
Ein Buch von Connie Palmen zu lesen heißt, sich auf vertrautes Terrain zu begeben. Es gibt eine Handvoll Romanpersonal: im Hintergrund die verständnisvolle, farblose Familie der Ich-Erzählerin; im Vordergrund die Ich-Erzählerin selbst, eigensinnig und emotional, die enge Freundin, der Analytiker und mindestens ein charismatischer, gezeichneter Mann. Immer geht es ums Übermaß: Exzessiv wird geliebt, getrunken und geschädigt.
Ihre literarischen Figuren bewegen sich in unmittelbarer Nähe zu Connie Palmens Lebenswelt. Der erste Mann, den sie begraben musste, hieß Ischa Meijer; ihm hat sie das Buch „I.M.“ gewidmet. Der zweite hieß Hans von Mierlo: in seinem Gedenken ist das „Logbuch eines unbarmherzigen Jahres“ erschienen, ein Buch, in dem Ich-Erzählerin und Autorin endgültig zusammenfallen. Ein Buch, das Palmen dennoch nicht als Journalauszug verstanden wissen will:
„Das Wort Tagebuch sagt mir nicht zu. »Logbuch« erscheint mir besser. Man kann ein Log in den Strom des Kummers senken, dessen Geschwindigkeit messen, dessen Tiefe peilen. Da darf man auch tagelang untätig liegen bleiben, weil man nicht weiter kann, weil das Log im Schlamm stecken geblieben ist oder weil man an der eigenen Ohnmacht angelegt hat.“
Hans van Mierlo war in seinem Land ein hoch beliebter Politiker; man nannte ihn den „niederländischen Kennedy“. Er war Mitbegründer und zentrale Figur der linksliberalen Partei „D66“, er war Verteidigungsminister, Außenminister und stellvertretender Ministerpräsident. Connie Palmen war seine dritte Ehefrau und vierundzwanzig Jahre jünger als er. Van Mierlo wurde 78 Jahre alt und hatte fünf Vornamen, von denen keiner „Hans“ lautete. Nichts davon erfährt man aus Palmens Buch.
Wie in ihrem Roman „Ganz der Ihre“ dreht sich vordergründig alles um einen Abwesenden, einen nicht Greifbaren. In „Ganz der Ihre“ war dies Salomon Schwartz: ein charmanter, getriebener Herzensbrecher, der verdächtig an Ischa Meijer erinnerte. Hans von Mierlo aber war einer von den Guten, ohne größere Abgründe, ohne kompromittierendes Material. Ein guter Mensch reicht nicht aus, um ein Buch zusammen zu halten; vielleicht kreist Palmen auch deswegen nicht um ihre zweite große Liebe, sondern um sich selbst.
Was fehlt, behauptet sie auf der ersten Seite, sei vor Allem der Sex. Etwas, das wohl kein Trauernder zugäbe, und der erste von vielen Tabubrüchen, die die Autorin sich leistet. Ob sie Trauer mit der Arbeit an einem Roman vergleicht, den Verlust zweier großer Lieben nonchalant unter „voriger Tod“ und „neuer Tod“ zusammenfasst, eine Hierarchie des Leidens aufstellt oder mit einer Freundin über Verstorbene lacht:
„Zum Beweis, dass ihr Buch schwärzer ist, als ich mutmaße, erzählt Kristien, dass nach seinem Erscheinen zwei Menschen Selbstmord begangen hätten. Beide Selbstmörder seien aus dem Fenster gesprungen. Der eine sei auf einem Mann gelandet, der diesen Selbstmord nicht überlebt habe... es ist ein Slapstick, wir können gar nicht mehr aufhören zu lachen, wir ersticken fast daran.“
Palmen scheint förmlich nach dem Tod zu gieren. Akribisch durchstöbert sie Todesanzeigen, zählt alle Sterbefälle auf, die sich im engeren und weitesten Umfeld ereignen; auch die Tode Fremder versucht sie sich literarisch einzuverleiben. Ausgiebig werden andere Literaten zitiert, die vom Sterben schrieben – von Roland Barthes bis Philip Roth. Immer wieder ist die Rede von wuchernden Tumoren und entstellten Körpern, vom Elend der Sterbenden und Überlebenden – eine Kakophonie von Schmerz, die bald nicht mehr schockiert, sondern nur noch ermüdet, weil sie so durchschaubar platziert ist.
Der Alltag, in den Connie Palmen ihren Leser zerrt – ein Alltag, in dem sie Kreuzworträtsel löst, Brot klein schneidet und abends versucht, nur noch eine halbe Flasche Wein zu trinken – ist eine von Trauer durchsetzte, aber doch banale Routine. Es scheint, als wollte sie durch fremde Geschichten ihre eigene aufwerten, und tatsächlich bewegen die Grabesrede ihres Bruders oder fremde Gedichte und Romanauszüge mehr als das Bild, das Palmen von sich selbst zeichnet: Eine Frau, die sich erst an ihren todkranken Freund erinnert, als er das Cover ihres neuen Buchs entwerfen soll. Die am Krankenbett ihres Mannes an ihrem neuen Roman schreibt. Die SMS ihrer todkranken Stieftochter öffentlich macht. Die im Drang nach literarischer Selbstdarstellung wenig Rücksicht auf die Hinterbliebenen ihres Mannes nimmt.
„Um Marie zu beruhigen, spule ich wieder meine Geschichte ab, dass es eine Chronik, ein Logbuch der Trauer ist... Laien haben ganz andere Vorstellungen davon, was privat ist und was nicht als wir, die Schriftsteller.“
Palmen lässt den Leser lange warten, bis sie die Liebe zweier Menschen greifbar, fühlbar werden lässt. Erst in der zweiten Hälfte des Buchs gibt sie preis, wie die beiden einander kennen lernten, erzählt von gemeinsamen Momenten und vor Allem von den letzten Tagen der beiden: er im Delirium auf der Intensivstation, sie Tag und Nacht wachend an seinem Bett. Der dicht skizzierte Tod ihres Mannes fügt alle vorangegangenen Gedankenfetzen zu einer Geschichte zusammen: der Geschichte einer tiefen, bedingungslosen Verbindung.
„Es ist Nacht. Er sitzt aufrecht im Bett und spricht zum Parteikongress der D66. Er gestikuliert und versucht seine Parteifreunde von seinem Standpunkt zu überzeugen. Nach seiner Rede folgt die Abstimmung des Kongresses. Er schaut nach links und rechts und sieht sich die erhobenen Hände im Saal an. »Ich danke Ihnen allen herzlich für Ihr Vertrauen«, sagt er. Er wundert sich nicht darüber, dass ich ihn in den Armen halte. Das Einzige, was er merkwürdig findet, sind die Infusionsschläuche, die ihn behindern, wenn er die Arme hebt, und der Sauerstoffschlauch in seiner Nase, mit dem er auf dem Podium sicher komisch aussieht. Er zieht ihn immer wieder heraus und schiebt ihn auf seine Stirn. Ich nehme ihn immer wieder herunter und schiebe ihn in die Nase zurück.“
Erinnern, das ist ein Auswahlverfahren, das im Trauern außer Kontrolle gerät. Vergessen bedeutet für den Trauernden, erneut Abschied zu nehmen, erneut Trennungsschmerz durchleben zu müssen. Connie Palmen schreibt in ihrem „Logbuch eines unbarmherzigen Jahres“ gegen das Vergessen an und verliert sich darin über weite Strecken in Banalitäten, in hermetischen Sprachspielen, die für niemanden außer ihr selbst nutzbar gemacht werden können. Ein Logbuch darf man nicht anzweifeln; Connie Palmen aber ist keine Zeugin, die akribisch Ereignisse notiert. Sie macht sich selbst zum Ereignis.
Exklusivbeitrag
Connie Palmen: Logbuch eines unbarmherzigen Jahres. Aus dem Niederländischen von Hanni Ehlers 264 Seiten, 21,90 EUR. ISBN: 325706859X. Diogenes Verlag Zürich, Februar 2013
Dies ist Dana Buchziks erster Feuilletonbeitrag auf Fixpoetry. Sie wird in Zukunft regelmäßig für uns schreiben.