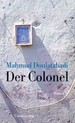weitere Infos zum Beitrag
Roman
Persische Elegien – ein Roman aus der Revolutionszeit des Iran
Die Rahmenhandlung des Romans ist schnell erzählt. Der Colonel wird an einem verregneten Abend informiert, dass eine seiner beiden Töchter ums Leben gekommen ist und er sie nun beerdigen muss. Er hat solange Zeit, wie die Nacht ihre Schatten über die Stadt legt, denn der Tod seiner Tochter soll ein geheimer Tod bleiben. Es ist der Tod in den Folterkammern eines skrupellosen Regimes. Während der Colonel mit der Beerdigung seiner Tochter befasst ist, wird er von den Geistern seiner Familie heimgesucht. Kaleidoskopisch berichtet Doulatabadi so in Rückblicken von den Schicksalsschlägen einer Familie, die zwischen den Mühlsteinen der Revolution aufgelöst wird. Die Erzählzeit dieser Rahmenhandlung beträgt weniger als 24 Stunden. Die erzählte Zeit des Romans erstreckt sich nahezu über die gesamte Geschichte des Irans im 20. Jahrhundert.
Die Rückblenden sind die bruchstückhaften Erinnerungen des Colonels an die Schicksale seines Vaters und seiner Kinder, die in den reißenden Fluss der unterschiedlichen politischen und ideologischen Strömungen während der Iranischen Revolution 1979 geraten sind. Metaphorisch überträgt Doulatabadi die Brüche zwischen den Generationen und den politischen und religiösen Glaubensrichtungen auf die kleine Welt einer Familie. In diesem Mikrokosmos entladen sich die Konflikte zwischen Nationalisten, Royalisten, Liberalen und religiösen Fundamentalisten. Der Zerfall der Familie symbolisiert die Auflösung der iranischen Gesellschaft. Die damit verbundenen Schicksalsschläge und Zwänge symbolisieren das gegenseitige Hauen und Stechen in einer Gesellschaft, in der eine klare Trennung zwischen Tätern und Opfern nicht mehr möglich ist, denn nahezu jede Generation hat ihren Gewaltausbruch erlebt. Worte wie Menschlichkeit, Schonung oder Gnade haben in einer solchen Welt ihre Bedeutung verloren.
Zu seinen Kindern drang der Colonel als Repräsentant des alten Regimes schon lange nicht mehr durch. Die Tatsache, dass er dem Schah-Regime treuer Diener war, hindert ihn jedoch nicht daran, Verständnis für den Aufruhr und die Empörung seiner Kinder zu haben. "Und in Zeiten der Revolution sucht jeder seinen eigenen Vorteil. Es sei denn, man ist noch jung. Junge Menschen haben nicht nur ihren Vorteil im Auge. In Zeiten der Revolution suchen sie ihre eigene Wahrheit, ihre eigene Lebenswahrheit." Unterstellt Doulatabadi der Revolution also die Chance der Selbstverwirklichung, der gesellschaftlichen Selbstfindung? Möglicherweise. Aber vor allem Revolution attestiert er der Revolution eine unglaublich starke Realität, die in das Leben derjenigen eindringt, die sie erleben. Die das Leben und Erleben nicht nur verändert, sondern auch beendet – und damit neue Traurigkeit und Wut schafft, um die Gewaltspirale weiter nach oben zu schrauben.
Doulatabadi macht diesen Gewalt produzierenden Mechanismus von Liebe und Hass in einer Szene besonders greifbar. Darin erinnert sich der Colonel daran, wie einer seiner Söhne den gewaltsamen Tod seines Bruders erleben muss und er beobachtete, wie der Hass gegen die Welt in seinem Sohn hochstieg und sich auf die übrigen Geschwister übertrug. Eine Szene, die die Simplizität der Geburt von Wut und Fanatismus bezeugt. "Er kniete neben dem Leichnam seines Bruders, beugte sich über ihn, küsste sein blutiges Hemd, und als er sich wieder erhob, sah ich, wie Flammen aus den Augen meines Sohnes loderten, wie seine Wangen glühten. […] Ich sah, wie das Feuer die Herzen jedes meiner Kinder ergriffen hatte." Dieser sachlich unverstellte Blick auf die Ereignisse liegt dem Leser wie ein zentnerschwerer Stein auf der Brust.
Die Rückblenden sind die bruchstückhaften Erinnerungen des Colonels an die Schicksale seines Vaters und seiner Kinder, die in den reißenden Fluss der unterschiedlichen politischen und ideologischen Strömungen während der Iranischen Revolution 1979 geraten sind. Metaphorisch überträgt Doulatabadi die Brüche zwischen den Generationen und den politischen und religiösen Glaubensrichtungen auf die kleine Welt einer Familie. In diesem Mikrokosmos entladen sich die Konflikte zwischen Nationalisten, Royalisten, Liberalen und religiösen Fundamentalisten. Der Zerfall der Familie symbolisiert die Auflösung der iranischen Gesellschaft. Die damit verbundenen Schicksalsschläge und Zwänge symbolisieren das gegenseitige Hauen und Stechen in einer Gesellschaft, in der eine klare Trennung zwischen Tätern und Opfern nicht mehr möglich ist, denn nahezu jede Generation hat ihren Gewaltausbruch erlebt. Worte wie Menschlichkeit, Schonung oder Gnade haben in einer solchen Welt ihre Bedeutung verloren.
Zu seinen Kindern drang der Colonel als Repräsentant des alten Regimes schon lange nicht mehr durch. Die Tatsache, dass er dem Schah-Regime treuer Diener war, hindert ihn jedoch nicht daran, Verständnis für den Aufruhr und die Empörung seiner Kinder zu haben. "Und in Zeiten der Revolution sucht jeder seinen eigenen Vorteil. Es sei denn, man ist noch jung. Junge Menschen haben nicht nur ihren Vorteil im Auge. In Zeiten der Revolution suchen sie ihre eigene Wahrheit, ihre eigene Lebenswahrheit." Unterstellt Doulatabadi der Revolution also die Chance der Selbstverwirklichung, der gesellschaftlichen Selbstfindung? Möglicherweise. Aber vor allem Revolution attestiert er der Revolution eine unglaublich starke Realität, die in das Leben derjenigen eindringt, die sie erleben. Die das Leben und Erleben nicht nur verändert, sondern auch beendet – und damit neue Traurigkeit und Wut schafft, um die Gewaltspirale weiter nach oben zu schrauben.
Doulatabadi macht diesen Gewalt produzierenden Mechanismus von Liebe und Hass in einer Szene besonders greifbar. Darin erinnert sich der Colonel daran, wie einer seiner Söhne den gewaltsamen Tod seines Bruders erleben muss und er beobachtete, wie der Hass gegen die Welt in seinem Sohn hochstieg und sich auf die übrigen Geschwister übertrug. Eine Szene, die die Simplizität der Geburt von Wut und Fanatismus bezeugt. "Er kniete neben dem Leichnam seines Bruders, beugte sich über ihn, küsste sein blutiges Hemd, und als er sich wieder erhob, sah ich, wie Flammen aus den Augen meines Sohnes loderten, wie seine Wangen glühten. […] Ich sah, wie das Feuer die Herzen jedes meiner Kinder ergriffen hatte." Dieser sachlich unverstellte Blick auf die Ereignisse liegt dem Leser wie ein zentnerschwerer Stein auf der Brust.