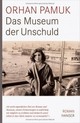weitere Infos zum Beitrag
Roman
Ein Roman wie Aspirin für Liebeskranke – Orhan Pamuks „Museum der Unschuld“
Acht Jahre lang geht das so dahin, bis etwas Unvorhergesehenes passiert und Füsun wider Erwarten doch noch frei wird, wenn auch nicht für Kemal. Aus welchem Grund genau Kemal danach seiner Sammlerleidenschaft völlig ungehemmt frönt, soll hier natürlich nicht verraten werden, genauso wenig welches Ende die Liebesgeschichte zwischen Füsun und Kemal schließlich nimmt. Nur soviel: ganz so tragisch wie Romeo und Julia ist es nicht, aber das werden die Leser erst mit dem letzten Satz des Romans genauer wissen. Bis es aber so weit kommt, bekommt man einen Eindruck vom Leben der Oberschicht in der Türkei in den Siebzigern und Achtzigern, Orhan Pamuk streift die Politik ebenso wie das Alltagsleben, oder diverse Sexszenen sowie das türkische Film- und Reklamemilieu dieser Zeit, vor allen Dingen aber wird man Zeuge einer ganz großen, obsessiven Liebe, die vielmehr über ihren Urheber erzählt als über das eigentliche Objekt der Begierde. Dieses, Füsun, kommt nämlich eigentlich erst am Schluss des Romans richtig zu Wort, aber das ist ja oft so, dass man sich eigentlich mehr selbst liebt, in der Liebe zu dem anderen, als den anderen. Siehe Zizek, siehe Wagner. Kemal jedenfalls weiß, dass Sibel eigentlich Recht hat, wenn sie sagt, dass er, Kemal, sich in der Rolle als leidender Mann gefalle, der an allem etwas auszusetzen habe, er es so möchte und dies dementsprechend inszeniere. Wohl noch kein anderer Schriftsteller hat dieses Gefühl, das "Liebesleid" wie es Kemal nennt, oder was gemeinhin auch als Liebeskummer bezeichnet wird, so gut beschrieben wie Orhan Pamuk in seinem "Museum der Unschuld": "Das Leben hatte sich gewissermaßen von mir zurückgezogen, hatte seine Kraft und seine Farben eingebüßt, und die Dinge waren nicht mehr so unmittelbar und so echt, wie ich es früher empfunden hatte. Gerard de Nerval, der sich schließlich aus Liebeskummer erhängen sollte, meinte, sein Leben, nachdem er seine Liebe für immer verloren hatte, biete ihm nur mehr "billige Zerstreuung". Kemal geht es ganz ähnlich ohne seine Füsun, nämlich, dass alles was er unternahm, "nichtig und leer" war, aber dennoch gibt er seine Hoffnung – zu recht übrigens, so viel darf hier verraten werden – nie ganz auf, eines Tages, seine Füsun wieder in die Arme schließen zu dürfen.
Kemal verfällt immer mehr, da er dem Alkohol zuspricht, der Raki, den er trank, "um das Böse in mir loszuwerden, holte genau dieses Böse schließlich aus mir hervor". "Ich spürte, dass ich wie blind war und vor lauter Liebe und Eifersucht nichts mehr richtig einordnen konnte. Ich litt wie ein Tier in der Falle und wusste nur allzu gut, dass mir nur geholfen hätte, Füsun zu sehen. Die Welt kümmerte mich nicht, wo doch alles nur schal und leer war." In seinem 2006 auf Deutsch bei Hanser erschienen Werk "Istanbul- Erinnerungen an eine Stadt" beschreibt Orhan Pamuk ein ganz ähnliches Gefühl, nämlich "Hüzun" und es mag nur ein Zufall sein, dass beide Worte, Füsun und Hüzun, in europäischen Ohren zumindest ähnlich klingen, in jedem Fall aber dasselbe ausdrücken: die Sehnsucht nach einem anderen, perfekteren Ort, einem Paradies im andern und die Vorstellung, dass der oder die andere diese Forderung nach Perfektion erfüllen könnte. Das deutsche Wort "Wehmut" trifft das türkische "Hüzun" wohl am ehesten, Begriffe wie Melancholie oder Tristesse ebenso. "Hüzun", so Pamuk, treffe die Gefühlslage, die von einer Gesellschaft geteilt wird, besser als das Wort Melancholie; ein Seelenzustand, der dagegen vom einzelnen Individuum empfunden werde. "Hüzun" umfasse in "Istanbul" (seinem Buch sowohl als der Ort) gleichzeitig ein wichtiges lokales "musisches" Gefühl, ein Grundwort für Dichtung, eine Weltansicht, ein Seelenzustand und Ausdruck dessen, was die Stadt ausmache. Deshalb sei es sowohl ein negatives wie auch ein positives Gefühl. "Hüzun" läge gleichermaßen in Momenten, Bildern und Orten wie den Gassen mit Pflastersteinen, den stillgelegten Häfen mit ihren alten Bosporus-Schiffen, oder den unbeweglich im Regen stehenden Möwen auf den verrosteten Bojen, schrieb Pamuk 2006 in "Istanbul". 2008 heißt es dann – im Namen Füsuns: "Wessen Leben durch die Liebe auf den Kopf gestellt wird, so wie meines, der meint immer, zusammen mit dem Liebesleid würden auch alle anderen Sorgen ein Ende finden, und so rührt er unwillkürlich immer wieder an der Wunde in sich drinnen". Als dann auch noch sein Vater stirbt, vereinigten sich beide Verluste zu einem "einzigen Einsamkeits- und Verlassenheitsgefühl" und einzig die Gegenstände oder Dinge im Merhamet Apartmani konnten diesen, seinen Schmerz stillen, die Schmerzen lindern. Bald muss Kemal einsehen, dass seine Liebe zu Füsun eigentlich gar nicht von ihrer Schönheit herrühre, sondern eine Reaktion seines Unterbewussten auf eine mögliche Ehe mit Sibel war. Doch dieser Schlüsselgedanke verliert sich bald wieder in seinem Bewusstsein, da ihm die Sammlerleidenschaft eine ausreichende Ersatzbefriedigung verschafft.
Aber vielleicht idealisiert er Füsun ja nur, weil er gar nicht – weder Sibel noch Füsun noch irgendwen sonst – heiraten möchte? An seiner Mutter liegt es jedenfalls nicht, denn die sagt gleich zweimal im Buch, dass sie ihn ja ohnehin nicht zu dieser Sibel zwingen wollte, da sie keine Katzen möge. (sic!) Auch an anderen Stellen ist Orhan Pamuk übrigens nicht um Situationskomik verlegen, das Buch liest sich immer wieder amüsant und unterhaltsam, nicht nur wegen der teils abstrusen Angewohnheiten und Gedanken Kemals, sondern auch den Dialogen und dem Lokalkolorit Istanbuls, der wohl faszinierendsten Stadt Europas. "Dich so glücklich zu sehen hat mir das Glück verschafft, das ich suchte", sagt Kemal etwa an einer Stelle, im Wohnzimmer der Verwandten bei einem der unzähligen (gezählte 1593male!) gemeinsamen Fernsehabende zu seiner Angebeteten. Dass diese, Füsun, in Wirklichkeit keineswegs glücklich ist, weil sie tatsächlich die Karriere einer Filmschauspielerin anstrebt, aber niemand sie lässt, spielt dabei weniger eine Rolle, als die Befriedigung des Betrachters gegenüber dem Objekt der Begierde. Nicht ihr Glück ist es schließlich, das zählt, sondern das Glück des Betrachters, des Fetischisten, des Voyeurs, der in seiner ganzen Aufopferung doch im Endeffekt sich selbst am meisten liebt und dies geradezu rücksichtslos auf das Ansehen der Betroffenen bezüglich Anstand und Moral und dem Geschwätz der Leute. Schließlich hatte Kemal Füsun entehrt und sich dann mit einer anderen verlobt, um sie nun, acht Jahre später, durch seine vielen Besuche erneut dem Spott der Nachbarn auszusetzen. Mit Jungfräulichkeit in die Ehe zu gelangen war zwar auch in der Türkei in den Siebzigern nicht mehr das angestrebte Ideal, da sich zumindest die Oberschicht durchaus modern und aufgeschlossen geben wollte, aber zumeist heiratete man eben auch die Partnerin, mit der man "bis zum Letzten" gegangen war. Kemal hatte also gleich die Ehre zweier Frauen auf dem Gewissen, wenn man so will.
Kemal verfällt immer mehr, da er dem Alkohol zuspricht, der Raki, den er trank, "um das Böse in mir loszuwerden, holte genau dieses Böse schließlich aus mir hervor". "Ich spürte, dass ich wie blind war und vor lauter Liebe und Eifersucht nichts mehr richtig einordnen konnte. Ich litt wie ein Tier in der Falle und wusste nur allzu gut, dass mir nur geholfen hätte, Füsun zu sehen. Die Welt kümmerte mich nicht, wo doch alles nur schal und leer war." In seinem 2006 auf Deutsch bei Hanser erschienen Werk "Istanbul- Erinnerungen an eine Stadt" beschreibt Orhan Pamuk ein ganz ähnliches Gefühl, nämlich "Hüzun" und es mag nur ein Zufall sein, dass beide Worte, Füsun und Hüzun, in europäischen Ohren zumindest ähnlich klingen, in jedem Fall aber dasselbe ausdrücken: die Sehnsucht nach einem anderen, perfekteren Ort, einem Paradies im andern und die Vorstellung, dass der oder die andere diese Forderung nach Perfektion erfüllen könnte. Das deutsche Wort "Wehmut" trifft das türkische "Hüzun" wohl am ehesten, Begriffe wie Melancholie oder Tristesse ebenso. "Hüzun", so Pamuk, treffe die Gefühlslage, die von einer Gesellschaft geteilt wird, besser als das Wort Melancholie; ein Seelenzustand, der dagegen vom einzelnen Individuum empfunden werde. "Hüzun" umfasse in "Istanbul" (seinem Buch sowohl als der Ort) gleichzeitig ein wichtiges lokales "musisches" Gefühl, ein Grundwort für Dichtung, eine Weltansicht, ein Seelenzustand und Ausdruck dessen, was die Stadt ausmache. Deshalb sei es sowohl ein negatives wie auch ein positives Gefühl. "Hüzun" läge gleichermaßen in Momenten, Bildern und Orten wie den Gassen mit Pflastersteinen, den stillgelegten Häfen mit ihren alten Bosporus-Schiffen, oder den unbeweglich im Regen stehenden Möwen auf den verrosteten Bojen, schrieb Pamuk 2006 in "Istanbul". 2008 heißt es dann – im Namen Füsuns: "Wessen Leben durch die Liebe auf den Kopf gestellt wird, so wie meines, der meint immer, zusammen mit dem Liebesleid würden auch alle anderen Sorgen ein Ende finden, und so rührt er unwillkürlich immer wieder an der Wunde in sich drinnen". Als dann auch noch sein Vater stirbt, vereinigten sich beide Verluste zu einem "einzigen Einsamkeits- und Verlassenheitsgefühl" und einzig die Gegenstände oder Dinge im Merhamet Apartmani konnten diesen, seinen Schmerz stillen, die Schmerzen lindern. Bald muss Kemal einsehen, dass seine Liebe zu Füsun eigentlich gar nicht von ihrer Schönheit herrühre, sondern eine Reaktion seines Unterbewussten auf eine mögliche Ehe mit Sibel war. Doch dieser Schlüsselgedanke verliert sich bald wieder in seinem Bewusstsein, da ihm die Sammlerleidenschaft eine ausreichende Ersatzbefriedigung verschafft.
Aber vielleicht idealisiert er Füsun ja nur, weil er gar nicht – weder Sibel noch Füsun noch irgendwen sonst – heiraten möchte? An seiner Mutter liegt es jedenfalls nicht, denn die sagt gleich zweimal im Buch, dass sie ihn ja ohnehin nicht zu dieser Sibel zwingen wollte, da sie keine Katzen möge. (sic!) Auch an anderen Stellen ist Orhan Pamuk übrigens nicht um Situationskomik verlegen, das Buch liest sich immer wieder amüsant und unterhaltsam, nicht nur wegen der teils abstrusen Angewohnheiten und Gedanken Kemals, sondern auch den Dialogen und dem Lokalkolorit Istanbuls, der wohl faszinierendsten Stadt Europas. "Dich so glücklich zu sehen hat mir das Glück verschafft, das ich suchte", sagt Kemal etwa an einer Stelle, im Wohnzimmer der Verwandten bei einem der unzähligen (gezählte 1593male!) gemeinsamen Fernsehabende zu seiner Angebeteten. Dass diese, Füsun, in Wirklichkeit keineswegs glücklich ist, weil sie tatsächlich die Karriere einer Filmschauspielerin anstrebt, aber niemand sie lässt, spielt dabei weniger eine Rolle, als die Befriedigung des Betrachters gegenüber dem Objekt der Begierde. Nicht ihr Glück ist es schließlich, das zählt, sondern das Glück des Betrachters, des Fetischisten, des Voyeurs, der in seiner ganzen Aufopferung doch im Endeffekt sich selbst am meisten liebt und dies geradezu rücksichtslos auf das Ansehen der Betroffenen bezüglich Anstand und Moral und dem Geschwätz der Leute. Schließlich hatte Kemal Füsun entehrt und sich dann mit einer anderen verlobt, um sie nun, acht Jahre später, durch seine vielen Besuche erneut dem Spott der Nachbarn auszusetzen. Mit Jungfräulichkeit in die Ehe zu gelangen war zwar auch in der Türkei in den Siebzigern nicht mehr das angestrebte Ideal, da sich zumindest die Oberschicht durchaus modern und aufgeschlossen geben wollte, aber zumeist heiratete man eben auch die Partnerin, mit der man "bis zum Letzten" gegangen war. Kemal hatte also gleich die Ehre zweier Frauen auf dem Gewissen, wenn man so will.