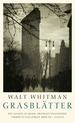Gedichte
Hymnen auf eine erwachende Nation – die Grasblätter von Walt Whitman übersetzt von Jürgen Brôcan
Der amerikanische Schriftsteller Walt Whitman (1819–1892) gilt als Begründer der modernen amerikanischen Dichtung. Ohne sein Lebenswerk »Grasblätter« wäre T.S. Eliots Langgedicht »Das öde Land« wohl kaum denkbar. Nicht umsonst wird Whitman als der amerikanische Homer und Dante Amerikas verehrt. Seine prosaischen, freien Verse haben die amerikanische Literatur geprägt, wie kein zweites dichterisches Werk. Aber auch auf den europäischen Expressionismus hat Whitmans Lyrik einen wesentlichen Einfluss gehabt.
Politisch war er ein leidenschaftlicher Verfechter der amerikanischen Demokratie. Zugleich verabscheute er zutiefst die Sklaverei und die Diskriminierung der Frau. Angesichts der amerikanischen Verfassung von 1787, die weder die Abschaffung der Sklaverei noch die Gleichberechtigung der Geschlechter vorsah, könnte man meinen, dass eine solche Haltung die realen Verhältnisse verkennt. Doch dem ist weit gefehlt. Der amerikanische Nationalpoet gehörte Zeit seines Lebens zu den demokratischen Visionären der Vereinigten Staaten von Amerika. »Aber die neue Welt braucht die Gedichte von Wirklichkeiten und Wissenschaft und vom demokratischen Durchschnitt und von grundlegender Gleichheit.« Die neue Welt, das moderne Amerika, das er in Anspielung auf seine paneuropäische Siedlerbevölkerung als »Tochter der Länder« bezeichnete, gäbe es ohne Visionäre wie Whitman nicht.
Umso größer waren Schmerz und innere Zerrissenheit über den amerikanischen Sezessionskrieg. Seine Hoffnung, die Südstaatler würden auf die Sklaverei verzichten, bevor sie gegen die Nordstaaten in einen Bürgerkrieg ziehen, erfüllte sich nicht. Die Wahl Abraham Lincolns zum amerikanischen Präsident 1860 führte zur Abspaltung der konföderierten (Süd-)Staaten und löste den Krieg aus. Lincoln rechtfertigte den blutigen Krieg des Nordens gegen den Süden zwei Jahre später als Kampf gegen die Sklaverei. Bei der legendären Schlacht in Gettysbury 1864 gelang den Nordstaaten der Durchbruch und 1865 mussten die Südstaaten kapitulieren. Lincolns Position setzte sich durch und somit bestätigte sich Whitmans Vorahnung, dass spätestens der Bürgerkrieg die Sklaverei beenden würde. In den Jahren 1865 bis 1870 wurde die Sklaverei konstitutionell abgeschafft und die ehemaligen Sklaven erhielten die amerikanischen Bürgerrechte. Lincoln selbst konnte die Früchte seines Kampfes nicht mehr ernten. Er wurde 1865 bei einem Theaterbesuch ermordet. Für Walt Whitman war dies nicht nur großer menschlicher Verlust, sondern auch ein tragischer Moment für Amerika. Dem ermordeten Präsidenten widmete er daher sein Gedicht »O Käpt’n! mein Käpt’n“, das er mit den Versen beschließt: »Vor Anker sicher liegt das Schiff, gelungen ist, zu Ende unsre Reise, / Nach schlimmer Fahrt läuft ein der Sieger mit erstrittnem Preise; / Ihr Ufer jubelt, klingt, ihr Glocken! / Doch ich in Schmerz und Not, / Ich bin an Deck, da liegt mein Käpt’n, / Gefallen, kalt und tot.« Mit diesen Zeilen traf Whitman die Befindlichkeit eines Großteils der Amerikaner. Dies war jedoch eine Ausnahme, denn »O Käpt’n! mein Käpt’n« blieb Whitmans einziges, zu Lebzeiten populäres Gedicht.
Whitman war die utopische Programmatik seiner Dichtung bewusst, wenngleich er sich das Scheitern seiner Verse zu Lebzeiten eingestehen musste. So schreibt er in einem Resümee seines dichterischen Schaffens zwei Jahre vor seinem Tod, dass »aus einer weltlichen und geschäftlichen Sicht die ‚Grasblätter’ Schlimmeres als ein Fehlschlag waren.« Und weiter heißt es: »Über ihren Wert wird die Zeit urteilen.«
Ursächlich für den geringen Bekanntheitsgrad seines Werks war sicherlich seine spirituell beeinflusste, prosaische Dichtung, die nicht auf Versmaße wie Jamben, Trochäen oder Daktylen aus war, sondern deren Ziel und Funktion in der Erzählung von Geschichten seiner Zeit bestand. Angelehnt an die italienische Oper und die anglikanische Bibel legte Whitman seiner Literatur den unverstellten menschlichen Redefluss zugrunde. Darüber hinaus konnte er sich mit seiner pragmatischen Gegenwartslyrik nicht durchsetzen. Whitman war der erste Dichter, der die Poesie auf Situationen und Dinge des Alltags anzuwenden wusste. Ihm gelang es, die Lyrik als Literatur der Salons und Universitäten auf die Straße und in die Fabriken zu tragen. Absurderweise haben aber gerade die außerordentliche Nähe seiner Verse zum Alltäglichen und ihre Hinwendung zu den politischen, kulturellen und wissenschaftlichen Entwicklungen seiner Zeit neben dem von Rhythmus und Metrik losgelösten prosaischen Kleid dazu geführt, dass Amerikas größter Dichter zu Lebzeiten weitgehend unverstanden blieb.