|
Glanz@Elend |
Quellen |
|
|
Preisrätsel Verlage A-Z Medien & Literatur Museen & Kunst Mediadaten Impressum |
||
|
Ressorts |
||
|
|
Mit seinem Buch "Peter Handke – Unterwegs ins Neunte Land" möchte Fabjan Hafner aufzeigen, dass das Slowenische bei Peter Handke mehr als nur eine Beschäftigung mit seinen Ahnen ist, sondern nichts weniger als ein Lebensthema, ja der Generalbaß im Gesamtwerk des Dichters. Slowenien ist Sehnsuchtsort, (s)ein Utopia sui generis und bukolisches Traumland. Die gesamte mütterliche Verwandtschaft Handkes gehörte der Minderheit der Kärntner Slowenen an. Besonders der Grossvater, Gregor Siutz (slowenisch: Sivec) und dessen gleichnamiger Sohn sind Lichtgestalten in Handkes Kindheit und Jugend und bleiben darüber hinaus prägend. Hafner betont zwar wiederholt, dass Handke selber eine biografische Deutung seiner Erzählungen (insbesondere seiner Slowenien-Rekurse) ablehnt, konzidiert dann jedoch, dass die lebensgeschichtliche Lesart…ergiebiger sei als die intertextuelle. 1942 wurde Peter Handke in Altenmarkt (bei Griffen) in Südkärnten geboren. 1944 geht die Familie nach Berlin (in den Ostteil der Stadt); Handkes Stiefvater (es stellte sich für Handke erst später erst heraus, dass es sein Stiefvater war) kam aus Berlin. 1948 zurück, hat der kleine Handke das Slowenische vollkommen vergessen und spricht "hochdeutsch", was im Dorf als abgehoben empfunden wird. Er kann sich mit den Einheimischen, wie auch dem Grossvater nur schlecht verständigen; ihren Dialekt versteht er nicht. Hieraus rührt – so Hafner – Handkes generelle Ablehnung des Dialekts gegenüber. Die Familie ist in mehrfacher Hinsicht "am Rand", der junge Handke doppelt unzuhause: Geografisch bewohnt die Familie einen Hof am Dorfrand; es sind "einfache Verhältnisse". Gesellschaftlich sind sie Kärntner Slowenen, also eine Minderheit, andererseits stammt der Mann der Mutter aus Deutschland. In der Familie dient (wie auch unter den "österreichischen Kärntnern") das Slowenische als eine Art Geheimsprache. Handke ist Aussenseiter. Zwischen dem Grossvater, der weitgehend Vaterersatz wird (Handke "überspringt" sozusagen zeitweise eine Generation) und seinem Enkel lockert sich das sprachliche Band; Handkes Schriftsprache ist das Deutsche geworden. Die Internatszeit in Tanzenberg wird von Handke selber rückwirkend sehr negativ betrachtet; er ist dort ebenfalls heimatlos. In der Gruppenbildung "Deutschkärntner" versus "Slowenen" (Hafner weist interessanterweise darauf hin, dass niemand auf den Gedanken kommt, statt "Slowenen" die Bezeichung "Slowenenkärntner" zu verwenden) findet Handke keinen Platz. Er nimmt dort den Unterricht in slowenischer Sprache wieder auf.
Hinwendung zum Slowenischen Eine verstärkte Hinwendung "zum Slowenischen", eine Art Vorfahrenvergegenwärtigung, beginnt mit der Erzählung "Wunschloses Unglück" (1972), in der Handke über seine Mutter und deren Freitod erzählt. Eingehend werden die Bücher seiner "Langsame Heimkehr"-Tetralogie abgeklopft. Die Bücher bis Anfang der 80er Jahre (inklusive "Die Geschichte des Bleistifts") subsumiert Hafner (weitgehend treffend) unter der Kapitelüberschrift Aufbruch heimwärts. Ende der 70er Jahre beginnt Handke mit der Übersetzung zweier Bücher aus dem Slowenischen. Zunächst Florjan Lipuš' "Der Zögling Tjaž" (zusammen mit Helga Mračnikar) und dann Gedichte von Gustav Januš. Übrigens waren beide Autoren, was vielen Beobachtern damals entgangen war, nicht aus Slowenien selbst, sondern können als "Auslandsslowenen" (Lipuš als "Kärntner Slowene") bezeichnet werden. Beide, Lipuš und Januš, besuchten wie Handke das Internat Tanzenberg (ein Zufall?). Handke musste für den "Zögling" die slowenische Sprache praktisch wieder neu erlernen. Die Hilfe von Helga Mračnikar war, wie er selber rückwirkend schreibt, unbedingt notwendig. Januš konnte er dann selber übersetzen. Den Übersetzungen widmet Hafner ein eigenes, kleines Kapitel. Es steht vor dem grössten Abschnitt seines Buches In der Heimat mit der doppeldeutigen Parenthese Auszeit von der Weltgeschichte. Besonders ergiebig wird hier das 1986 erschienene Buch "Die Wiederholung" untersucht. In diesem Buch bricht der Protagonist und Ich-Erzähler Filip Kobal (die Vokabel "kobal" entnimmt Handke dem letzten Satz des "Zögling Tjaž"), der noch nie Österreich verlassen hat, auf, um seinen verschollenen Bruder in Slowenien zu suchen.
Suche nach dem verschollenen Bruder Hafner bemerkt, Cornelia Blasberg, zitierend zutreffend, dass für Filip Kobal gelte, was die meisten Gregor-Figuren im Werk Handkes auszeichnet, er "scheint somit die Chiffre jener Kreisbewegung zu sein, die sich als Zirkel von Ausziehen, sich Verlieren, sich Finden und Heimkehren nachzeichnen lässt". Die autobiografischen Anspielungen sind überdeutlich. Wie Handkes Onkel heisst der gesuchte Bruder Gregor. Und wie Gregor Siutz, der in der Zeit von 1932 bis 1937 die Landwirtschaftsschule in Maribor besuchte und eine Handschrift über den Obstbau verfasste, reist Filip Kobal mit einem "Werkheft" des Bruders welches vor allem vom Obstbau handelt. Handke bemerkt in Interviews selbst, wie wichtig ihm diese Handschrift des Onkels ist (Ich habe sein Obstbaubuch noch bei mir zu Hause…Das schwebt oben im Plafond, und ich sehe jeden Tag hinauf auf die slowenischen Beschreibungen der Äpfel, der Birnen, der 'jabolke' und so weiter und les zumindest ein paar Wörter davon). Gregor Siutz wird (anders als der andere gefallene Mutterbruder) durch die Feldpostbriefe (teilweise in der "verbotenen" Sprache slowenisch) und das "Obstbaubuch" zum "schreibenden Vorfahren" (Hafner zitiert hier Adolf Haslinger); ein Abwesender, der Schrift geworden ist. Und wie Handke sich mit dem Pleteršnik-Wörterbuches von 1894/95 das Slowenische Ende der 70er Jahre wieder nahebringt so benutzt Filip das große slowenisch-deutsche Wörterbuch aus dem neunzehnten Jahrhundert, um die Schrift des Bruders zu entziffern. Dezidiert anders ist allerdings, dass die Romanfigur als Widerstandsheld mindestens phantasiert wird, während der "reale" Gregor zwar ein slowenischer Agitator war, aber letztlich als Slawe in der Armee Hitlerdeutschlands ums Leben kam.
Die "Wiederholung" – keine Suche nach der verlorenen Zeit Und Handke lässt Filip Kobal finden: Erinnerung hiess nicht: Was gewesen war, kehrte wieder; sondern: Was gewesen war, zeigte, indem es wiederkehrte, seinen Platz. Wenn ich mich erinnerte, erfuhr ich: So war das Erlebnis, genau so!, und damit wurde mir dieses erst bewusst, benennbar, stimmhaft und spruchreif, und deshalb ist mir die Erinnerung kein beliebiges Zurückdenken, sondern ein Am-Werk-Sein, und das Werk der Erinnerung schreibt dem Erlebten seinen Platz zu, in der es am Leben haltenden Folge, der Erzählung, die immer wieder übergehen kann ins offene Erzählen, ins grössere Leben, in die Erfindung. Hafner zitiert Frauke Maier-Gossau, die dieses "Verfahren" Handkes treffend zusammenfasst: "…der Verschwundene und seine Hinterlassenschaften sowie die Landschaften und Orte selbst, zu denen sie in einer innigen Beziehung stehen, [dienen] zu nichts anderem als zur Beschwörung von 'Erinnerung': erinnernd ein Bild sich zu machen, von dem für den Suchenden alsdann eine Vorstellung von Zukunft ausgehen kann – eine Hoffnung auf eine andere Art zu leben, die freilich vollends imaginativ bleibt." Hier wird das beschrieben, was auf der rein poetologisch-ästhetischen Ebene seinerzeit durchaus Diskussionen auslöste (und zum grossen Missverständnis führte, Handke sei ein Verfechter slowenischer Unabhängigkeit, Ende der 90er Jahre jedoch mit Handkes (sogenannten) Serbien-Büchern zu heftigen politischen Konfrontationen führen wird. Dabei war immer schon klar: Handke vertraut explizit nicht der gängigen Geschichtsschreibung, die für ihn im Dienst der Gegenwart steht. Das Grundmisstrauen den vermittelnden Instanzen gegenüber, gegen das Vorausgewusste sitzt tief. Handkes Ideal von Überlieferung, die Anschauung, der Augenschein, "verfechtet" ein induktives Verfahren: Und Nahsicht und Weitsicht haben dabei in eins zu gehen: Weitsicht wird erst, wenn Nahsicht wird: Die Sierra fern nur durch das Weggras nah. Poetische Evidenz wohnt nur dem Bild inne nicht die Faktengenauigkeit. Nur die Anschauung führt zur Wiederholung.
Zwillingsbücher Hafner sieht die beiden Bücher zentral in Handkes Werk als sich einander spiegelbildlich ergänzende Zwillingsbücher[:] 'Die Wiederholung' – über die Suche nach dem Vorfahren – und 'Die Abwesenheit' – nach dem Verschwinden des Vorfahren. Diese Übereinstimmung, so Hafner, ist stupend in ihrer Schlüssigkeit. Das Abwesende ist für Handke zugleich das Andere, das seine Beweggründe bestimmt. Am Rande wird erwähnt, dass aus den Landschaftsbeschreibungen in der Erzählung "Die Abwesenheit" (Gattungsbegriff: "Ein Märchen") sehr wohl auf Slowenien als Wander- und Geh-Ort geschlossen werden kann (auch wenn es keine Ortsnamen gibt), diese Indizien jedoch aus dem Film ("L'Absence"), der 1992 als deutscher Beitrag zum Filmfestival in Venedig unter der Regie von Peter Handke gedreht wurde (unter anderem mit Bruno Ganz, Jeanne Moreau und Handkes späterer Frau Sophie Semin), getilgt worden sind.
Das Poetische und das Politische… Wenn aber Hafner feststellt, dass Handkes emphatischer Begriff von Wirklichkeit (der eben gerade nicht die Alltagsrealität, sondern die herausgehobenen Momente der Epiphanie meint) dahingehend zu interpretieren sei, dass die slowenische Eigenart…sich im slawischen Verband leichter bewahren [liesse], als unter dem normierenden, gleichmacherischen Druck der westlichen Warenwelt, dann muss es doch eine mindestens partielle Übereinstimmung zwischen dem "real existierenden" Slowenien und Handkes Schwellenland, welches er als Sache meines Lebens betrachtet, geben. Da mag das Eintreten für die Republik von Kobarid, einem Dorf, welches im Zweiten Weltkrieg zwei Monate Widerstand gegen die deutsche Besatzung leistete, nur noch zusätzliches Indiz sein (Hafner legt dies irrigerweise dahingehend aus, dass Handke prinzipiell nicht gegen Sezessionen sei).
Jugoslawien ist Handkes A priori
Die Quelle
springt, vereinigt stürzen Bäche,
Verteilt,
vorsichtig abgemessen schreitet
Hier ist
das Wohlbehagen erblich, So schildert Faust seine Vorstellung von Arkadien. Er wird es betreten – und wieder hinausgetragen werden. Arkadien war (nicht nur) für Goethe Synonym für das "goldene Zeitalter". Insofern erscheint die Zuweisung, Handkes Jugoslawien sei sein Arkadien gewesen, nicht übertrieben. Dabei ist dieses Arkadien beileibe nicht nur Selbstzweck und Jugoslawien nicht nur Träger der Kontinuität. Auch von antikapitalistischer Schwärmerei ist Handke, wenn man ihn genau liest, weit entfernt. Parallel dazu, dass Handke Slowenien, dem Land seiner (mütterlichen) Vorfahren als eine Art Gegenwelt sah, war dieses Slowenien natürlich (geografisch und politisch) Bestandteil des Staatenverbunds Jugoslawien und rückte somit in den politischen Kontext des Widerstandes gegen die nationalsozialistische Besatzung. Hier findet nämlich – bei aller Rede um die Geschichtslosigkeit des Handkeschen Denkens und Schreibens – sehr wohl eine historische Einordnung statt. Und diese ist fundamental. Handke betont ausdrücklich, dass die Findung des Staates Jugoslawien im weitgehend eigenen, von anderen Mächten autarken Widerstand konstituierend und beispielhaft für ihn sei. Hafner weist selber darauf hin, dass Handke im gemeinschaftliche[n] Kampf der Völker Jugoslawiens, auch der unterschiedlichen Parteien und Weltanschauungen – ausgenommen fast nur die kroatischen Ustascha-Faschisten – gegen das Grossdeutschland einen integrativen Gründungsmythos seines weiten Seelen-Landes sieht. Viele werfen Handke vor, diesen Gründungsmythos idealisierend darzustellen. Tatsächlich interessiert er sich für die (spätere) Politik Titos nur am Rande. Aber hier greift dann das von Hafner so ausführlich dargelegte Ideal von Überlieferung. Jugoslawien ist Handkes A priori – Voraussetzung für alles Andere. Hafner weist zwar darauf hin, dass die von Handke ersehnte Gegengeschichte...kein aus der Luft gegriffener Entwurf ist, erkennt jedoch nicht den Rang dieser Gegengeschichte. Wenn er schreibt, dass Jugoslawien…im Kindheitskrieg auf der Gegenseite jener Aggressoren [stand], die den Tod der Mutterbrüder verschuldet…oder zumindest des Gewährenlassens auf die Väter geworfen haben, dann muss man auch hier die biografischen Bezüge Handkes erkennen: Sowohl Handkes "Lichtgestalt" Onkel Gregor, als auch Handkes Stiefvater Bruno Adolf [sic!] und sein leiblicher Vater (Ernst Schönemann) waren Soldaten der deutschen Wehrmacht. Handke verfremdet in der "Wiederholung" das Soldatentum Gregors in dem er Kobals verschollenen Bruder zum Widerstandskämpfer in der Republik Kobarid macht.
Konstituierend im Widerstand gegen den Nationalsozialismus Ohne diese politische Grundhaltung ist seine Emphase für Jugoslawien nicht denkbar, wie sich auch im 1983 erschienenen "Chinese des Schmerzes" zeigt. Hafner sucht in der Besprechung hierzu ausführlich nach biografischen Parallelen Handkes mit denen des "Schwellenkundler[s]" Loser, der Hauptfigur. Die eigentliche Tat, die dem Buch so etwas wie eine Handlung gibt, wird jedoch fast nur beiläufig erörtert: Loser tötet im Affekt einen Hakenkreuzschmierer (archaisch mit einem Steinwurf), den er in flagranti erwischt. Die Hakenkreuze tauchen im Buch vorher mehrfach auf; Loser entfernt sie sogar mithilfe seiner kleinen Tochter. Unverständlich, wie Hafner dies dahingehend deutet, dass Loser durch diese Tat gleichsam zum Deutschen, also zum Täter werde und Handke sich damit auf die Seite der Väter stelle. Das genaue Gegenteil dürfte der Fall sein. Durch diesen Totschlag konstituiert sich in der Person des Protagonisten der (in der Familie nicht vorhandene) Widerstand gegen den Nazismus. Unabhängig von einer juristischen Bewertung der Tat (Handke hat Jura studiert) wird Loser zu einem "Gerechten". Ohne Jugoslawien als A priori sind die späteren, sogenannten Serbien-Bücher Handkes nicht verständlich (Was Jugoslawien betrifft, bin ich gern ewiggestrig oder meinetwegen nostalgisch). Und in dem Hafner herausstellt, dass Handke seine Heimat aufgrund der lebensgeschichtlichen Tatsachen in Slowenien gefunden habe (vermutlich jedoch eher das, was Handke meine Art Heimat nennt) und allen späteren Engagements…dieses schicksalhafte Moment abspricht (Danach durch Serbien reisend, hatte ich dagegen keinerlei Heimat zu verlieren) übersieht er Ursache und Wirkung: Nach dem "Zusammenbruch" Jugoslawiens gibt es für Handke keine Heimat im emphatischen (freilich allegorischen) Sinne mehr. Handkes Sehnsucht nach Aufgehobensein und Aufgehen in einer Gemeinschaft (die freilich immer eine Gemeinschaft der Verstreuten war), wird mit der Zerschlagung Jugoslawiens unerreichbar.
Noch einmal für Jugoslawien Ein mögliches, kleines Epos: das von den unterschiedlichen Kopfbedeckungen der vorübergehenden Menschheit in den großen Städten, wie zum Beispiel in Skopje in Mazedonien/Jugoslawien am 10. Dezember 1987. Es gab sogar, mitten in der Metropole, jene "Passe-Montagne" oder Gebirgsüberquer-Mützen, über die Nase unten und dir Stirn oben gehend und nur die Augen freilassend, und dazwischen die Radkarrenfahrer mit schwarzen Moslemkappen, die fest auf den Schädeln saßen, während daneben am Straßenrand ein alter Mann Abschied nahm von seine Tochter oder Enkelin aus Titograd/Montenegro oder Vipava/Slowenien, vielfache Spitzgiebel in seiner Haube, ein islamisches Fenster- und Kapitellornament (die Tochter oder Enkelin weinte). Es schneite im südlichsten Jugoslawien und taute zugleich. Und dann passierte einer mit weißem gestrickten, von orientalischen Mustern durchschossenen Käppi unter dem vertropfenden Schnee, gefolgt von einem blonden Mädchen mit dicker Schimütze (Quaste obenauf), und gleich darauf einem Bebrillten mit Baskenmütze, dunkelblauer Strengel obenauf, gefolgt von einem Beret eines Großschrittsoldaten und den paarweise Polizisten-Schirmmützen und deren gemuldeter Oberfläche. […] Ein Junger mit vielschichtiger Ledermütze, von Schicht zu Schicht eine andere Farbe. Einer schob einen Karren und hatte eine Plastikkappe über den Ohren, das Kinn umwickelt mit einem Palästinensertuch. […] Eine Brillenschönheit ging vorbei mit lila Borsalinohut und schlenderte um die Ecke, gefolgt von einer sehr kleinen Frau mit selbstgestrickter Zopfmütze, welche hoch aufragte, gefolgt von einem Säugling mit Sombrero auf der noch offenen Schädelfontanelle, getragen von einem Mädchen mit überkopfgroßer Baskenmütze 'made in Hongkong'. Ein Junge mit Schal um Hals und Ohren. Ein Bursche mit Schifahrer-Ohrenschützern, Aufschrift TRICOT. Undsoweiter. All das schöne Undsoweiter. All das schöne Undsoweiter.
Wille zum Miteinander: Der ewige Friede ist möglich Der Krieg ist fern von hier. Das zwischen euch Vorgefallene sei euer letztes Drama gewesen, das gesagte sei ungesagt. Unsere Heerscharen stehen nicht grau in grau auf den grauen Betonpisten, sondern gelb in gelb in den gelben Blütenkelchen, und die Blume steht hochaufgerichtet als unser heimlicher König. […] Das Bergblau ist - das Braun der Pistolentasche ist nicht; und wen oder was man vom Fernsehen kennt, das kennt man nicht. Geht in der ausgestöpselten freien Ebene, als Nähe die Farben, als Ferne die Formen, die Farben leuchtend zu euren Füssen, die Formen die Zugkraft zu euren Häuptern, und beides eure Beschützer. […] Die Natur ist das einzige, was ich euch versprechen kann – das einzig stichhaltige Versprechen. […] Sie kann freilich weder Zufluchtsort noch Ausweg sein. Aber sie ist das Vorbild und gibt das Maß: dieses muß nur täglich genommen werden. […] Übergeht die kindfernen Zweifler. Wartet nicht auf einen neuen Krieg, um geistesgegenwärtig zu werden: die Klügsten sind die im Angesicht der Natur. Blickt ins Land – so vergeht die böse Dummheit. […] Und verachtet die unernsten Spötter: es ist noch immer – seid dankbar. Die Dankbarkeit ist die Begeisterung, und erst das bedankte erscheint als die Dauerform – erst die Dankbarkeit gibt den Blick in die weite Welt. […] Laßt die Illusionslosen böse grinsen: die Illusion ist die Kraft der Vision, und die Vision ist wahr. […] Der ewige Friede ist möglich. "Der ewige Friede" – eine Anspielung auf Kants Schrift "Zum ewigen Frieden". Das Sein im Frieden ist Handkes Vision, eine Sehnsucht nach der friedlichen Gemeinschaft. Vielleicht ist sie eine Illusion; vielleicht war Jugoslawien eine Projektionsfläche, wie Hafner einmal anmerkt. Aber Jugoslawien ist für Handke "Beispielland für ein anderes Europa". Und ohne Illusion würde man gar nichts tun, würde man immer seine Scheiße verschmieren, vielleicht…ohne Illusion ist man depressiv. Handke versuchte noch, ein Refugium für seine Illusion zu finden. Er, der Heimatlose "entdeckte" das "Exil" Serbien, welches sich "Bundesrepublik Jugoslawien" nannte. Patiniertes Pathos erkennt Hafner da gelegentlich, zitiert Slavoj Žižeks kritische Haltung Handkes Slowenienbild gegenüber und erwähnt Drago Jančars Diktum, Handke habe, was Slowenien anbelangt, eine "rosarote Brille" auf (das war im Verhältnis zu dem, was Handke noch zu hören bekommen sollte, harmlos; Jančar argumentierte noch). Gregors Schwester Sophie wirft ihrem Bruder in "Über die Dörfer" eine Kraft der Verklärung vor, die Hafner auf einzelne Äusserungen Handkes bezieht und fast entschuldigend anbringt. In einem fast angeklebt erscheinenden 6. Kapitel fragt Hafner anhand der "Morawischen Nacht": Ist nicht doch eine Heimkehr möglich? Handke könnte, so Hafners Idee, sich zwischenzeitlich selber "verwandelt", sozusagen eine Versöhnung mit sich selbst vorgenommen haben. Es gibt im Buch sehr wohl Indizien für eine derartige Versöhnung, insbesondere wenn man den erzählenden (inzwischen verstummten) Dichter mit Handke gleichsetzt. Aber indem Hafner auf Äusserungen Handkes hinweist, die eine Art Partisanenstück über den slowenischen Widerstandskämpfer Lipej Kolenik-Stanko (1925-2008) zu schreiben, dürfte es wohl ziemlich sicher sein, dass Handke die Thematik nicht mehr loslassen wird.
Profunde Kennerschaft Fabjan Hafner hat sich – aller Divergenzen zum Trotz - mit diesem überaus detailreichen Buch als profunder Kenner des Werkes von Peter Handke erwiesen. Er vermeidet ermüdendes Germanistenjargon, in dem er streng am "Text" bleibt. Hafner animiert, Handke wieder zu lesen und in seinen Romanen und Erzählungen neue Facetten zu entdecken. Hierfür muss man ihm danken. Lothar Struck
Die kursiv gedruckten
Passagen sind Zitate aus Fabjan
Hafners Buch. Zur besseren Orientierung wurden
Zitate von Peter Handke in blau hinterlegt. Eine Passage kursiv und blau
bedeutet demnach, dass es sich um ein Handke-Zitat handelt, welches im Buch
angeführt wird. Auf eine Unterscheidung zwischen Textzitat und Interviewzitat
wurde verzichtet, da sich dies aus dem Geschriebenen ergibt. |
Fabjan Hafner |
|
Glanz@Elend
|
||

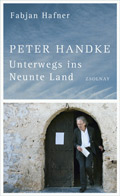 Handkes
mythischer Mikrokosmos
Handkes
mythischer Mikrokosmos