Der grosse Denkfehler der Nationalbank
Sogar ein Leitungsmitglied der US-Notenbank, die sich sonst kaum je zur helvetischen Währungspolitik äussert, zeigte sich "erstaunt" über die Massnahme. Offensichtlich hält er den Schritt für falsch. Weniger diplomatisch reagierten dagegen die internationalen Finanzmärkte: Der Franken kletterte gegenüber Euro und Dollar bis Samstagmorgen um über 20 Prozent. Gleichzeitig fielen Schweizeraktien im Mittel um 15 Prozent.
Innert 48 Stunden wurden an den Schweizer Aktienbörsen gegen 200 Milliarden Franken Wert vernichtet. Am Freitag kletterten einige angeblich vom Chaos bedrohten Eurobörsen hingegen auf neue Jahreshöchstände. Man kann diese Finanzmarktreaktionen nicht einfach als Werk überdrehter Spekulanten abtun. Nach aller Erfahrung ist das Handeln von Millionen von Marktteilnehmern ein empfindlicher und akkurater Seismograph der Wirtschaft.
Konjunkturdelle?
Experten im In- und Ausland rechnen jetzt mit einer scharfen Konjunkturdelle der Schweizer Wirtschaft. Dies nachdem 2015 vor der SNB-Massnahme recht verheissungsvoll begonnen hat. Ob es zu neuer Arbeitslosigkeit kommen wird, lässt sich derzeit noch kaum sagen. Alles hängt jetzt von der weiteren Frankenentwicklung ab. Doch die Skepsis bleibt gross.
Thomas Straubhaar, schweizer Volkswirtschaftsprofessor an der Uni Hamburg, schrieb in der "Finanz und Wirtschaft", es "grause" ihm vor den möglichen Folgewirkungen der Massnahme der SNB. Diese setzt jetzt offenbar auf das "Prinzip Hoffnung". Wie SNB-Präsident Thomas Jordan in einem NZZ-Interview erklärte, erwarte er, dass sich der Franken nach dem anfänglichen "Überschiessen" wieder auf einen realistischen Kurs einpendelt. Derzeit sei er viel zu hoch. Welches Zielniveau er anstrebte, liess Jordan aber offen. Er schloss auch neue Devisenkäufe nicht aus. Doch die Gefahr, dass die internationale Spekulation der SNB auf den Zahn fühlt, um neue Frankenhöchststände zu testen, bleibt akut.
Die Eurozone wird überleben
Die grosse Frage bleibt, was die SNB zu ihrem Vabanque-Spiel getrieben hat. Jordan selber verweist auf die Unsicherheit im Vorfeld der geplanten riesigen Staatsanleihenkäufe der Europäischen Zentralbank (EZB) unter dem ehemaligen italienischen Banker Mario Draghi. Diese könnten zu weiterer Euroschwäche führen. Anderseits befindet sich der US-Dollar seit Wochen im Steilflug. Deshalb will die Nationalbank in ihrer Währungspolitik freie Hand haben. Doch was an der aktuellen Währungsentwicklung so dramatisch sein soll, um einen derart riskanten Schritt, wie ihn die Wechselkursfreigabe bedeutet, zu rechtfertigen, bleibt rätselhaft. Die Euorozone wird überleben, selbst im wenig wahrscheinlichen Fall, dass Griechenland austreten sollte.
Letzten Endes hat die EZB wohl einfach keine Lust mehr, Euros "à discrétion" zu kaufen, nachdem sie in den letzten drei Jahren - seit Einführung der 1.20er Untergrenze - dafür mehrere Hundert Milliarden Franken ausgegeben hat. Doch was wäre an weiteren Eurokäufen so schlimm? Früher hat man die mit Devisenübernahmen verbundene Ausweitung der Frankenmenge immer mit zusätzlicher Teuerung (Inflation) in Verbindung gebracht. Doch dieses "Gesetz" (im Fachjargon "Quantitätstheorie" genannt) ist nach aller Erfahrung obsolet geworden. Die USA, Japan, aber auch die Eurozone und die Schweiz haben in den letzten Jahren ihren Geldumlauf stark erhöht. Doch heute droht nicht Inflation sondern das Gegenteil - Deflation (Preisrückgänge).
SVP: Von ökonomischem Wissen frei
Die SNB hat also derzeit die einzigartige Möglichkeit mit Franken, die sie selber kostenlos schaffen ("drucken") kann, Devisen wie Euro, Dollar oder Yen, aber auch Wertpapiere, Gold oder sonstige Wertobjekte.zu kaufen. Und das ohne Teuerung zu erzeugen. Jedes andere Land würde sich in einer solchen Lage glücklich prieisen. Doch hierzulande wird das als riesiges Problem gesehen. In ähnlicher Weise wird auch die Strategie der amerikanischen, japanischen und europäischen Notenbank, ihre Volkswirtschaften mit Geldspritzen anzukurbeln, verteufelt, obwohl z.B. die USA derzeit ein überzeugendes Beispiel für den Erfolg dieser Taktik liefern. Vor allem von SVP-Politikern, die wie die Goldinitiative gezeigt hat, von ökonomischem Wissen weitgehend frei sind.
Im Grunde versteckt sich hier der alte "Dogmenstreit" zwischen der deutschen Bundesbank und mittlerweile den meisten andern Notenbanken, welche die Staatsschuldenfinanzierung durch die Notenbank wesentlich lockerer sehen. In Deutschland selbst, das unter dem schwächelnden Euro sehr gut lebt und weiterhin europäische Wirtschaftslokomotive ist, kommt die Kritik an den monetären Notenbankspritzen vor allem von frustrierten Ex-Bundesbankern und rechtslastigen Uniprofessoren, die häufig der AfD oder der CSU nahestehen.
Überholte Ansicht
Leider ist in der Schweiz diese überholte Ansicht ebenfalls noch weit verbreitet. Sie wird auch in manchen Medien, insbesondere der NZZ, leidenschaftlich propagiert, wie etwa die jüngste NZZ-Samstagsausgabe zeigt, Allerdings hat die Zeitung noch vor wenigen Wochen selbst geschrieben, dass die Währungsuntergrenze für die Schweiz nötig sei. Nach dem abrupten SNB-Schwenker ist die Zeitung wieder gehorsam auf ihre frühere dogmatische Linie eingeschwenkt. Es wäre sicher falsch zu behaupten, dass die Beibehaltung der 1.20er Grenze problemlos wäre - vor allem die Gefahr von Blasen etwa auf dem Immobilienmarkt bliebe bestehen. Doch wäre die Situation weitaus beherrschbarer, als was uns jetzt bevorsteht. Die aktuelle Schockreaktion der Finanzmärkte ist vor diesem Hintergrund gerechtfertigt.

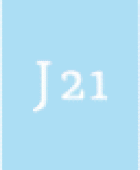


Die SNB hat recht. Es kann nicht sein, dass wir die Schulden von Europa aufkaufen auf Kosten der CH Ersparnisse nur um die Exportwirtschaft zu subventionieren.
An der Schweizer Börse wurden keine Werte vernichtet. Es ist nur eine Menge heiße Luft entwichen.
>Letzten Endes hat die EZB wohl einfach keine Lust mehr,
>Euros "à discrétion" zu kaufen.
Das sollte wohl SNB statt EZB heissen.
Die Finanz- und Währungssysteme sind seit ca. 2000 ausser Kontrolle. 2007 wurde eine in den USA weiche Landung versucht. Das Resultat ist bekannt. Inzwischen sind die Geldmengen auch in Europa noch viel grösser. Das billige Geld, keine ausreichende Eigenkapitalquoten haben bereits wiederum zu Spekulationen mit negativem Ausgang geführt die nun mit der CH-Wechselkursfreigabe an den Tag treten. Weitere Blasen sind zu vermuten die erst in einer Krisensituation sichtbar werden. Bei viel zu grosser Geldmenge kann eine Hyperinflationen oder ein massiver systemischer Einbruch nicht einfach wegdiskutiert werden. Das Finanzsystem nimmt seine dienende Funktion nur noch zum Teil war. Es muss mit noch viel grösseren Krisen gerechnet werden.
Als die Anbindung beschlossen wurde betonte man seitens der SNB den temporären Charakter der Massnahme.
Warum hat man diese nicht im Hinterkopf behalten? Hat man den klaren Aussagen der SNB nicht vertraut?
(Hätte man es getan, wäre man jetzt nicht so kalt von der Aufhebung der Anbindung erwischt worden).
Warum betont man andauernd die Aussage des SNB Präsidenten vor ein paar Tagen, in welcher die Beibehaltung der Anbindung nochmals bestätigt wurde und beklagt jetzt den Vertrauensverlust, weil diese kurz darauf aus heiterem (?) Himmel aufgehoben worden ist?
Dazu ist festzustellen, dass einerseits gewisse Aussagen der SNB total ausgeblendet worden sind (temporäre Massnahmen) und andererseits wiederum andere (Beibehaltung der temporären Massnahmen) sofort festgeschraubt worden sind.
Das bedeutet, je nach Inhalt der Aussagen und deren Bedeutung und Auswirkungen auf die diversen Interessengruppen, werden die Statements der SNB (und nicht nur die) wahrgenommen, interpretiert, ausgeblendet, analisiert, bewertet, als Munition gegen die SNB, oder als Begründung für deren gute Lenkung und Arbeit im Interesse des Landes verwendet.
Das scheint (pardon) zu nichts zu führen, ausser das man sich mit seiner Sicht der Dinge Luft machen kann. Diese Bewertungen der jeweiligen Handlungen und Aussagen stellen keine Fragen und erhalten deshalb auch keine Antworten zu den Hintergründen des Geschehenen. Sie geben "nur" die persönlichen Interpretationen des Schreibenden wieder, häufig ohne viel Bezug zu Fakten.
Warum handelt die SNB gerade jetzt und löst den Franken vom Euro quasi über Nacht?
Was Direktor Jordan dazu bisher gesagt hat ist wohl nur das Medientaugliche.
Dahinter kann man noch jede Menge Verlinkungen zu allem vermuten was jetzt global geschieht. Man schaue sich um und erkenne das sich zuspitzende Chaos. Dazu erkenne man an, dass ein Jordan vermutlich ein Mensch ist, der seinen Job beherrscht (s. auch curriculum vitae) und logischerweise über viel mehr Hintergrundinformationen verfügt als die Presse (!!).
Man darf nicht vergessen, was für eine enorme politische Aussage und Auswirkungen dieser Schritt beinhaltet und man soll erkennen, wie sehr dieser Entscheid der SNB die Märkte weltweit erschüttert hat.
Das hat gezeigt, wie schnell heutzutage die "schwarzen Schwäne" daher geschwommen kommen und weltweit das wackelige Konstrukt Marktwirtschaft und damit das ganze System nahezu kollabieren lassen. Die Schwäche des Systems ist das globale Problem, nicht das unvorhersehbare Auftauchen eines
(kleinen) schwarzen Schwanes.
Erwarten wir nun den nächsten, allerdings grossen und dicken der schwarzen Wasservögel, um zu hören, wieviel Wasser er beim anlanden verdrängen wird. Vielleicht liefert uns der schon einige Antworten auf die Frage, warum gerade jetzt?
Herr Schenker, der Entscheid der SNB war ein mutiger und vor allem ein richtiger. Dass er überraschend war, zeichnet ihn sogar aus. Diese Aktion stärkt die Glaubwürdigkeit der SNB! Ein Beweis dafür, wie unabhängig diese Institution ist. Und das ist gut so.
Uns wurde von Anfang an gesagt, dass die Fr. 1.20 nur vorübergehend sein werden. Dreieinhalb Jahre hatten die Schweizer Firmen Zeit, sich darauf einzustellen; wenige haben es auch tatsächlich getan. Man hoffte, dass die 1.20 mindestens ewig halten würden.
Man kann deshalb durchaus sagen, dass sich hier einige verspekuliert haben, ohne bewusst Spekulant gewesen zu sein
Die Wirtschafts-Welt spielt sich je länger je weniger innerhalb der EU ab. Entgegen Ihrer kühnen Annahme wird der Euro sehr bald zusammenbrechen; das wird Ex-Wallstreetbanker Draghi schon noch hinkriegen. Genau dieses Szenario hat die SNB erkannt und das Ende mit Schrecken zeitgerecht vollzogen.
Dass der Dollar kurzfristig auch runter musste, ist erst auf den zweiten Blick klar. Ich persönlich würde bei anhaltender Dollarschwäche (welche übrigens nur eine Frankenstärke darstellt) sogar etwa 17% weniger verdienen als noch im Dezember. Mein Vertrauen gilt aber dem USD. Aus verschiedenen Gründen. Gründe, welche ein Euro nie vorweisen konnte. Letztlich fehlt der EU auch eine Armee, um Forderungen an Drittstaaten zu stellen. Aber das ist nur ein Schwachpunkt des Europäischen Elitenprojekts.
Wichtiger ist: Der Dollar wird als weltweit einzig übriggebliebene, solide Leitwährung an Wert und Macht weiter zunehmen, die USA als Öl-Exporteur an Selbstvertrauen gewinnen und eine nachhaltige Hochkonjunktur einläuten.
Der Euro hingegen hat seine Glaubwürdigkeit mehr als verspielt. Brüssel und Frankfurt werden das Euro-Märchen bald irgendwie beenden müssen, denn hinter dem Euro steht kein einziges Gramm Gold, keine Rohstoffe oder wenigstens Wertschriften, welche ihrem Namen gerecht würden. Der Euro basiert nur auf Vertrauen. Kommt jetzt vielleicht sogar IMF Madame Lagarde ins Spiel? Würde zur Strategie passen.
Ende nächster Woche wird man uns die neue Marschrichtung verkünden. Es ist ein weiteres Kapitel einer so genannten "Schockstrategie". Die Geschichtsbücher sind voll davon.
Es ist vielleicht an der Zeit, dass die Schweiz mit den USA verstärkt zusammen arbeitet. Dort spielt in Zukunft nämlich die Musik. In Asien natürlich auch. Aber bestimmt nicht in Europa. Ende der Fahnenstange. Die Zitrone ist ausgepresst. Die Europäische Union ist klinisch mausetot, und Herr Draghi ist ihr Bestatter.
Sehr geehrter Herr Stiefenhofer,
Weitestgehend einverstanden mit Ihrem interessanten und gut fundierten Kommentar - bis auf den letzten Absatz: hier teile ich Ihre Ansicht, dass "in Zukunft die Musik in den USA spielen werde"- und in Asien natürlich auch, nämlich überhaupt nicht!
Betreffs den USA bin ich WEIT weniger optimistisch als Sie, denn: die Zukunft gehört (nicht nur meiner Meinung nach) zu mindestens 95 % den Asiaten - und die Volksrepublik China wird sich davon eine ganz grosse Scheibe abschneiden ... .
Freundliche Gruss aus meiner neuen "Wahlheimat" China,
HansPeter Lechner.
Ja, Herr Lechner, da haben Sie natürlich recht.
China hustet noch nicht und wird es gemäss Ökonomen erst bei unter 7% Wachstum tun. Aber Grundsätzlich hat ganz Asien noch sehr viel Potential. Mehr als die USA natürlich.
Bin übrigens auch schon eine Weile hier. Acht Jahre in Taiwan und jetzt mittlerweile sieben Jahre in Korea.
Gruss aus dem Sommer in Sydney.
Nur kurz: Der Autor setzt voraus das die Geld Lockerung folgenlos bleibt und ist so anmaßend zu glauben und beurteilen zu können das dieses globale Experiment, was gerade läuft, gut enden wird. Ich glaube der Autor greift bist der Zukunft voraus.
Was ich außerdem amüsant finde ist, dass der Autor Werbung für Inflation macht. De facto Enteignung des kleinen Mannes. Es ist eine echt kranke Welt in der wir leben. Ich für meinen Teil wünsche mir das gesteigerte Produktivität zu einem gewissen Teil an die Bevölkerung zurück gegeben wird.
Da Argument mit den Staats Schulden lass ich nicht zählen, hier hilft nur ein globaler Reset. Ed kann nicht sein, dass die Völker zu Schuld und Zinssklaven werden. Also Schuldenerlass und Grundgesetz schaffen, welches xie Schaffung neuer Schulden verbindlich und unumkehrbar verbiezez. Der Staat sollte, fur Projekte die durch unabhängige Sachkommisionen fur wirtschaftlich befunden wurden, selbst Geld drucken. Mir war nie klar, warum der Staat sich Geld zu Zinsen leihen muss.
Mit Handy geschrieben.
Die SNB hätte gar nicht erst diese unsägliche Anbindung im Jahre 2011/Herbst bezüglich dem Schweizer Franken zum Euro tätigen sollen.
Eine direkte finanzielle Hilfe für die betroffenen Exportunternehmungen und dem Schweizer Tourismus wäre um ein vielfaches günstiger und effektiver gewesen.
Die SNB hat durch diese Anbindung einen grossen Teil ihres Eigenkapitals verloren.
Ihre Bilanzsumme ist derzeit zu hoch und muss nun umgehend abgebaut werden, wenn auch mit eventuellen Verlusten.
Es geht nicht weiter an, dass die SNB-Verantwortlichen mit 480 Milliarden spekulieren.
Die SNB kann nicht mit negativem Eigenkaptal arbeiten, sie muss ihre Bilanz bei negativem Eigenkapital deponieren.
Tut sie das nicht, müssen die entsprechenden Kredithäuser in der Schweiz (wie die Kantonal Banken, Raiffeisenbank, etc.), die Verluste abschreiben in ihren Bilanzen, in dem Geschäftsjahr in dem die SNB erklärt, sie habe kein Eigenkapital mehr.
Dann stehen die entsprechenden Kreditbanken vor grossen finanziellen Problemen, die soweit gehen können, das diese Banken zahlungsunfähig werden und ihrerseits ihre Bilanzen deponieren müssen oder durch den Schweizer Steuerzahler sowie den Schweizer Sparer gerettet werden müssen.
P.S.
Name Schweizer Bürger deswegen, der Schweizer Bürger haftet für die Schulden der Schweizerischen Nationalbank.