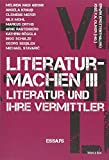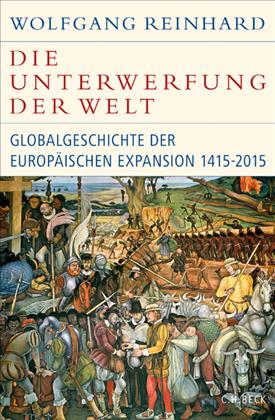Literatur ohne Vermittler
Erwin Krottenthaler und Jose F.A. Oliver geben eine „und“-Kompilation heraus
Von Günther Fetzer
Wohl weil ich irgendwann einmal etwas Wissenschaftliches über Literaturvermittlung geschrieben habe, erreichte mich die folgende E-Mail von literaturkritik.de:
Lieber Herr Fetzer, vor Kurzem ist bei uns folgendes Rezensionsexemplar eingegangen, das für Sie interessant sein könnte:
Erwin Krottenthaler / Jose F. A. Oliver (Hg.): Literaturmachen III.
Literatur und ihre Vermittler.
Verlag Voland & Quist, Dresden 2018.
160 Seiten, 16,00 EUR.
ISBN-13: 9783863911997Hätten Sie Lust, es in literaturkritik.de zu besprechen?
Herzliche Grüße.
Und da ich das Thema Literaturvermittlung weiterhin verfolge, antwortete ich umgehend: „Das mache ich gern.“ Neugierig öffnete ich das Buch, nachdem es die Redaktion mir geschickt hatte. Erste Zweifel, ob es sich hier um ein Werk handelt, das den Untertitel „Literatur und ihre Vermittler“ inhaltlich ausfüllen würde, kamen mir bei der Lektüre des Inhaltsverzeichnisses. Erste Erkenntnis: Es handelt sich um eine „und“-Kompilation, vulgo auch Buchbindersynthese genannt:
01 Literatur und Gesellschaft
02 Literatur und Erwachsenwerden
03 Literatur und Brutalität
04 Literatur und Gefühle
05 Literatur und Film
06 Literatur und Schule
07 Literatur und Flucht
08 Literatur und Zweifel
09 Literatur und Selbsterfahrung
10 Literatur und Schreibstrategien.
Ingo Schulze eröffnet als prominentester Autor den Band. Doch statt des Vermittlungsgedanken fand ich dort drei Textstücke (einen Dialog, eine ungeschriebene Geschichte und die Auseinandersetzung mit der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ über einen dann doch nicht gedruckten Auftragsartikel), die mich angesichts des (versprochenen) Bandthemas ratlos zurückließen. Und so ging es in den anderen Kapiteln weiter. Im zweiten Kapitel (Nils Mohl) wurde ich aufgefordert: „Nennen Sie bitte drei Familienromane von Rang.“ Im dritten Kapitel (Clemens Meyer) lernte ich, dass „der Vietnamveteran John Rambo […] deutsch-indianischer Abstammung“ ist. Und im vierten Kapitel erfuhr ich, dass die Verfasserin, Angela Krauß, im Rahmen eines universitären Forschungsprojekts „zur Bedeutung von Stimmungen bei der Produktion und Rezeption von Lyrik“ gebeten wurde, einen Online-Fragebogen auszufüllen.
Spätestens hier fing ich an, quer zu lesen, denn die vielen Befindlichkeiten beim Schreiben von Literatur hatte ich nicht erwartet – und das interessiert mich auch nicht. Einzig bei Georg Seeßlen blieb ich hängen. Seine Reflexionen über die Beziehungen zwischen Film und Literatur – bei weitem der umfangreichste Beitrag – fesselten, nicht wegen der Vermittlungsthematik, sondern weil sie inhaltlich fundiert und aufschlussreich und elaboriert waren. Und nicht nur subjektive Eruptionen boten wie unter der Überschrift „Text und Erlebnis“ (Markus Orths): „Ich verschwinde, ich versinke, ich werde mitgerissen, ich falle, ich lache, ich weine, ich reiße die Augen auf, ich grunze, ich sehe neues Licht, mein Hirn sprudelt auf“ usw. usw. usw.
Ich kenne die beiden Vorgängerpublikationen „Literaturmachen I“ und „Literaturmachen II“ mit identischem Untertitel nicht, die wie dieser dritte Band aus einer Veranstaltungsreihe des Literaturhauses Stuttgart in Kooperation mit der Otto-Friedrich-Universität Bamberg hervorgegangen sind, doch es steht zu vermuten, dass auch dort die selbe Begriffsverwirrung herrscht: Autoren sind nicht die Vermittler von Literatur, sie sind ihre Produzenten.
|
||