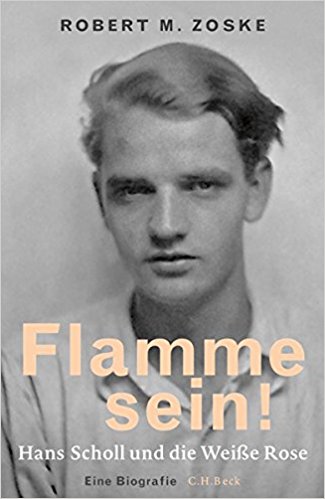Poetische Naturkunden
Marzanna Kielar beschreibt in „Lass uns die Nacht“ natürliche Erfahrungen
Von Thorsten Paprotny
Wie leicht wird von offenkundiger Natürlichkeit gesprochen, wie oft dienen Naturbeschreibungen als Spiegel für Empfindungen, etwa wenn die wild aufgeschäumte See Stürme der Leidenschaft abbilden soll. In Naturdichtungen steht häufig der Mensch im Mittelpunkt. Er spiegelt oder projiziert sein Erleben auf Phänomene, die er sieht, zumindest zu sehen scheint und zugleich verkennt oder distanziert. Das lyrische Ich spiegelt sich dann in allem, als ob es das Zentrum der Welt wäre. Von dieser Anthropozentrik sind die leisen, mitunter fragil anmutenden Gedichte frei, die die polnische Lyrikerin Marzanna Kielar seit beinahe 30 Jahren publiziert. Eine Auswahl ihrer zwischen 1992 und 2018 veröffentlichten Gedichtbände wird nun dem deutschen Lesepublikum zugänglich gemacht.
Behutsam schaut die Dichterin auf die natürliche Schönheit dieser Welt, die gelegentlich, aber nicht beständig sanfte Hinweise auch auf das weite Land der Seele erlaubt. Ihre Lyrik erzählt von einem partnerschaftlichen Miteinander, von Begegnungen. Diese Dezenz gibt Marzanna Kielar niemals preis. Sie nähert sich an, wenn sie hinausschaut in die masurische Weite, etwa in den Morgenstunden, wenn der Nebel sich lichtet und die Wildenten fliegen:
Ähren rieseln.
Und du wirst still, seltsam unschuldig. Rein:
die sanften Hügel stehen in prächtigem Licht,
in den Gräsern, unten, bettet sich der Tod.
Inmitten der Natur, von den Nebelschwaden über den Entenflug hin, zeigt sich die Endlichkeit, die dem Tag nichts von seiner leuchtenden Pracht raubt. Ohne Wehmut, ohne künstliche Melancholie öffnet sich der Blick für das feine Gewebe der Natur, in dem auch der Mensch zu Hause sein darf. Er freut sich seines Lebens dankbar – in der „erlesenen, vergänglichen Fülle“. In Sacra conversazione denkt die Dichterin „in Ruhe“ an „die Handvoll Heidelbeeren“, also nicht an etwas Hohes, Höheres und Allerhöchstes, „und den Mund schließen mir / die Beeren“. Darüber hinaus stellen sich Fragen ein, auf die der Geschmack der Beeren zumindest eine ganz eigene Antwort schenkt. Doch Fragen bleiben, bleiben auch offen, selbst wenn der „Sonnenzweig“ die Betrachterin zu lieben lehrt, eine Liebe freilich, die nicht besitzen will, denn der Zweig ist einfach schön, „du blühst in meinem Blick“ – und der geliebte Mitmensch nicht weniger, den wir voll Güte und Freude anschauen. Eine Frage indessen bleibt:
Wenn ich schwimme wie eine Wiese unter dem Fittich des Habichts,
mit wem schwimme ich? Unter dem schrägen Himmel,
offen wie ein Echo;
und wohin?
Müssen wir die Antwort darauf kennen? Offen für Antworten dürfen wir bleiben. In Marzanna Kielars Dichtung sind die Farben der Natur verknüpft mit Eindrücken der großen Weite. Sie sieht vor sich ein „riesiges Meer“, erlebt ganzheitlich „mit den Lippen / an der Haut des Windes, ständig, als wäre dieser sein / halbes Wesen“, ohne die Erfahrungen in Worte abschließend einzuhegen. Diese Spielarten der Hingabe schenken eine Anschauung, wie kostbar die sensible Teilhabe an den Phänomenen der Natur ist, die nicht – philosophisch gedacht, wie bei Immanuel Kant – bloß das ästhetisch Erhabene repräsentieren, sondern in die der Mensch leibhaftig eintauchen kann, bewundernd, liebend, andächtig: „Wolken / wie Gestühl, stahlgrau, / an der Wand des Horizonts (Gebet ohne Worte, / ohne ein Morgen)“. Die Verheißung liegt in der erlebten Gegenwart, in der Schönheit des Augenblicks. Die Natur wird also auch nicht mit Worten erobert und pathetisch besetzt, sondern sanft und vorsichtig beschrieben, liebevoll, zärtlich, ob allein oder zu zweit. Eine sympathetische Verbindung mit der Natur beschreibt Marzanna Kielar:
auf verschiedene Arten sprechen wir das Wort Liebe aus,
beschäftigt mit uns und dem Garten –
die Krähen seit einer Stunde als einzige Zeugen;
wir setzen Sträucher, es ist Ende Oktober,
und deine Sicherheit, dass sie Wurzeln schlagen, bevor der Frost kommt,
ist fast unerschütterlich.
Zum Meer hat die Dichterin eine besondere Beziehung, auch „Träume schwimmen vorbei“. Angedeutet werden das Erleben in der Nacht, der Geschmack und der Geruch der Liebe, „alles, was sie war, bevor das Licht uns verließ“. Im Bekenntnis zur Nacht bekommen ekstatische Momente ihren Raum, die „Brandung am Kliff“, fortgerissen in der Zweisamkeit – „ihre getürmte Welle möge uns forttragen, uns brodelnde Krümel“ –, wenn „wir mit verschwitzten Körpern“ haften bleiben, „und der Tod wird uns nicht fortreißen“. In dankbarer Freude begehren die Liebenden einander, aber sie begehren nicht auf. Nichts mehr wünschen sie sich, als dass die Nacht nicht enden möge. Marzanna Kielar arbeitet mit Kontrasten, mit der lichten Welt, die der Raum der Endlichkeit ist. In einem neueren Gedicht spricht sie davon:
Licht tagte der Tod,
einst starb man zu Hause.
Es war Zeit, sich mit dem Sterben vertraut zu machen,
ein wenig mit ihm zu arbeiten, beginnend
mit etwas Kleinerem – Rückenschmerzen
oder einer gerissenen Sehne.
Der Körper entbindet sich nach und nach vom Leben.
…
Sie beschreibt den Abschied, der sich andeutet und verdrängt wird. Es wären – wie ein anderes Gedicht heißt – Übungen in Nichtexistenz möglich, die doch verweigert werden:
Der Nebel kam in Wellen, dünner und dichter werdend,
bis er die Sicht abschnitt und auch uns ausradierte. Für viele Stunden verschwand der Garten.
Der Nebel schloss die Tür zur Wirklichkeit.
Wenn Marzanna Kielar die Naturformen und -erfahrungen beschreibt, so hütet sie sich davor, die Natur zu benutzen, als ob diese nur dazu da wäre, um auf Sinnfragen des Menschen Antworten zu geben. Die Natur hat ihr eigenes Recht, ihre eigenen Räume, sie darf – so wie wir – einfach da sein. Wir müssen uns in ihr nicht spiegeln können, aber wir dürfen uns ihr verwandt fühlen, eine Nähe erfahren, die ganz einfach vielleicht heißt: Der Mensch ist nicht der Herr der Welt, in der er erlebt, auch kein geistiger Emporkömmling, der sich souverän, religiös, philosophisch oder technisch, von der Natur emanzipiert hat oder einen wie immer begründeten Machtanspruch besitzt. Menschlich leben, menschlich lieben heißt – natürlich sein zu dürfen, inmitten der Natur. Was das bedeutet, können wir erproben. Mit den Augen der polnischen Lyrikerin könnten wir die Natur um uns neu sehen lernen und damit vielleicht auch uns selbst ganz unbemerkt besser kennenlernen. Wie schön wäre es, wenn wir dankbar wären, ein Teil des Ganzen zu sein, das wir mit dem Begriff Natur so unzureichend beschreiben. Marzanna Kielars Gedichte öffnen den Horizont für die Schönheit des Kosmos, in dem wir zu Hause sein dürfen.
|
||