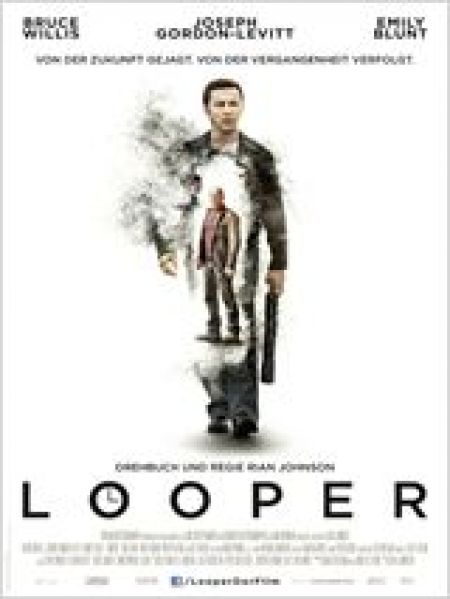|
|
Startseite > Kolumnen > Thomas Harbach > CINE TRASH & TREASURY > Looper |
Looper
Jahrelang galt "The twelve Monkeys" von Terry Gilliam als die Krönung des intelligenten Zeitreisefilmes verbunden mit einer aktuellen Botschaft. Mit "Looper" hat Regisseur Rian Johnson ebenfalls mit Bruce Willis in einer signifikanten Rolle am Thron Gilliams gerüttelt und einen provokanten Thriller inszeniert, der wie John Carpenters Original "Assault on Precint 13" schockierend ein Hollywoodgesetz bricht und damit sogar im Rahmenkontext der Handlung durchkommt. Der 1973 geborene Rian Johnson hat schon mit seinem Debütfilm "Brick" auf dem Sundance Filmfestival einen Spezialpreis für Originalität erhalten. Vier Jahre später folgte "The Brothers Bloom", bevor er mit "Looper" trotz oder gerade wegen eines von ihm selbst verfassten Drehbuchs endgültig in Hollywood ankam.
Ohne zu viel von der Pointe zu verraten konzentrierte sich insbesondere der Trailer auf die zahllosen Actionszenen. "Looper" ist aber viel mehr. Es ist eine schonungslose Reise in das eigene Ich, das über die klassische Zeitreisenfrage (angenommen, sie verfügen über eine Zeitmaschine. Würden Sie Hitler vor der Machtergreifung töten?) hinaus die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit konsequent, zynisch und verwirrend vielschichtig hintergründig hinterfragt. Obwohl Rian Johnson sich stellenweise an einer absichtlich billig gehaltenen "Blade Runner" Zukunftsvision orientierend Elemente des Film Noir, des Western und schließlich auch des asiatischen Gangsterkinos in die Handlung integriert hat, verfügt der Streifen trotzdem über eine bemerkenswert dunkle wie authentische Zukunftsversion. Johnsons Depression Amerikas beginnt nur wenige Jahre in der Zukunft. Sie reicht mindestens eine Generation weit.
Amerikas Städte verfallen, das organisierte Verbrechen hat die Kontrolle übernommen. Kunstdrogen blühen in den extravaganten Clubs der Stadt, während mehr und mehr Obdachlose auf den Straßen dahin vegetieren. Bruce Willis Charakter fasst die Zeitreisethematik gegenüber seinem jüngeren Ich sehr gekonnt zusammen: das Manipulieren der Vergangenheit verursacht ihm in erster Linie Kopfschmerzen. Seine späteren Handlungen werden trotz der bohrenden Kopfschmerzen das Gegenteil beweisen. Zeitreisen werden laut dem von Rian Johnson wahrscheinlich nachträglich aus Verständlichkeitsgründen etablierten Erzähler erst in die Zukunft erfunden und gleich wieder verboten. Nur das organisierte Verbrechen hat sich zumindest eine Maschine gesichert. Mit dieser werden Gegner jeglicher Art zu einem festgelegten Zeitpunkt in die Vergangenheit geschickt. Gefesselt, geknebelt und mit einem Sack über den Kopf. Hier erwartet sie ein „Looper“, der sie umgehend hinrichtet. Auf dem Rücken tragen sie den Judaslohn. Wenn statt Silber Goldbarren in die Vergangenheit geschickt werden, hat der Looper sein eigenes zukünftiges Ich erschossen. Statt deprimiert zu sein, können die Auftragsmörder sich sicher sein, die nächsten dreißig Jahre noch leben zu dürfen, bevor sie selbst aus welchen Gründen auch immer in die Vergangenheit geschickt werden. Kontrolliert wird das Gangsterkartell von Abe – Jeff Daniels -, der extra von seinem Chef dem Regenmacher in die Vergangenheit geschickt worden ist, um die Looper zu kontrollieren. Es gibt nicht schlimmeres, als wenn man sich selbst im entscheidenden Moment nicht umbringt. In diesem Augenblick werden die Auftragsmörder zu Freiwild. In einem der effektivsten wie brutalsten Nutzen der Zeitreise und ihrer Möglichkeit bewisst Rian Johnson, wie man die aus der Zukunft in die Vergangenheit entkommenen älteren Versionen der eigentlichen Killer immer bekommt: man muss sich nur am jüngeren Original vergreifen. Rian Johnsons Vorgehensweise ist interessant, konsequent und schwierig zu gleich. Als Regisseur und Drehbuchautor muss er erst die verschiedenen Gesetzmäßigkeiten entwickeln und verständlich seinem Publikum erläutern, bevor er die imaginären Wände auf einer persönlichen Erzählebene wieder einreißen wird.
Dazu benötigt der Regisseur in der Theorie eine Identifikationsfigur für den Zuschauer. Diese verweigert Johnson er konsequent. Zwar wird aus dem klassischen Antihelden Joe – Joseph Gordon- Levitt – am Ende ein „Held wider Willen“, der für die größeren Ziele eine folgenschwere Entscheidung trifft, die Figur bleibt aber distanziert und soll absichtlich kein Mitleid erregen. Als streunendes Straßenkind hat Abe aufgelesen und ihm eine Zukunft gegeben, die nur ihm gehört: das Töten und die Familie. Schon lange versucht Joe auszubrechen. Er lernt französisch und hortet sein Judassilber in einem Tresen und dem Fußboden seines Apartments, um sich rechtzeitig absetzen zu können, bevor er seinem eigenen zukünftigen Ich begegnet. Als das schließlich der Fall ist, beginnt sein Leben schief zu gehen, denn der ältere Joe – Bruce Willis – hat sich dreißig Jahre lang auf die Zeitreise vorbereitet.
Anstatt die Konfrontation gänzlich in die Vergangenheit zu verlegen, fügt Johnson einen verwirrenden, aber auch sehenswert faszinierenden Mittelteil „Looper“ hinzu. Im Zeitraffer verfolgt der Zuschauer nicht nur einmal Bruce „Joe“ Willis Ankunft in der Vergangenheit, sondern dreimal. Als wenn der Regisseur parallele Zukünfte ausbilden wollte. Beim ersten Auftrag geht alles in der Theorie und Joes Traums „glatt“. Joe lebt sein Leben dreißig Jahre lang, bevor man ihn abholt. Der Regenmacher möchte alle Looper in der Zukunft töten. Das Drehbuch verweigert in dieser Hinsicht eine konsequente Antwort. Sie ist nicht zwingend notwendig und hätte vielleicht für noch mehr Verwirrung gesorgt. Alleine das Argument, das die Möglichkeit der Zeitreise erst den Regenmacher erschaffen hat, wäre eine plausible, wenn auch auf den ersten Blick zu simple Antwort. Beim zweiten Mal kann das ältere „Ich“ den jungen, arroganten Joe mit einem geschickten Bauerntrick täuschen und ausschalten. Damit der Plan des älteren Joes überhaupt funktioniert, darf er sein jüngeres Ich nicht in die Hände der Mafiabande fallen lassen. Zuerst ist der Zuschauer genau wie der jüngere Joe der Ansicht, es handelt sich nur um einen perfiden Racheplan, der die Krebszelle der Mafia in der Vergangenheit ausschalten möchte. Im dramatischen und dramaturgisch überzeugenden letzten Drittel des Streifens wird ersichtlich, dass der ältere Joe mit seiner Rache viel weiter ausholt und das Übel tatsächlich an der Wurzel packen und aus dem Sumpf der amerikanischen bzw. in der Zukunft inzwischen globalen Gangstergesellschaft ziehen möchte. Und das bevor es sich unüberwindlich überall hin ausgebreitet hat. Das jüngere Ich muss erkennen, dass er schließlich zu seinem eigenen Feind werden muss, obwohl er im Grunde in der Theorie auf der Seite seines älteren Ichs stehen müsste. Es ist bezeichnend, dass er in dem Augenblick, in dem er eine echte Liebe zu finden scheint, alles aufgeben muss, damit die Zukunft nicht so wird, wie er es selbst erleben wird.
Rian Johnson bewegt sich in dieser Hinsicht auf einem extrem schmalen Grad. Er will keine Diskussionen über Zeitparadoxa oder Paralleluniversen führen. Darum verletzt er gleich zu Beginn eine Reihe von ungeschriebenen Genregesetzen der Zeitreise. Man darf sich selbst nicht in der Vergangenheit begegnen. Seine Looper töten sogar auf brutale Art und Weise das eigene Ich. Sie sind Anfang und Ende der Zeitreise. Wie abgestumpft und dem leicht verdienten Geld verfallen die Looperkiller sind, zeigt eine ganz bewusst überstilisiert gehaltene Bildfolge zu Beginn des Streifens. Johnsons Zukunft ist in der Theorie kalt, brutal und eisig. Erst in Joes Zeitrafferleben wird der Zuschauer andere, wärmere Zwischentöne erkennen können. Die zarten Pflanzen werden umgehend ausgerissen.
Die zweite These ist, dass die Zukunft in der Gegenwart bestimmt wird. Nur selten hat neben Gilliams „Twelve Monkeys“ eine einzige Aktion einen derartig großen Einfluss auf die Zukunft gehabt. Rian Johnson bereitet sie sehr geschickt vor. Trotzdem ist sie für das Publikum überraschend und schockierend zu gleich, da der Regisseur und Drehbuchautor als notwendige Vorbereitung in einem Punkt schummeln muss. In Hollywood stirbt die aus der Ich- Perspektive erzählende Stimme nie. Nur „Sunset Boulevard“ hat seine Geschichte absichtlich von einem Toten erzählen lassen. Rian Johnson geht nicht so weit, aus Joe einen lebendigen Toten zu machen. Aber erst in den letzten Minuten kann er in der erzähltechnischen Gegenwart des Films sein Schicksal selbst bestimmen, obwohl er mit der leicht aufgesetzt, aber notwendigen Liebesgeschichte zu Emily Blunt das erste abweichende Ausrufezeichen setzt.
Für Rian Johnson wird die Zukunft ausschließlich aus der Gegenwart beeinflusst und kann auch nur im hier und jetzt geändert werden. Natürlich folgt der Regisseur damit den gängigen Zeitreisetheorien, aber im Gegensatz zu vielen anderen Produktionen reduziert er diese Thematik auf eine extrem persönliche Ebene und macht sie damit einem Massenpublikum zugänglich. Es geht weniger um die Vorbestimmung als die Fähigkeit, Leben anderer Mitmenschen zu beeinflussen. Der junge verwaiste Joe ist als Straßenkind von der Mafia aufgenommen und ein Auftragskiller geworden. Am Ende des Films will er ein ähnliches Schicksal einem anderen Jungen nicht zumuten, dessen Fähigkeiten weitreichender sind als es die Protagonisten und damit auch das Publikum ahnen kann. Während Joe seine Einsamkeit, seine Verletzlichkeit und schließlich auch seinen „Hass“ auf das Töten fokussiert hat, ahnt er, dass ihm ein falscher Weg gezeigt worden ist. Mit dem Schlussbild schließt sich ein Kreis, den Rian Johnson weit vor Einsetzen der Handlung eröffnet hat.
Es ist zu einfach zu argumentieren, dass sie sozialen Missstände in einem unter der Depression leidenden Amerika allen Menschen ihre Zukunft verbaut haben. Emily Blunt als Sarah wäre der Gegenentwurf. Sie hat sich nach dem Unfalltod ihrer Schwester auf das einfache Leben auf dem Land zurückbesonnen und sich entgegen ihres bisherigen Discolebens darauf besonnen, dass sie einen eigenen Sohn hat, dem sie mütterliche Verantwortung schuldet.
Ebenfalls zu einfach erscheint, dass die dunklen düsteren Farben der heruntergekommenen Großstädte der stilisierten Idylle des Farnlebens weichen, auf dem zumindest nach Ausgang des Showdowns eine bessere Zukunft Amerikas gegründet worden ist. Ohne Frage spielt die Farbsymbolik eine wichtige Rolle in „Looper“, dem Filmemacher zu unterstellen, er setzt sie manipulierend ein, wäre einen Schritt zu weit gegangen. Rian Johnson arbeitet ohne Frage gerne mit spürbaren Kontrasten und Doppelungen. Der Zuschauer darf aber nicht vergessen, dass die Mafia das Land zum Schauplatz ihrer Verbrechen gemacht und damit Amerikas Unschuld besudelt hat, die einer der Ihren während des Showdowns wieder reinwäscht.
Neben der intelligent provokativen Handlung, die Rian Johnson mit ausgesprochen pointierten Dialogen, einer Reihe von nicht jedem Zuschauer gängigen Zitaten und schließlich einem zynisch melancholischen Off Erzähler anreichert, überzeugen in erster Linie die wenigen, sehr gut gesetzten Actionszenen, von denen einer absichtlich an Camerons ersten „Terminator“ erinnert und die überdurchschnittlichen schauspielerischen Leistungen. Eine vergleichbare cineastische Erzählstruktur mit starken sich auf den ersten Blick widersprechenden Kontrapunkten hat man das letzte Mal bei Peter Weirs „Der einzige Zeuge“ gesehen, dem Rian Johnson ein Denkmal in Form eines intelligenten wie überdenkenswerten Science Fiction Films gesetzt hat. Mehrmals überschreitet Rian Johnson für das Mainstreamkino die Grenze des Zuträglichen und versucht Sadismus cineastisch zu verarbeiten sowie zu kritisieren. Die Amoralität der Bandenwelt erinnert an To´s unerträgliche Mafiathriller. Die verschiedenen Schusswechsel wirken dagegen beruhigend und vertraut. Dass der Regisseur und Drehbuchautor schließlich die Abfolge von Gewalt und Gegengewalt auf einen einzigen Augenblick reduzieren kann, unterstreicht die Souveränität, die Rian Johnson mit seinem inzwischen dritten Kinofilm sich erarbeitet hat.
Abgerundet wird die technisch ausgesprochen innovative, ohne auf sich selbst reflektierende Produktion durch eine Reihe von sehr guten Schauspielerleistungen.
Obwohl auf den ersten Blick unscheinbar überzeugt Emily Blunt als Sarah am meisten. Ehe ehemaliges Jetsetmädchen, das sich lieber nachts durch die diversen Clubs geschlagen als um ihren unehelichen Sohn gekümmert hat, muss sie mit einer Lebenslüge leben. Sie hat die Farm ihrer Schwester übernommen und versucht mit den jähzornigen, anscheinend telekinetische Kräfte auslösenden Emotionen ihres Sohnes fertig zu werden. Rian Johnson zeigt sie als sexuell aktive wie attraktive Frau, die sich bis zu einem gewissen Grad in den jüngeren Joe zu verlieben beginnt.
Damit der Film funktioniert, muss der Zuschauer akzeptieren, dass Bruce Willis und Joseph Gordon Levitt die zwei Seiten eines Menschen sind. Rian Johnson löst diese Spekulation sehr geschickt auf, in dem er die beiden Joes sich in einem Dinner gegenüber sitzen lässt. Sie essen das gleiche, sie haben die gleichen Erinnerungen und Gestik sowie Mimik stimmen im Kleinen überein. Ein gleichzeitig spannende wie lustige Szene, die keine Sekunde lächerlich wirkt. Bruce Willis überzeugt vielleicht noch mehr als Joe. Er ist müde und emotional vernichtet in die Vergangenheit gereist. Seine Mission ist klar umrissen. Stoisch verfolgt er einen einzigen aus seiner Sicht akzeptablen Plan, auch wenn er dabei zu einem Kindermörder wird. Alles für eine aus seiner Sicht bessere Zukunft. Dabei agiert er fatalistisch. Er möchte so kompliziert das auch erscheint, nicht die eigene Zukunft verändern, sondern seinem jüngeren Ich eine bessere Zukunft ermöglichen. Die größte Stärke des Films liegt in der Gegenposition, die sich der jüngere Joe als Bruce Willis schärfster Gegenspieler aufbaut. Anfänglich will er nur Sarahs Jungen als ein mögliches Opfer vor seinem älteren Ich schützen. Später geht es ihm darum, sich zu selbst zu beweisen, das die Zukunft nicht in Stein gemauert ist und das er sie selbst im Gegensatz zu Bruce „Joe“ Willis ändern kann. Dieser innere Reifeprozess wird vom Off Kommentar zu wenig gewürdigt. Schwieriger ist es für den Zuschauer, den Auftragskiller Joe später als Protagonisten und Helden wider Willen zu akzeptieren. Schon früh legt Rian Johnson Hinweise im Film an, wobei in einer Situation Joe egoistisch und opportunistisch an sich denkt und den eigenen Freund verrät. Durch dieses „Höhlenfeuer“ muss der junge Joe gehen, um für die zukünftigen Aufgaben zu reifen. Sowohl Bruce Willis als auch Joseph Gordon Levitt gehen in ihren sehr differenzierten Rollen auf und überzeugen in einem nicht ganz leicht zu verstehenden und hinsichtlich der inneren Logik zu akzeptierenden Streifen. Abgerundet wird die überdurchschnittliche schauspielerische Leistung durch Jeff Daniels als Ziehvater Abe, der Joe zwar von der Straße geholt hat und der die Zukunft kennt, welcher aber auch rücksichtslos und brutal ausschließlich für die Interessen des Clans agiert. Jeff Daniels spielt seine Figur sehr zurückhaltend, mit säuselnder Stimme, aber brandgefährlich und hinterhältig.
Zusammengefasst ist „Looper“ ohne Frage eine Überraschung für das amerikanische Kino. Ein Zeitreisefilm, der komplexe Fragen zu Gunsten einer emotional ausgereiften, fast philosophisch unterlegten Handlung ignoriert und mit Respekt parodiert. Alle wichtigen Fragen dieses Subgenres werden auf zwei oder drei Dialogzeilen reduziert. Es ist ein moderner hintergründiger Thriller mit einer SF Komponente. Rian Johnson wechselt nicht nur frech die Erzähltempi oder die Stimmungen, er hat einen atmosphärisch dichten aber gegen Ende nicht ausschließlich depressiven Film geschaffen, der effizient und innovativ zu gleich das Genre nicht nur ernst nimmt, sondern es um eine zum Klassiker taugende Variante erweitert.
CINE TRASH & TREASURY
Beitrag Looper von Thomas Harbach
vom 15. Okt. 2012
Weitere Beiträge
|
|
Thunderbirds Season One
Thomas Harbach |
|
|
Valentino
Thomas Harbach |
|
|
Deadpool
Thomas Harbach |
|
|
Fritz Langs Meisterwerke
Thomas Harbach |
|
|
The Big Knife
Thomas Harbach |
| [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] . . . . . . . . . . . . [ 112 ] | |
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info