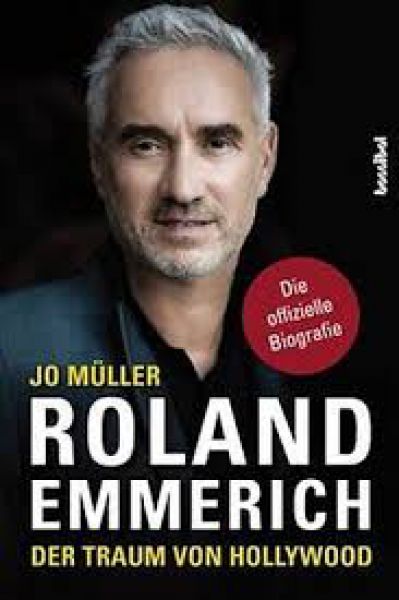|
|
Startseite > Kolumnen > Thomas Harbach > CINE TRASH & TREASURY > Roland Emmerich - ein Biographieversuch |
Roland Emmerich - ein Biographieversuch
Pünktlich zum Start der Fortsetzung von „Independence Day“ erscheint die offizielle Biographie des aus Sindelfingen stammenden Regisseurs, der im Vergleich zu anderen kurzzeitigen deutschsprachigen Schwergewichten wie Wolfgang Petersen in Hollywood sich nicht nur als „Master of Desaster“ etabliert hat, sondern in mehr als fünfundzwanzig Jahren beweisen konnte, dass nicht immer stimmiges tricktechnisches perfektes bzw. perfektioniertes Entertainment funktioniert. Dabei geht manchmal unter, dass Emmerich zumindest immer wieder latente Warnungen – Umweltverschmutzung in „The Day after Tomorrow“, den rücksichtslosen Umgang mit Atomwaffen wie in „Godzilla“ und eine aus den Fugen geratene Welt wie in „2012“ – in seine in erster Linie von Action getriebenen Streifen eingebaut hat.
Der Autor der Biographie Jo Müller hat Roland Emmerich seit vielen Jahren durch einige Dokumentation begleitet. Er ist bei den Anfängen dabei gewesen und für die ZDF/ Arte Dokumentation „Roland Emmerich- mein Leben“ in Cannes mit dem goldenen Delfin ausgezeichnet worden. Vielleicht ist es sogar sinnvoll, vor der Lektüre dieser Biographie den Film anzusehen, denn Jo Müller sagt zwar in seinem Vorwort, dass er nicht die üblichen Wege eines Biographen gehen und möglichst viele Menschen zu Wort kommen lassen will, aber herausgekommen ist ein Buch, das sich fast absichtlich ehrfürchtig seinem Objekt der Begierde gar nicht nähern kann oder nähern will. Wie die meisten von Emmerichs Filmen wirkt alles sehr glatt und sehr oberflächlich. Die Struktur ist klar. In Reißbrettmanier hackt Jo Müller – wenn man sein Buch mit dem ersten Film „Das Arche Noah Prinzip“ inhaltlich zu kritisieren beginnt – jede Arbeit des Schwaben ab. Eine kurze Zusammenfassung – nicht selten mehr als zehn Seiten – der Grundidee, die entsprechende Umsetzung, dann die Reaktion des Publikums bzw. der Studios und anschließend ein oder zwei Interviews, wobei meistens Emmerich allerdings positiv zeitnah etwas zum Spiel sagt. Es gibt keine echten kritischen Äußerungen. Für seine deutschen Produktionen wird der Makel, entweder Hollywood in Deutschland zu inszenieren oder anders herum immer wieder das Gleiche zu machen nicht weiter erläutert. Dabei verfügen „Joey““ und „Hollywood Monster“ über inhaltliche Gemeinsamkeiten, die ausdiskutiert werden könnten. In einem der Interviews zu Beginn seiner Karriere spricht Emmerich davon, dass er sich als Regisseur sieht und seine eigenen Drehbücher nicht unbedingt ausgefeilt sind. Mehr und mehr ist er als Co Autor aufgetreten, der gerne mit Freunden wie Dean Devlin geschrieben hat. Aus Deutschland heraus kommentierend sucht er schon starke Drehbuchautoren, während er sich um die visuelle Umsetzung seiner Filme kümmern kann. Wie einige andere Passagen dieses Buches reizen Emmerichs wohl gemeinte Kommentare, um sie an seinen Filmen auszuprobieren. Aber Jo Müller traut sich nicht, auch Kritik zu äußern. Wenn ein „Universal Soldier“ – schließlich Emmerichs Eintrittskarte nach Hollywood – auf der einen Seite ein stringentes Abenteuer ist, dem er auf der anderen Seite auch mangels Interesse verschiedene Karateseiten abgesprochen hat, um einen Science Fiction Stoff zu inszenieren, so erwartet der Leser normalerweise auch eine Reflektion des geschriebenen am Film selbst. Natürlich handelt es sich um kein Meisterwerk, aber alleine in wenigen Sätzen den kommerziellen Erfolg herauszustellen, ist eindeutig zu wenig. Auch bei seinen ersten Filmen – „Das Arche Noah Prinzip“ erhellt noch die meiste neutrale Kritik – bleibt Jo Müller so frustrierend oberflächlich, das sich der Sinn dieses Buches insbesondere für Emmerich Fans nicht nachhaltig genug erschließt. Es scheint ja kritische Stimmen von Dritten gegeben zu haben, mit denen sich ein guter Biograph auch auseinandersetzen könnte. Zumal ihm Emmerich auch noch mehrfach ein gutes Blatt hinlegt. Der Schwabe ist müde gewesen, nicht als eigenständiger Filmemacher, sondern als Hollywoodimitator aus Sindelfingen einkategorisiert worden zu sein. Auf die Vorbilder wie insbesondere die neue Hollywoodgeneration um Steven Spielberg und Martin Scorsese geht Jo Müller genauso ein, wie Roland Emmerich, der sich als Unterhaltungsregisseur der alten Schule und weniger als Mutant des neuen deutschen Kinos gesehen hat. Aber warum nutzt Jo Müller nicht die Chance, insbesondere die Einzigartigkeiten Emmerichs ersten Streifen unter Verwendung der Stilmittels Hollywood, aber schwäbischer Innovation herauszuarbeiten? Die wichtigsten Informationen sind, dass neben der finanziellen Koordination durch den Vater die Mutter die Crew gekocht hat und das Hallen in der heimischen Nähe angemietet worden sind, um billiger und effektiver die Filme umzusetzen. Wenn bei „Moon 44“ Emmerichs Produktionsfirma inzwischen das Budget von sieben Millionen DM aus eigener Tasche aufbringen und auf Filmförderung verzichten konnte, dann fragt sich der Leser, wie das angesichts der eher soliden, aber aufgrund der effektiven Herstellung positive Zahlen liefernden Vorgänger Filme möglich gewesen ist. Emmerich mag es nicht, über Budgets zu sprechen oder in Details zu gehen. Der Vergleich, bei einem Freund auch nicht nach den einzelnen Kosten im gerade gebauten Haus zu fragen, ist typisch wie treffend, aber für einen Biographen eher eine Herausforderung. Insbesondere zu Beginn von Emmerichs Karriere – nur älteren Fans bekannt – scheint Jo Müller alte Artikel und Essays zu nutzen, die eher oberflächlich für diese Biographie auf den neusten Stand gebracht worden sind.
Die kritische Auseinandersetzung mit Emmerichs inzwischen ja auch umfangreichen Werk ist überwiegend so ambivalent gehalten, dass es enttäuscht. Keine kritische Auseinandersetzung mit den Schwächen in einigen seiner Werke – die nicht alleine dem Drehbuchautoren zugeschrieben werden können – und die für Hollywood fast typische Überbetonung von Stil über Inhalt. Selbst der für Emmerich in Los Angeles viele weitere Türen öffnende „Stargate“ wird kurz mit einem sich zwischen Text und Interview wiederholenden Schwerpunkten abgehandelt: die logistischen Schwierigkeiten beim Dreh in der Wüste. Das ist eindeutig zu wenig, zumal über die kommerzielle Vermarktung, die anschließende Fernsehserie und vor allem die Vorbilder ausgesprochen wenig ausgesagt wird. Alleine Erich von Däniken als Ideengeber seit der Jugend für dieses Projekt zu nehmen, ist oberflächlich. Die Sternentore erinnern an die Transmitter aus der Perry Rhodan Serie und die Idee eines Aufstandes des Proletariats mit Hilfe der amerikanischen Elitesoldaten gegen den übermächtigen außerirdischen Herrscher erscheint zu wenig. Ohne Frage ist Emmerich ein sehr intelligenter Filmemacher, der vielleicht seit vielen Jahren das Optimum aus den ihm zur Verfügung gestellten Budgets machen kann und macht, aber reicht das, um eine nicht nur offizielle, sondern sich wirklich mit dem Menschen und dem Regisseur auseinandersetzende Biographie? Wahrscheinlich nicht.
Anfänglich verschanzt sich Jo Müller wie Roland Emmerich trotz der Betonung, ein Perfektionist zu sein, hinter dem Begriff des Popcornkinos inklusiv eines entsprechend feinem Humor, der dem Zuschauer suggerieren soll, dass alles erlaubt ist und nicht alles wirklich realistisch ist. Emmerich geht es darum, Filme zu machen und möglichst mit breitem Pinsel zu malen. Später fließt ein wenig sehr dezente Kritik ein. Es gibt zwei Musterbeispiele. Bei „The Day after Tomorrow“ kritisiert Jo Müller, dass die Rettung des vom Eis eingeschlossenen Jungen inklusiv der Zusammenführung der Familie ein wenig unrealistisch erscheint. Diese Odyssee des anfänglich gebrochenen Helden findet sich nicht nur in „The Day after Tomorrow“, auch in „2012“ oder „Independence Day“. Sie ist ein handlungstechnisches Versatzstück, wie Jo Müller in seinem eher eingefügten als wirklich eingebauten Essay über das Katastrophenkino festhält. Aber wird eine unrealistische Szene durch eine Wiederholung in verschiedenen Facetten überzeugender? Auch in „10.000 BC“ erschafft Emmerich trotz seiner Recherche mit den sauberen Steinzeitmenschen und der englischen Sprache eine Welt, die nur tricktechnisch funktionieren kann. Der Leser bekommt den Eindruck, als könne der Biograph diese Schwachstellen in Emmerichs Werk nicht unterschlagen, wegen des guten Verhältnisses zum Regisseur aber auch nicht sonderlich breit treten. Dabei hat der Schwabe immer wieder betont, dass er offene konstruktive Kritik auch schätzt. Andere Kritiker werden mundtot gemacht. Natürlich schlägt Emmerich mit „ID“ zurück, in dem er den aus seiner Sicht schleimenden Kritikern zeigen kann. Er hat einen Film inszeniert, der an die Spitze des Box Office gelangt ist. Typisch amerikanisch, denn erstens macht es den Film nicht unbedingt besser und zweitens sind seine deutschen Arbeiten deutlich besser durchdacht gewesen. Sie waren nur kommerziell nicht erfolgreich. Ansonsten wird nicht eine einzige Kritik zitiert. Ein guter Biograph hätte andere Rezensionen zum Anlass genommen, um Emmerichs Werk auch aus einer anderen vielleicht deutlich objektiveren Perspektive zu betrachten. Den langen Inhaltsangaben steht im Anschluss zu wenig Gehalt gegenüber. Und für Zusammenfassungen der Filme braucht der Leser in Zeiten des Internets eigentlich nichts zu bezahlen.
Jo Müller versucht das Amerikabild, das Emmerich nicht immer selbst ironisch, sondern heroisierend zeichnet zu relativieren. Die Amerikaner fahren eben auf eine Glorifizierung ihrer Nation mehr ab als die Europäer, die inzwischen seit vielen Jahren eine kritische, durchaus berechtigte Distanz aufgebaut haben. Wie sehr sich Emmerich dem amerikanischen Geschmack angepasst hat, zeigen die Versuche, diesen Fahnenfetischismus zu erläutern. Während Emmerich sich in einem abschließenden Interview positiv über die Zusammenarbeit mit Mel Gibson äußert, arbeitet Jo Müller überzeugend heraus, wie sehr sich vor unterschiedlichen historischen Hintergründen „Braveheart“ und „Der Patriot“ ähneln.
Mit Budgets ist das so eine Sache in diesem Buch. Jo Müller scheint nur absolute Zahlen zu sehen und verzichtet auf ein Kosten/ Ergebnisverhältnis. Das wird insbesondere im Vergleich von „White House down“ und „Olympus has Fallen“ deutlich. Auch bei anderen Filmen schreibt er von deutlichen Erfolgen, während nur das doppelte der Produktionskosten – diese beinhalten meistens nicht die Werbeetats – eingespielt worden sind.
Bei den Emmerich Produktionen wie „The Visitor“ oder „13th Floor“ – eine Variation von Rainer Werner Fassbinders „Welt am Draht“, basierend auf einem Science Fiction Roman von Galoye – werden die Namen genannt und Emmerich selbst spricht davon, dass er auch Arbeit hineingesteckt hat. Mehr erfährt der Leser nicht über sie. Nicht realisierte Projekte werden nur selten gestreift und dann kaum extrapoliert. Es ist schade, wieviel Potential Jo Müller in diesem Buch verschenkt. Als Dokumentarfilme muss er wie ein Filmregisseur eine Geschichte möglichst kompakt und stringent erzählen, als Biograph hat er aber mehr Platz, mehr Raum, um in die Tiefe zu gehen und unbekannte Details zu finden. Wenn er es an einigen Stellen nicht zuletzt durch verschiedene persönliche Gespräche mit Emmerich macht, dann lebt sein Buch. In zu vielen anderen Passagen zeigt er seinen Unwillen, durch die offenen Türen zu gehen und wirklich nach Informationsperlen zu graben.
Ein wichtiger Aspekt ist der Privatmensch Emmerich. Auch hier kommt der Filmemacher und Biograph nicht sonderlich weiter. Seine Mutter, sein Vater in einem sehr kurzen, früh entstandenen die geschäftlichen Beziehungen ansprechenden Interview und schließlich seine langjährige Produzenten und Schwester Ute kommen zu Wort. Sie beschreiben Roland Emmerich durch und durch als zielstrebigen, aber auch von seinen Visionen gefesselten sehr angenehmen Menschen, der in erster Linie Film machen möchte. In seinem ersten Interview – es stammt aus der Gegenwart und soll die Biographie einleiten – spricht Emmerich über das Leben in Los Angeles und London. Zwischen den Zeilen kann der Leser erkennen, das er trotz seiner heimischen Wurzeln amerikanisiert worden ist und weiß, dass es sich – wie er selbst zugibt – in Los Angeles sehr gut leben lässt, wenn man Geld hat. Die Fotos seiner Villa zeigen, das er versucht, Hollywoods goldene Jahre nicht nur mit seinen abenteuerlichen Stoffen auf de Leinwand, sondern auch in seinem Privatleben zu imitieren. Wenn er davon spricht, dass er sich einen Turm mit Swimming Pool und Büro sowie einem Blick über Los Angeles bauen lassen will, dann zeigt es, dass er die eher schwäbisch normal lebenden Wurzeln seiner bürgerlichen Industriellenfamilie endgültig verlassen hat. Emmerich kommt zwar aus einem reicheren Unternehmerhaus, das aber die Basis ihres Erfolges selbst entwickelt hat. Auch Emmerich hat mit wenig angefangen und sich einen Namen gemacht.
Wie der Vater ist der Regisseur ein Unternehmer, der weiß, dass seine Kunst nicht nur sehr viel Geld kostet und nur als Teamwork funktionieren kann, sondern das sie das Geld auch wieder einspielen muss. Er wird als introvertiert mit einem Hang zum schwarzen Humor – in einer guten Biographie werden wichtige Abschnitte in einem Kapitel und nicht über den Text verteilt abgehandelt – beschrieben, der sich aus der literarischen Ecke heraus schließlich zum Unterhaltungsregisseur beeinflusst von Spielberg und Scorsese, aber nicht von Fassbinder entwickelt hat. Er hat immer nur wenige dann allerdings gute Freunde um sich gehabt und schätzt ein produktives, aber freundschaftliches Arbeitsklima auf seinen Sets. Mehr erfährt der Leser über weite Strecken des Buches nicht über ihn. Es gibt keine kritischen Stimmen und wenn sich Emmerich mit einem Menschen wie dem Produzenten Joel Silver streitet, dann immer aus der Position des Rechts heraus.
Interessant ist, dass es zwar immer wieder Interviews mit Freunden und Kollegen gibt – Der Komponist Kloser gibt auf der einen Seite an, dass Emmerich ihn wegen des Soundtracks zu „Der Patriot“ schweigend fallen gelassen hat, während Emmerich später auf den ebenfalls aus Deutschland stammenden Komponisten zu gegangen und ihn in seinen inneren Kreis holte - , in denen Emmerich nettes Wesen – einzelne Ausbrüche am Set spielen keinen große Rolle – immer wieder betont wird. Sein Sinn für Freunde und Familie. Zwar auch der Hang, modern und sportlich jugendlich zu erscheinen, aber nicht zu Hype zu wirken. Emmerich selbst erwähnt beiläufig in einem Interview, dass er seit vielen Jahren mit Omar glücklich ist. Hätte er nicht das von der Kritik angefeindete Homosexuellendrama „Stonewall“ gedreht, wäre dieser Punkt nicht angesprochen worden. Jo Müller geht dezent mit dem Thema um, in dem er Emmerich selbst in einem abschließenden Interview von seiner Homosexualität im Herzen des Schwabenlandes und seiner Angst, ein schwuler Actionregisseur zu sein, berichten lässt. Dezent fragt er nicht nach. Dieses fehlende Nachfragen, diese „Vergötterung“ Emmerichs zieht sich auch zu sehr durch das ganze Buch. Auf der persönlichen Ebene bleibt Emmerich dem Leser fern. Auf der einen Seite scheint er inzwischen Gefallen an Science Fiction gefunden zu haben, die er als Jugendlicher abgelehnt hat. Er versucht Amerikanischer zu erscheinen als die Amerikaner selbst, was sich in einigen selbst Michal Bay übertreffenden kitschig triefenden Szenen äußert. Das seine Schwester und er nur Amerikaner geworden sind, um Obama zu wählen, wird erwähnt, aber nicht weiter extrapoliert. Emmerich selbst spricht in einem Interview davon, dass seine ersten deutschen Filme kaum ihre Kosten eingespielt bzw. kleine Gewinne gemacht haben. Wie konnte er auf der anderen Seite das schon angesprochene Budget von „Moon 44“ selbst stemmen, wenn seine bisherigen Arbeiten keinen entsprechenden Cash Flow generiert haben. Hinzu kommt aber ein weiteres Ärgernis. Sowohl die zwar kritischer, aber noch verhaltene zumindest chronologische Auseinandersetzung mit seinen Filmen als auch die eher geringe Auseinandersetzung mit Emmerich als Mensch/ Persönlichkeit werden nicht selten von nicht immer zeitnahen Interviews begleitet. Jo Müller hat sich dazu entschieden, diese Interviews wahrscheinlich in der Originalform zu lassen und leider auf Quellenangaben zu verzichten. Insbesondere einige Gespräche mit Emmerich scheinen tatsächlich vor vielen Jahren aufgezeichnet worden zu sein und werden entsprechend den Vorstellungen der Filme präsentiert. Dabei kommt es nicht nur zu Wiederholungen mit Passagen, die Jo Müller selbst in seinen Texten schon ausführlich beschrieben hat, sondern auch innerhalb der Interviews gibt es Wiederholungen. Der Leser muss schon über ein ausgebildetes Kurzzeitgedächtnis verfügen, um diese „Platzfüller“ nicht als störend zu empfinden. Viel effektiver wäre es, die Interviews nicht nur chronologisch entweder durch Zeit oder Quellenangabe inhaltlich einzuordnen, sondern sie vielleicht direkt in die Fließtexte einzubauen und so den beschreibenden Teil den persönlichen Erinnerungen gegenüberzustellen. So wirkt diese offizielle Biographie leider noch blutleerer und vor allem wie ein weiterer kommerzieller Bestandteil der Marketingmaschine im Vorfeld von „Independence Day „“, der ersten Fortsetzung, die Emmerich wirklich gedreht hat.
Zurück bleibt ein Buch wie das Popcornkino, das Emmerich seit vielen Jahren im Grunde in Perfektion zelebriert. Optisch unterhaltsam und kurzweilig zu lesen; sich kontinuierlich weigernd, eine Position zu beziehen und durch den Hinweis auf die offizielle Biographie allerhöchstens für Fans interessant, die am Anfang ihrer Auseinandersetzung mit einem Regisseur stehen, der es Blockbuster technisch tatsächlich aus den Lagerhallen seiner schwäbischen Heimat in Hollywood geschafft hat. Wer sich intensiver mit der Materie beschäftigen möchte, wird leider bitterlich enttäuscht und mit zu wenigen wirklich interessanten Informationen zurück gelassen.
CINE TRASH & TREASURY
Beitrag Roland Emmerich - ein Biographieversuch von Thomas Harbach
vom 23. Mai. 2016
Weitere Beiträge
|
|
Thunderbirds Season One
Thomas Harbach |
|
|
Valentino
Thomas Harbach |
|
|
Deadpool
Thomas Harbach |
|
|
Fritz Langs Meisterwerke
Thomas Harbach |
|
|
The Big Knife
Thomas Harbach |
| [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] . . . . . . . . . . . . [ 112 ] | |
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info