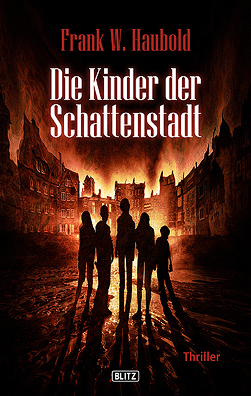|
|
Startseite > Rezensionen > Thomas Harbach > Horror > Die Kinder der Schattenstadt |
Die Kinder der Schattenstadt
| DIE KINDER DER SCHATTENSTADT
Frank W. Haubold Taschenbuch, 320 Seiten |
In seinem herzerfrischend ehrlichen Nachwort geht Frank W. Haubold auf die lange, zahlreiche Versionen umfassende Entstehung seines düster phantastischen Romans „Die Kinder der Schattenstadt“ ein. 1997 ursprünglich als locker miteinander verbundene Geschichtensammlung „Am Ufer der Nacht“ erschienen ärgerte sich Frank W. Haubold über die spärliche Reaktion auf seine Veröffentlichung. Mehrere Überarbeitungen später liegt die kaum noch mit der ursprünglichen Fassung zu vergleichende Version als Taschenbuch im Blitz Verlag mit einem sehenswerten Titelbild von Mark Freier vor. Ursprünglich stand – wie der Autor auch selbst zugibt - der literarisch ambitioniert zu bezeichnende Versuch im Mittelpunkt, eine fast klassische apokalyptische Gruselgeschichte mit autobiographisch eingefärbten Erinnerungen aus der eigenen Jugend in der DDR zu kombinieren. Auch wenn dieses „Gerüst“ immer noch erkennbar ist, konzentriert sich der Autor überwiegend auf eine stilistisch sehr ansprechend verfasste Mystery bzw. im späteren Verlauf Postdoomsdaygeschichte.
Die Wurzeln des aktuellen Übels liegen in der Vergangenheit. Zumindest vordergründig. In den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs soll eine kleine Einheit von Soldaten eine der legendären Wunderwaffen in einem Bergwerk vor den heranrückenden überwiegend russischen Truppen versteckt bewachen. Neugierig erkunden zwei eher am Überleben denn am Endsieg interessierte Soldaten die Stollen. Neben zahlreichen hingerichteten Bewohnern der Baracken finden die beiden Soldaten eine bedrohliche, von Frank W. Haubold eher ambivalent beschriebene bedrückende Atmosphäre vor. Sie lässt sich nicht näher greifen, schockiert die Soldaten aber bis ins Mark und lässt sie befehlswidrig agieren. Anscheinend haben die Nazis tatsächlich auf den V2 Lafetten irgendeine geheime wie tödliche „Waffe“ installiert, welche – das Eintreffen eines Mitglieds der Waffen SS bestätigt diesen Verdacht – nicht unbedingt den Endsieg, aber die totale Vernichtung bringen soll. Die Atmosphäre der in den letzten Tagen spielenden Auftaktsequenz ist dunkel, erdrückend, spiegelt die Brutalität des Krieges kaum in passenden Worten wieder. Die Figuren sind fast überspitzt eindrucksvoll gezeichnet. Und trotz will der Funke nicht gänzlich überspringen, da der Leser spätestens mit Einsetzen der Gegenwartsebene weiß, dass das Böse nicht besiegt worden ist. Hier agiert Frank W. Haubold etwas überambitioniert, versucht die Leser gleich kommerziell effektiv, aber auch literarisch stereotyp in den Plot einzubeziehen. Der Autor muss sich die Frage gefallen lassen, ob eine fortlaufende Integration dieser Auftaktszene in die laufende Handlung – sei es durch Tagebuchaufzeichnungen oder Fundstücke in den inzwischen verschütteten Bergwerksstollen – nicht spannungstechnisch effektiver gewesen wäre.
Mit dem Einstieg in die Gegenwartshandlungsebene – der Begriff ist natürlich relativ, da die Geschichte zu DDR Zeiten einsetzt – beginnt ein neuer Spannungsbogen, bei dem sich der Leser natürlich fragt, wann und nicht ob sich die Ereignisse der Vergangenheit mit der laufenden Handlung verbinden. Natürlich hinterfragt der Leser auch die Art der Bedrohung, die sich erst im letzten Drittel des Buches konkretisiert.
Mit dem dicken, behäbigen von vielen gehänselten Damian - Nomen est Omen - sowie dem eher opportunistischen Fabian etabliert Frank W. Haubold in der Gegenwartsebene zwei sehr unterschiedliche Figuren, die wie “magisch” von einander angezogen werden. Dabei trennen sich ihre Wege nach Abschluss der Schule, doch die “Mächte” in den gesprengten Bergwerksstollen bringt sie wieder nach einer wahren Odyssee bzw. brutalster strategischer Planung an den Ort ihrer Jugend zurück. Fabian als mäßig erfolgreicher Autor - es verbietet sich hier, von einem Alter Ego Haubolds zu sprechen - durchläuft die üblichen Stationen - erste wahre Liebe, Militärdienst noch zu DDR Zeiten, schließlich die Wende - , während Damian nach den Hänseleien und der Flucht der Mutter in den Westen erst von der Großmutter aufgezogen seinen diabolischen Weg macht. Unterstützt von seinem imaginären Kameraden setzt Damian ausgesprochen rücksichtslos und von Frank W. Haubold im stärksten frühen Abschnitt des Romans einen perfiden Plan um. Nach den anfänglichen Horrorelementen wird “Kinder der Schattenstadt” in diesem Abschnitt zu einem Krimithriller mit übernatürlichen Hintergrundelementen. Viele Zusammenhänge inklusiv einiger Nebenfiguren wie der geheimnisvollen attraktiven Frau mit der außerordentlichen Körperbeherrschung lassen sich positiv wie negativ noch nicht einordnen, aber Frank W. Haubold scheut sich nicht, sympathisch entwickelte Nebenfiguren ebenso ums Leben kommen zu lassen. Hier sei beispielhaft Damians erster echter Freund sowie der brutale Ziehvater oder in einer der späteren eher überzogenen Passagen des Romans einen Auftragskiller mit sadistisch perversen Neigungen genannt. Weniger wäre angesichts des vielschichtigen und überaus intelligent beschriebenen Handlungsaufbau mehr gewesen. Frank Haubold setzt sich selbst unter Druck, in dem er elementare Ereignisse fast emotionslos und distanziert erzählt. Dem gegenüber stehen positiv die dann wieder autobiographisch erscheinenden Passagen wie das zwanzigjährige Klassentreffen, die unter dem Eindruck der Wiedervereinigung irgendwo zwischen melancholischer Rückschau und unterdrückter Wut auf die politisch bedingten Veränderungen aus der Handlung zu sehr aber angenehm zu lesen herausstechen.
Wenn sich kurz nach der Mitte des Buches der Kreis schließt und die wichtigsten Protagonisten teilweise mit ihren übernatürlichen Helfern oder von mystischen Zeichen wie Todesvögeln angelockt die Bühne der finalen Konfrontation - ohne es zu ahnen - betreten, zieht Frank W. Haubold das bislang eher von einer interessanten, aber nicht immer befriedigenden Mischung aus der nicht mehr verfilmten vierten “Das Omen” - Damians Handlungen - bestimmte Tempo signifikant an und zieht den Leser noch mehr in den Bann des Geschehens. Plötzlich wird „Die Kinder der Schattenwelt“ eine Art apokalyptischer Terroristenroman, in dessen Handlungsverlauf ideologische Verblendung auf Kommerz bzw. den in den Chaostagen des Zweiten Weltkriegs verschütteten Untergangsplan trifft. Etwas zu nüchtern neutral – das entspricht auch nicht Frank W. Haubolds Erzählstil – beschreibt er nicht nur die durch Damians perfiden Plan ausgelöste Kettenreaktion, sondern „wirft“ die Protagonisten in eine dem Untergang geweihte Welt, in der Millionen Menschen entweder an radioaktiver Strahlung bzw. einer durch einen Virus ausgelösten russischen Grippe sterben.
Diese Tragödie verdient aber einen deutlich breiteren Rahmen. Haubold reiht eine erschütternde Szene an die nächste, beschreibt schriftstellerisch sehr direkt, solide, aber nicht inspiriert die chaotischen Ereignisse, geht aber nicht den emotionalen Schritt weiter. Als Autor versteht er sich ausgesprochen gut auf eine melancholisch ruhige Stimmung mit zugänglichen Charakteren, deren Welt auf einer intimen Ebene auseinandergerissen wird. Globale Katastrophen liegen dem Autoren thematisch nicht. Zumindest hervorzuheben ist, dass er auf eine unglaubwürdige Rettung inklusiv der Vernichtung des „Bösen“ in letzter Sekunde verzichtet und das Apokalypse zumindest in Europa beginnen lässt. Weiterhin positiv folgt Haubold nicht den grundsätzlichen Regeln des Katastrophenromans, sondern treibt insbesondere den überforderten Fabian im wahrsten Sinne des Wortes durch ein verwüstetes Deutschland. Während sein weiblicher Schutzengel vollkommen undramatisch wie überraschend stirbt, wirkt eine andere zufällige Begegnung auf dem Weg zu Damian aufgesetzt und dramatisch überambitioniert. Auch wenn diese Plotwechsel – von autobiographischen Jugenderinnerungen zu einer Postdoomsdaygeschichte mit politischem Sprengstoff bis zur finalen, absehbaren Konfrontation zwischen Damian und Fabian inklusiv einer Handvoll Vertrauter/ehemaliger Freunde/Nachbarn – interessant gestaltet worden sind, wirken sie in der hier angelegten Struktur zu vorhersehbar. Frank W. Haubold wird es nicht gerne hören, das Potential von „Die Kinder der Schattenwelt“ wird zu wenig gehoben. Zu bieder trotz zahlreicher sehr guter Ideen angelegt, agiert der inzwischen doch sehr routinierte Autor zu unsicher, zu ambivalent, zu schwankend. Der Roman hätte vielleicht interessanter gewirkt, wenn Haubold die grundlegende Struktur durchbrochen und den Plot deutlich experimenteller, verschlüsselter und dadurch herausfordernder erzählt hätte. Warum nicht in der postapokalyptischen Welt mit einem überforderten, von seinem Leibwächterschatten begleiteten Fabian anfangen? Die mystischen Todesvögel könnten den Übergang zur Vergangenheit bilden. Protagonist und Leser desorientiert. Mit einer dunklen, mystischen Atmosphäre Spannung erzeugen, die Welt verfremdet erscheinen lassen und dann erst die Wurzeln in Damians Jugendexpedition und darüber hinaus in den wirren Tagen des Zweiten Weltkriegs heben. Frank W. Haubold verfügt ohne Frage über das entsprechende Potential. In der vorliegenden Fassung müssen Fabians Begleiter den Protagonisten quasi mit dem Schnabel auf die Wurzel des Problems stoßen, die der Leser schon nach gut einem Viertel des Buches kennt und einzuschätzen vermag und die Fabian auch zumindest erahnen müsste. Erst während seiner Odyssee hätte Fabian – deutlich interessanter als der eher klischeehaft angelegte Damian – auf Augenhöhe mit dem Leser das Puzzle zusammensetzen dürfen, um die Spannung aufrechtzuerhalten. Die finale Konfrontation ist dagegen dramatisch zufriedenstellend, wenn auch etwas an Stephen Kings frühe Romane wie „Es“ angelehnt worden und stilistisch ein wenig zu unheilschwanger ausformuliert. Hier versucht der Autor mehr als einen direkten Horrorroman zu verfassen, in dem er Damian und Fabian zusätzlich eine Art verbales Privatduell ausfechten lässt.
Haubolds Markenzeichen – stimmige Atmosphäre stilistisch überdurchschnittlich bis brillant entwickelt – finden sich über den ganzen Roman verstreut. Sie geben einen nachhaltigen Eindruck vom Potential des vorliegenden Buches. Der mystische Aspekt hätte viel stärker betont werden können und betont werden sollen. Im Gegensatz zu den beiden einflüsternden Schattenwesen/ Todesvögelns sind die verschiedenen Zeichen gut über den ganzen Handlungsrahmen verteilt.
Zusammengefasst hat die kontinuierliche Arbeit über einen Zeitraum von vierzehn Jahren das Buch trotz überzeugender neu eingeführter Figuren wie Sirien nicht in allen Punkten dramaturgisch homogener erscheinen lassen. Es ist immer noch eine lesenswerte Geschichte, aber zum einen hat die Zeit den grundlegenden Plot in der hier dargereichten Form überholt und zum anderen will der Autor zu viel auf einmal ohne die eher bodenständig stringente Erzählstruktur zu verändern. Vergleicht man Haubolds Entwicklung als Schriftsteller in den letzten Jahren erscheint „Die Kinder der Schattenwelt“ eher als eine Art literarische Liebhaberei, verschiedene Genres ein wenig unentschlossen und zögerlich miteinander zu kombinieren, ohne das große Potential der Geschichte nachhaltig zu heben.
Der Rezensent
Thomas HarbachTotal: 732 Rezensionen
März 2018: keine Rezensionen
Weitere Rezensionen
|
|
Die Kinder der Schattenstadt
Frank W. Haubold - DIE KINDER DER SCHATTENSTADT |
[Zurück zur Übersicht]
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info