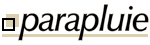
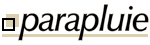 |
elektronische zeitschrift für kulturen · künste · literaturen |
|
no. 20: ohr
|
Siehst du noch oder hörst du schon?Die Neue Aufmerksamkeit für das Auditive |
||
von Andreas Haderlein |
|
In einer durch Visualität und Sichtbarkeit geprägten Kultur gewinnt das Ohr wieder an Bedeutung. Die digitalen Kommunikationsmedien erschließen neue Dimensionen des akustischen Raumes und werfen neue Fragen auf -- von der Klangökologie über Soundscape Studies bis hin zu medienpädagogischen Offensiven. Die Abkehr von der Favorisierung des Sehens zu einer neuen Betonung des Hörens kann sich allerdings schon auf ältere Urväter berufen, insbesondere Johann Gottfried Herder. |
||||
Spätestens seit Beginn der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts läßt sich eine 'Neue Aufmerksamkeit' auf das Ohr, das (Zu-)Hören und seine kulturellen wie wahrnehmungsphysiologischen Bedingungen attestieren. Dies gilt für publizistische, medienpädagogisch geprägte institutionelle oder wissenschaftlich forschende Aktivitäten, wie auch für Anstrengungen fernab des akademischen Geschehens. |
||||
Denn dort kommt das Ohr ganz alltäglich zu neuen Ehren: Kunsthäuser entdecken die Anziehungskraft der Sound Art wieder, Hörbücher retten die angeschlagene Buchbranche über Absatzflauten, Die Zeit stellt Zeitungsartikel als Online-Audio-Angebot zum Download bereit, Gadgets wie der iPod erreichen Kult-Status, und das Sample ist gar popkulturelles Paradigma des vergangenen Jahrzehnts. |
||||
Musik, das ist klar, sie war schon immer Gegenstand der öffentlichen Auseinandersetzung. Sei es in Fanzines und Szeneblättern oder in den Feuilletons und Rezensionsspalten der Tageszeitungen. Und Popkultur im engeren Sinne ist -- aller Zu-Grabe-Tragungen zum Trotz -- wahrhaft ein ständiges Hör-Experiment: Klänge und Rhythmen, Stimmen und Sternchen stehen stellvertretend für ganze Generationen und Jugendkulturen -- auch heute, in Zeiten, in denen der Puls der musikalischen Zeit elektronisch schlägt und die Digitalisierung den Umgang mit Musik und Klang revolutioniert oder, je nach Standpunkt, verflacht hat. |
||||
Aber auch und gerade fernab (audio-)künstlerischer, musikalischer und popkultureller Entwicklungen verfestigt sich eine Kultur des Hörens, ein transdisziplinärer Raum, in dem der Hörende und das auditive Innen ebenso im Mittelpunkt stehen wie das Klingende, Tönende, Lärmende, Sounds -- das akustische Außen eben. In einer durch Visualität und Sichtbarkeit geprägten Schriftkultur scheint das Ohr wieder an Bedeutung zu gewinnen. |
||||
"Elektroakustische Gemeinschaft" | ||||
Fest steht, die Klangumgebung des modernen Menschen hat sich angesichts der medientechnologischen Entwicklungen des 19. und 20. Jahrhunderts massiv verändert. Die 'Aufzeichnungsgeschichte des Akustischen', die mit Thomas Alva Edisons Prototyp-Phonographen von 1877 ihren Lauf nahm, und die Erfindung des Lautsprechers 1899, dessen politische und kulturelle Bedeutung Karl-Heinz Göttert in seiner Geschichte der Stimme (1998) fabelhaft nachskizziert, sind nur zwei einer Reihe von medientechnologischen Wegmarken, die die Raum-Zeit-Erfahrungen der jungen Industriegesellschaft prägen sollten. |
||||
Barry Truax, Komponist und Professor für akustische Kommunikation an der kanadischen Simon Fraser University, prägte hierfür und insbesondere für zeitgenössische Kulturen den Begriff der "elektroakustischen Gemeinschaft". Das umfangreiche Ensemble elektroakustischer Kommunikationsmöglichkeiten formt nicht nur unsere akustische Umwelt, sondern ebenso die "individuelle Praxis des Zuhörens und das damit verbundene soziale Verhalten", so Truax in seinem Beitrag zum Symposium "Ganz Ohr", das im September 1997 auf der documenta X den Startschuß für die Stiftung Zuhören am Hessischen Rundfunk gab. |
||||
Wahrnehmung und Kommunikation in unserer Gesellschaft sind damit elementar etwa von den Verstärkerleistungen eines Radios abhängig, von der rauschfreien Wiedergabe der Stimme des Gesprächspartners am Telephon oder von funktionierenden Mikrophonen an Rednerpulten. Mit der Multimediamaschine Computer ist dieser elektroakustischen Gemeinschaft zudem ein Universalwerkzeug an die Hand gegeben, das das Radio dank Streaming-Technologie und MP3-Dateien neu erfindet, Sender zu Empfängern und Empfänger zu Sendern werden läßt -- und nebenbei die Musikindustrie vor große Herausforderungen stellt. |
||||
Die Auswirkungen der elektronischen Medien auf die Sinnesorganisation sind das Thema bei Marshall McLuhan (1911--1980), der das "Ende der Gutenberg-Galaxis" beschwor und den abendländischen Menschen aus seinem "typographischen Trancezustand" massierend erwecken wollte. Auch sein Schüler, der Literaturwissenschaftler und Oralitätsforscher Walter J. Ong (1912-2003), der 1982 mit Oralität und Literalität eine Standardreferenz der zeitgenössischen Medientheorie vorlegte, bezeichnet die gegenwärtige Epoche als "neues Zeitalter sekundärer Oralität", denn mit dem Telephon, dem Radio, dem Fernseher und den verschiedenen Klangaufzeichnungsgeräten werde ein wirkliches Publikum geschaffen, wohingegen das Lesen eines geschriebenen oder gedruckten Textes die Individuen auf sich selbst zurückwerfe. Ong hebt damit die Gemeinschaft konstituierende Aufgabe der akustischen und audiovisuellen Medien hervor, die der mündlichen Verständigung in nicht-schriftbezogenen, primär-oralen Kulturen entspreche. |
||||
Protagonistische Skeptiker des Visuellen | ||||
Gleichzeitig sind die genannten Autoren protagonistische Skeptiker des 'Visualprimats' aus den philosophisch, sozial- und kulturwissenschaftlich orientierten Stimmenlagern, zu denen etwa auch die deutschen Sozialphilosophen Ulrich Sonnemann (*1912) oder Eugen Rosenstock-Huessy (1888-1973) gezählt werden können. Letzterer forderte gar den Einschlag einer "Hörwegwissenschaft". |
||||
Marshall McLuhan aber machte wohl am eindringlichsten in medientheoretisch-medienanthropologischer Hinsicht auf das hörkulturelle Defizit des abendländischen Menschen aufmerksam und verspricht ihm im "audio-taktilen Raum" eine neue Heimat und ganzheitliche Orientierung. In The Global Village (1989), ein posthum mit dem Ko-Autor Bruce R. Powers veröffentlichtes Destillat seines Denkens, prophezeite er: "Die sich gegenwärtig vollziehende Wende der Technologien des visuellen zu denen des akustischen Raums in unserer Gesellschaft beschleunigt sich beständig." |
||||
Daß mit einer Aufwertung des Gehörsinns auch kulturpessimistische Stimmen laut werden, liegt auf der Hand. Der Appell des Kanadiers Murray Schafer für eine klangökologische Aufmerksamkeit angesichts der Problematik der Lärmverschmutzung und der Vernachlässigung der Kernkompetenz Hören in modernen Gesellschaften ist nicht zuletzt eine Klage über das Schwinden von Natur- oder 'historischen' Geräuschen. Gießener Hörforscher wollen zwar mittlerweile herausgefunden haben, daß Zivilisationslärm das Hörvermögen besser trainiert als die Abgeschiedenheit in naturbelassener Einsamkeit, der 'Verlust' von Klängen, die sich in die Zeit eingeschrieben haben, ist jedoch nicht zu relativieren: sei es das Knarren der Kutschen, Hufgeklapper, eine mechanische Schreibmaschine, die die Häuserschluchten des Studentenviertels beschallt, das Plätschern eines Dorfbaches oder Kirchturmglocken -- akustische Ereignisse werden zu auditiven Erinnerungen, sie gehen verloren oder werden immer seltener gehört. Oder sie werden als Balsam für unsere Ohren und unsere Retrosehnsüchte kopiert: Old Phone ist derzeit wohl der beliebteste Handy-Klingelton. |
||||
Soundscape und akustische Ökologie | ||||
Schafer, dessen Hauptwerk The Tuning of the World von 1977 knapp zehn Jahre später unter dem Titel Klang und Krach in der deutschen Übersetzung vorlag, legte mit seinen anfangs künstlerischen und musikdidaktischen Arbeiten den Grundstein für die interdisziplinären Soundscape Studies, in denen die Beziehung zwischen Mensch und akustischer Umwelt ästhetisch (Soundscape-Komposition) und wissenschaftlich ausgelotet werden. Schafer, beeinflußt von McLuhan und Edmund Carpenter, startete somit erstmals den Versuch, diese Beziehung in ein analytisches Muster zu übertragen und mit seiner Idee der "Lautsphärenforschung" und des "Akustikdesigns" anwendungsbezogene Forschung zu betreiben. |
||||
An der Simon Fraser University in Vancouver untersuchte er seit Anfang der 70er Jahre den Einfluß von Klängen auf das menschliche Verhalten, wie etwa Alltagsklänge bestimmte Milieus oder Gruppen an ihre Traditionen binden und wie sich sozialer und kultureller Wandel in ihnen widerspiegelt: Seien es Kirchturmglocken oder Fabriksirenen, der Klang bestimmter Stadtviertel oder die Geräuschkulisse eines Hafens. Mit dem Forschungsunternehmen World Soundscape Project (WSP) dem auch Barry Truax angehörte, prägte er den Begriff der Soundscape, ein Kunstwort aus sound und landscape, das im Deutschen mit Klanglandschaft oder Klangumgebung übersetzt wird. |
||||
Seit 1993 schafft das internationale Netzwerk World Forum for Acoustic Ecology (WFAE) Aufmerksamkeit für die Soundscape-Forschung. Im deutschsprachigen Raum sind es vor allem der Schweizer Klanggeograph und Gründer des Forums Klanglandschaft Justin Winkler sowie der Klangdesigner und Radioproduzent Hans U. Werner, die den Begriff der Klanglandschaft in kultur- und sozialwissenschaftlichen Kontexten behandeln bzw. ihrerseits klangökologisch orientierte Forschungen betreiben. |
||||
Die wohl bekannteste Publikation der frühen Soundscape-Forscher ist die Aufnahme The Vancouver Soundscape von 1973. Gut 25 Jahre später gab es eine neue Auflage dieser seither in zahlreichen Radiofeatures verwendeten 'kartographisierten' Klanglandschaft der kanadischen Metropole. Maßgeblich an der Neuauflage beteiligt war auch die Soundscape-Komponistin Hildegard Westerkamp. Die Grenzen zwischen Wissenschaft und Kunst sind noch heute fließend. |
||||
Soundscape-Forschung ist als transdisziplinäre Veranstaltung zu verstehen. In ihr verschmelzen kritische Geräuschumwelt-Analyse, eine Pädagogik des Hörsinns sowie der "gesellschaftliche Diskurs und [die] Interpretation klanglicher Lebenswelten, die durch Soundscape-Komposition und als Akustik Design in den Alltag des Ohres zurückwirken" (Hans U. Werner). |
||||
Mit dem Handbook for Acoustic Ecology (1978) wurden die Erkenntnisse und Methoden der Soundscape einem breiten akademischen Publikum zugänglich gemacht. Das Wiederaufleben der geisteswissenschaftlichen Debatte über die sinnliche Erkenntnis und der Wiederentdeckung des Hörens als Trendthema der 80er und 90er Jahre hat klangökologische Konzepte verbreitet -- in der akustischen Kunst, der Pädagogik, in Architektur und Stadtplanung oder in der Musikethnologie. |
||||
Die Attraktivität des Begriffs 'Soundscape' spiegelt sich auch in der künstlerischen, publizistischen und konsumweltlichen 'Instrumentalisierung' desselben wider. Zu erwähnen ist hier unter anderem das niederländische Online-Magazin für Medienkultur soundscapes.info, die audiokünstlerische Arbeit Soundscape von Peter Rösel oder die im Frühsommer 2003 in Neu-Isenburg bei Frankfurt durchgeführte Hifi-Geräte-Messe "High End", die unter dem Motto "Klanglandschaften" stattfand. Über Google erhält man zum Begriff 'Soundscape' mittlerweile rund 220.000 Einträge. |
||||
Die interdisziplinäre Grundausrichtung der "akustischen Ökologie" hat zudem eine Vielzahl von Folge-Unternehmungen hervorgebracht, die sich zwar dezidiert auf die von Schafer geprägte klassische Klangökologie beziehen, jedoch andere Schwerpunkte setzen. In Nordamerika und Europa betrifft dies vor allem den Bereich der Bioacoustics sowie die Ästhetik der Environmental Sound- und Soundscape Art-Produktion. |
||||
Mit der Verbreitung des Internet haben sich zahlreiche Soundscape-Interessierte vernetzen können, bzw. sie bedienen sich der elektronischen Verbreitungswege, um in Schrift, Bild und Ton die Thematik in breiten gesellschaftlichen Feldern zu plazieren und -- gewiß auch das -- in Form von CDs zu vermarkten. Beispielhaft sei das New home of Acoustic Activism, writings, and soundscape links AcousticEcology.org genannt, das aus der kommerziellen Sound-Art-Plattform Earth Ear hervorging und die Belange der Akustikökologie bündelt. Die mit sound activism und sound science mehr populär als wissenschaftlich konnotierten Schlagwörter dieser Web-Plattformen drücken zweifelsohne das gestiegene Interesse an Auditivität und akustischen Phänomenbereichen im ausgehenden 20. und beginnenden 21. Jahrhundert aus. Ein Interesse, das nicht unwesentlich das hier verfolgte Argument der 'Neuen Aufmerksamkeit' mit Fakten untermauert und die Existenz von neuen 'Hör-Kulturen' offensichtlich hervortreten läßt. |
||||
Geistes- und philosophiegeschichtliche Grundlagen der 'Neuen Aufmerksamkeit' | ||||
Geistesgeschichtlich ist der Fokus auf die spezifische Erkenntnisleistung und kulturelle Einbettung der menschlichen Sinne kein neuer Diskurs. Die Hierarchie der Sinne wurde schon mit Platons berühmtem Höhlengleichnis zugunsten des Visuellen festgelegt. Die Bedeutung des Auges als Erkenntnisorgan und des Visuellen als Informationsträger, das heißt, die abendländische Ausrichtung des Denkens auf das Sichtbare als platonisches Erbe wurde seit der Renaissance und ihrer medientechnischen Errungenschaften (Buchdruck, perspektivische Malerei etc.) wie ihrer philosophischen Orientierung (Neoplatonismus) potenziert und im Zuge der Aufklärung (Lumières!) gleichsam radikalisiert. Die Folge: Neben der Aufwertung der vermeintlich 'niederen Sinne', dem Geschmacks-, Tast- und Geruchsempfinden, standen vor allem die Rivalität von Auge und Ohr im Mittelpunkt einer, wie es der Kulturwissenschaftler Hartmut Böhme ausdrückt, "sensualistischen Tradition, die im 18. Jahrhundert im Zusammenspiel von Ästhetik und Anthropologie die überkommene Hierarchie der Sinne überprüfte und revidierte". Die Sinnes-Kontroverse über den Beitrag der Sinne beim Gewinn menschlicher Erkenntnis wurde somit zum Topos der philosophischen Auseinandersetzung des 18. Jahrhunderts, dem "Zeitalter der Empfindsamkeit", wie es Robert Jütte in seiner Geschichte der Sinne (2000) formuliert. |
||||
In den daraus hervorgehenden sensualistischen Wahrnehmungstheorien kristallisierte sich also eine Fundamentalopposition heraus: jene zwischen Auge und Ohr. Und es oblag Johann Gottfried Herder (1744--1803) eine Lanze für das Hören zu brechen und gleichsam zum Urvater der 'Neuen Aufmerksamkeit' der Gegenwart zu werden. |
||||
Er stellt in seiner Sprachtheorie paradigmatisch das Ohr, "den ersten Lehrmeister der Sprache", als gleichberechtigtes Erkenntnisorgan neben das Auge. Jürgen Trabant, Sprachwissenschaftler an der Freien Universität Berlin, begreift die Wiederentdeckung des Ohres durch Herder als "philosophische Wende", da sie "der entscheidende Schritt von einer traditionell okularen, visuellen (und solipsistischen) Erkenntnistheorie zu einer aurikalen und auditiven -- akroamatischen --, schließlich sprachlich-dialogischen Erkenntnistheorie" sei. |
||||
Zwar hat diese von Herder gelieferte Erkenntnistheorie angesichts (sic!) der Dominanz der Hegelschen Dialektik wenig Einfluß auf die gesamte Philosophie der folgenden Jahrhunderte, dennoch ist Herders "akroamatische Anthropologie" (Jürgen Trabant) wegweisend für alle Theoretiker, die sich dem Phänomen Hören nähern. Denn das Herdersche Ohr, so Trabant, richte sich auf die Welt. Es höre die Welt und nicht nur den anderen Menschen. Und es schaffe aus dieser akroamatischen (von gr. akroatés: Hörer) Begegnung mit der Welt die Sprache, also das Denken. Das Ohr, traditionell als kommunikatives, soziales und ethisches Sinnesorgan angesehen, wird bei Herder zusätzlich "ein welterschließendes, erkennendes, kognitives Organ", so Trabant in seinem Beitrag in der Internationalen Zeitschrift für Historische Anthropologie Paragrana, deren Ausgabe "Das Ohr als Erkenntnisorgan" von 1993 eine Initialzündung für nicht wenige Kulturwissenschaftler und Philosophen war, sich inhaltlich und konzeptionell mit dem Hören zu beschäftigen. |
||||
Die Verschränkung von Anthropologie und Ästhetik arbeitete der theoretischen Aufwertung der Sinnlichkeit im 18. Jahrhundert zu. In der Rhetorik vom Ende des visuellen Zeitalters hallt dieser Impetus in der Gegenwart -- zum Teil modernitätskritisch -- wider. Gar erfährt er im Zuge des 'cultural turn' innerhalb der Kulturwissenschaften eine Neuauflage. Davon zeugen mitunter die 'Sinnes-Orientierungen' einer Anthropologie der Musik, des Zuhörens, des Körpers und selbstverständlich einer Anthropologie bzw. Ethnologie der Sinne. Diese sind wenn nicht explizit, so doch implizit gegen das cartesianische Modell der Trennung von Körper und Geist, gegen das "Cartesian commitment" (Michael Herzfeld) gerichtet und damit für eine Enthierarchisierung der Sinne und für eine Enthierarchisierung der wissenschaftlichen Erkenntnismethode. Denn, wie die Sinnesethnologin Constance Classen treffend sagt: "Sight is the sense of science." Wissenschaft und Philosophie kommen ohne das lesende Auge nicht voran, vernachlässigen auf der anderen Seite jedoch die auditiven und akustischen Dimensionen von Sprache, Kommunikation, Umweltorientierung, Verhaltenspraxen oder -- ganz allgemein -- von Kultur. |
||||
Nach Herder sind es vor allem die Vertreter der jüngeren Gegenwartsphilosophie Ludwig Wittgenstein und Martin Heidegger, die auf das visuelle Erkenntnis-Paradigma im Rahmen sprachphilosophischer Gedankengebäude mit einem Gegenentwurf reagieren. Beide äußern in der Kritik am 'Visualprimat' ein Plädoyer für das Hören. Der Philosoph Wolfgang Welsch sagt in der oben erwähnten Ausgabe der Zeitschrift Paragrana, "der Übergang von der Bewußtseinsphilosophie zum Paradigma der Kommunikation" bedeute immer auch einen "Übergang von der traditionellen Favorisierung des Sehens zu einer neuen Betonung des Hörens." |
||||
Auf die etymologische wie kultur- und religionsgeschichtlich nachweisbare Verwandtschaft zwischen Hören und Gehorsamkeit muß nicht näher hingewiesen werden. Nur soviel: Welsch diagnostiziert gerade in Heideggers "Plädoyer für ein Hören auf das Sein" eine gefährliche Nachbarschaft "mit dem Aufruf zum Hören auf den Führer". |
||||
Die 'Neue Aufmerksamkeit', die von seiten der kulturwissenschaftlichen Disziplinen besonders im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts dem Ohr, dem Hören und dem akustischen Raum entgegengebracht wird, bindet an die oben kurz skizzierten geistes- und philosophiegeschichtlichen Grundlagen. Sie lässt sich zudem als Reaktion auf die vermeintlich fortschreitende "Regression des Hörens" (Robert Jütte) und die Dominanz der Visualität betrachten, die schon Georg Simmel (1858--1918) in seinem Exkurs über die Soziologie der Sinne (1908) in der Begrenzung zwischenmenschlicher, sprachlicher Kommunikation von Mund zu Ohr im städtischen Raum und Leben diagnostizierte. Der Verkehr der Großstadt, so Simmel in diesem Essay, |
||||
"zeigt ein unermeßliches Übergewicht des Sehens über das Hören Andrer. [...] Vor der Ausbildung der Omnibusse, Eisenbahnen und Straßenbahnen im 19. Jahrhundert waren Menschen überhaupt nicht in der Lage, sich minuten- bis stundenlang gegenseitig anblicken zu können oder zu müssen, ohne miteinander zu sprechen". |
||||
"Die Welt ist Klang" | ||||
Bezeichnenderweise aber war es ein "Popular-Philosoph", ein Denker, dem die Nähe zur Esoterik nicht abgesprochen werden kann, der aber auch als einer der einflußreichsten Jazz-Kenner im deutschsprachigen Raum angesehen wird, der das Hören und das Ohr auf die Tagesordnung disziplinen- und genreübergreifender Auseinandersetzung hob. In seinem paradigmatischen Buch Nada Brahma. Die Welt ist Klang (1983) schreibt Joachim-Ernst Berendt: |
||||
"Der Neue Mensch wird ein hörender Mensch sein -- oder er wird nicht sein. Er wird in einem Maße Klänge wahrnehmen, von dem wir uns heute noch keine Vorstellung machen können. [...] Die tiefere Veränderung unseres Bewußtseins [...] wird dadurch ausgelöst, daß wir uns endlich das Ohr und das Hören in dem Maße erschließen, in dem das Auge und das Sehen ohnehin in unserer Kultur erschlossen sind." |
||||
Berendts vielstimmige Ausführungen von der Kosmologie und Klangphysik über Paläolinguistik bis hin zur fernöstlichen Philosophie sind einflußreiche Publikationen. Zwar werden sie zuweilen als musikontologische Spekulationen oder "neu-metaphysische Theoriekompositionen" (Peter Sloterdijk) abgetan, dennoch gelten sie als Initialzündungen im Grenzbereich zwischen Wissenschaft und Esoterik, die auf eine Psychologie und Phänomenologie des Hörens aufmerksam machen und damit ein breites Publikum erreichen. Das bereits erwähnte Nada Brahma. Die Welt ist Klang und Das Dritte Ohr. Vom Hören der Welt (1985) finden nicht nur unter der New-Age-Bewegung Leser und Hörer -- die Publikationen wurden auch als Musikkassetten- und CD-Produktionen veröffentlicht, gar gingen ihnen Radioproduktionen voraus --, sondern Berendts Bemühungen im Rahmen internationaler Vortragstourneen und Seminarveranstaltungen fielen ebenso in den Zwischengebieten von Philosophie, Kultur- und Musikwissenschaft auf fruchtbaren Boden. |
||||
So greift beispielsweise der Ethnomusikologe Max Peter Baumann in der bereits erwähnten Zeitschrift Paragrana Berendts bei Nietzsche entlehnte Metapher des "dritten Ohres" auf oder fehlen keine kritischen wie ergänzenden Hinweise auf Berendt bei dem Philosophen Wolfgang Welsch. Selbst empirische, klangökologisch orientierte Arbeiten lassen die musikontologischen und gewiß esoterisch angehauchten Gedanken von Berendt nicht außen vor. Auch die Medienpädagogin Jutta Wermke verknüpft Berendts "historisch-weltanschauliche Fragestellung" mit ihrem Entwurf einer Hörästhetik. |
||||
"Die Welt ist Klang" -- nach der Übersetzung von 'nada brahma', einem Mantra der klassischen indischen Musik --, diese Metapher ist trotz aller Kritik der Slogan im Vordergrund jener aufkeimenden Stimmung, die die Vorherrschaft des Sehens in der Moderne bröckeln sieht oder gar zur Emanzipation des Gehörs aufruft. Die bedeutungsmächtigen Formulierungen verschiedenster Autoren beweisen, mit welcher Durchschlagskraft Berendts Publikationen einen nachhaltigen und nachhallenden Diskurs zur Auditivität beförderten. |
||||
Medienpädagogische Offensiven und radiophone Landschaften im Netz | ||||
Zahlreiche Fördervereine, Organisationen, Stiftungen, Netzwerke und Initiativen sorgen seit Beginn der 90er Jahre für ein erstarkendes gesellschaftliches Interesse an der Thematik Hören und Zuhören. Sie sind nicht zuletzt die institutionellen Plattformen medienpädagogischer Offensiven gegen den Verlust von Hör-Kompetenz. Zu nennen sind etwa die eingangs erwähnte Stiftung Zuhören und die bundesweite Initiative Hören, die sich der Medien- und Sinneskompetenzvermittlung verpflichtet fühlen. Auf internationaler Ebene agiert bereits seit 1979 die International Listening Association (ILA). Sie fördert den interdisziplinären Austausch über den Themenkomplex 'Zuhören' und versteht sich als Kompetenz-Netzwerk. |
||||
Derartige Unternehmungen -- mögen sie medizinischen, pädagogischen, künstlerischen, medien- oder kulturwissenschaftlichen Hintergrund haben -- sind einerseits als institutionelle Antwort auf den Bedeutungszuwachs des Auditiven zu verstehen und fungieren andererseits selbst als Multiplikatoren einer neuen Aufmerksamkeit für das Ohr. |
||||
Im Zuge der medientechnologischen Entwicklungen auf dem Gebiet der digitalen Aufnahme-, Produktions- und Distributionstechnik, die die Handhabung von Sound jenseits professioneller Studios und Institutionen für breite Bevölkerungsschichten möglich machen, rücken zudem Webradio, interaktives Radio und interaktives Hörspiel sowie der kreative Umgang mit Tonmaterial in den Mittelpunkt medienpädagogischen Interesses. Gewiß werden medienpädagogische Konzepte zur Aneignung von Hörwelten nicht erst mit der Einführung der digitalen Medientechnologien angewandt: praktische Medienarbeit im allgemeinen ist ein zentraler Aufgabenbereich der Medienpädagogik. Im 'analogen' Zeitalter gestaltete sich diese Arbeit, sieht man auf die technischen Möglichkeiten, jedoch viel schwieriger. |
||||
Auch durch die fließenden Systemgrenzen der Einzelmedien Presse, Hörfunk und Fernsehen im Rahmen der durch die Internetentwicklung hervorgebrachten Medienkonvergenz-Phänomene kommt dem Hören eine wachsende Bedeutung zu. Die Integration von (Bewegt-)Bild, Text und Ton auf den Internet-Plattformen der Medienanbieter macht Zeitungsleser zu Zeitungshörern, Radiohörer zu surfenden und streamenden Cyberflaneuren oder gar selbst zu Senderempfängern, da die Potentiale der netzbasierten Kommunikation mit zunehmender Leistungskapazität der Verbraucher-PCs und steigender Medienkompetenz neue Aneignungsstrategien hervorrufen. |
||||
Im Bereich der Kunst wurden diese Potentiale natürlich längst entdeckt. Vor allem Audio-Künstler, experimentelle Medienschaffende und ambitionierte Radioautoren klopfen die Netzwerktechnologien auf ihre Möglichkeiten hinsichtlich Interaktion, Partizipation und Interaktivität ab. Von "Audiovisionen im Netzzeitalter" spricht in diesem Zusammenhang Sabine Breitsameter, die unter anderem den AudioHyperspace des Südwestrundfunk betreut, eine empfehlenswerte Plattform mit Informationen zur "akustischen Kunst in Netzwerken und Datenräumen". |
||||
Schreibende Betriebstaubheit und das große Ohr der Alltagshörer | ||||
Die Debatten über das Hören, den Sound und das Auditive -- von McLuhans medientheoretisch formulierter Metapher des 'akustischen Raums' über Berendts Musikontologie bis hin zu philosophischen, phänomenologischen oder ethnologischen Perspektiven auf die auditive Sinneswahrnehmung und akustische Formationen -- verlaufen zum großen Teil in Bahnen akademischer Textproduktion, die sich, wie auch der vorliegende Text, in rückbezüglicher 'Betriebsblindheit' oder besser: 'Betriebstaubheit' äußert. |
||||
Über das Hören zu schreiben, ist eine unauflösbare Zwangssituation, die nicht zuletzt die Sprachphilosophie und Philologie in einen Diskurs verstrickt hat, der über zwei Jahrhunderte, von der sensualistischen Auseinandersetzung des 18. Jahrhunderts bis zum 'linguistic turn' in den Kultur- und Geisteswissenschaften des letzten Drittels des 20. Jahrhundert fortwirkte. |
||||
Der Hörende selbst erschließt sich stetig neue Sinneserfahrungen und er macht sich als Mitglied der elektroakustischen Gemeinschaft zunehmend in einem kreativen Umgang mit Technik und -- im Sinne des Handlungstheoretikers Michel de Certeau -- 'taktisch' die Speicher- und Distributionsmedien der Unterhaltungsindustrie und Phonobranche zu eigen. Internet-Tauschbörsen, Online-Tonarchive, das Editieren von digital gespeicherten Klängen, das Streaming von Internetradio aus aller Welt oder das Brennen von CDs sind nur einige wenige Beispiele für einen, um nochmals mit de Certeau zu sprechen, 'listenreichen Konsum' von Hörbarem. Von Napsterianern bis zu esoterischen Tonbandstimmenforschern -- die Entwicklung von Hör-Kulturen basiert auf medialen Grundlagen. |
||||
Bald wird der Hörende neue Dimensionen der Sinneserfahrung erobern, wenn olfaktorische, also die Nase ansprechende Duftdateien durch das Internet geschickt werden. Riechkinos gibt es mittlerweile. Die Philosophie und Kulturwissenschaft? Sie harrt derweil in Lauerstellung, denn die nächste Aufmerksamkeit kommt bestimmt: Hörst du noch oder riechst du schon? |
||||
|
autoreninfo

Andreas Haderlein studierte Kulturanthropologie/Europäische Ethnologie, Soziologie und Kunstgeschichte. Er lebt und arbeitet als freier Journalist und Musiker in Frankfurt am Main. Auf der Webplattform www.hybridsuite.de/text finden sich weitere Texte des Autors, die sich mit Auditivität und Hör-Kulturen beschäftigen.
E-Mail: haderlein@gmx.net |
||||
|
|