Friederike Mayröcker: Mein Arbeitstirol
GEBIRGE IM KRANKENHAUS
für Ernst Jandl
in den Augen das Blau
aber es regnet so viel
und die Speise schling ich hinunter
dieses Blau in den Augen
aber es regnet so viel
allein in der Kammer
so allein in der Kammer so getrent von der Liebe
so allein in der Welt : kein Geschmack an der Stille
aber der Phlox in den Gärten
weht in der Nacht
Inhalt
Friederike Mayröcker hat für diesen Band neue Gedichte aus den letzten Jahren zusammengestellt. So entsteht eine Art lyrisches Tagebuch, ein Bilder-Buch der Dichterin mit dem „euphorischen Auge“. Oft sind es kleinste Anlässe, Anemonen auf einer Wiese, Schnee vor dem Fenster, das Gedicht (oder Bild) eines Kollegen, die in Friederike Mayröcker ein Sprechen provozieren, in dem sie ins Grenzenlose ausschreitet, sich die Welt verwandelt in die eigenen Worte und die eigenen Findungen in die Welt, „beim Gedichteschreiben ganz eingesponnen in das Heilige in das Wohlwollende, Sprengfreude in mir“.
Suhrkamp Verlag, Ankündigung
Ein herzzerreissend poetisches Larifari
Seit einem halben Jahrhundert knüpft Friederike Mayröcker an einem magischen Sprachteppich, an dem jede neue Masche ebenso kunstvoll wie zufällig aussieht. Wer dieser Autorin vorwirft, sie gehe zu willkürlich um mit ihrem Garn, sollte sich nach den Gründen für die Sogwirkung fragen, die seit Jahrzehnten von ihren Texten ausgeht. Zwar zieht sie nicht gerade die Massen an, aber doch eine ansehnliche Schar von hellhörig Lesenden. Ihren ersten Prosaband nannte sie mit listigem Understatement Larifari (1956), ihre letzte Gedichtsammlung hiess sibyllinisch Notizen auf einem Kamel (1996). Das neueste Buch trägt den schönen und wohl unerklärlichen Titel Mein Arbeitstirol, enthält Lyrik aus den letzten Jahren und überrascht nur angesichts des Alters der Autorin, denn ihre grandiosen Gedankensprünge und Wortschöpfungen sind zappelfrisch wie eh und je.
Kunst der Assoziation
Vor zwanzig Jahren, als Friederike Mayröcker noch gar nicht so alt war, schrieb sie in der halluzinatorischen Prosa des Bandes Reise durch die Nacht von ihrer Vermutung oder Hoffnung, „dass die Assoziationskraft mit zunehmendem Alter eher zu- als abnimmt“. Jetzt, mit bald 80 Jahren, hat sie das wieder einmal bestätigt. Denn eines der Wunder von Mayröckers Poesie liegt in der Kunst der Assoziation, durch die sie der Sprache Verblüffendes entlockt, was den Leser zwar verstören, aber ihm seinerseits auf assoziative Sprünge helfen kann. Ein weiteres Mirakel ist ihr beharrlich weltabgewandtes Wandeln in einem privaten Zettelhain, jetzt genauso wie schon in den Jahrzehnten der allgemeinen ideologischen Schaustellerei. Doch bei aller Freiheit von Ideologie ist in ihren Gedichten erstaunlich viel von der Wirklichkeit die Rede, vom häuslichen Alltag in ihrem „Elendsquartier“, vom Hier und Jetzt der körperlichen Hinfälligkeit, freilich nie vom letzten Schrei der Weltgeschichte.
Auch Mayröckers neueste Gedichte haben eine ganz eigene intime Verbindung mit der Welt. In ihren versponnenen Kopfspielen holt sich die Autorin allerlei Kunstsparten und Dichterkollegen in ihre legendäre Wiener Wohnung, eine papierene Schreibhöhle von rigorosem Chaos (in einer Sondernummer der Zeitschrift Wespennest 1999 bestens dokumentiert). Der Dadaismus und Beckett sind oft bei ihr zu Gast, noch häufiger Hölderlin und der Surrealismus. Aber auch mit jungen Poeten hält sie zitierend Zwiesprache, mit Thomas Kling, Franz Josef Czernin, Raoul Schrott, als „grüne Lichtburschen“ sind vielleicht auch sie gemeint. Auf diese Weise ist auch ihre Dichtung welthaltig, Raum und Zeit haben eine präzise Rolle (die Entstehung der einzelnen Gedichte zwischen 1996 und 2001 ist genau datiert). Malerei und Literatur aus allen Weltgegenden sind ständig präsent. Und immer wieder bringt sie die eigene Intimität ins Spiel der Worte. Doch keine Spur von den sogenannten grossen Ereignissen, kein Hauch von Politik aus diesen aufgeregten österreichischen Jahren, nicht einmal ein direkter Hinweis auf den Büchner-Preis, den Friederike Mayröcker im Oktober 2001 spät, aber doch bekommen hat.
In fabelhafter Distanz geht auch der September 2001 in ihr vorbei: Am 8. schreibt sie das Gedicht „Luftseele undsoweiter“, das mit einem „Mund“ und einem „Mond“ beginnt und mit „Päonien“ endet. Zehn Tage später, eine Woche nach den Attentaten in Amerika, schreibt sie „Aspekte der Malerei“, ein Gedicht von herrlich trostloser Hinterhofromantik:
und jeden Tag der Blumenstrauss
im Milchglasfenster vis-à-vis
ich ahne Tulpenrot in altem Blechgeschirr…
Vom selben Tag ist aber auch ein Gedicht ohne Titel, das anfangs so harmlos spricht über „diese weisslichen Büsche vom Fenster aus“, dann von der Freude „beim Gedichteschreiben“, schliesslich noch einmal von einem „Päonienfenster“, dann jedoch brüsk und kursiv endet: „… die / Welt zusammengebrochen.“ Um welche oder um wessen Welt es sich handelt, wird nicht gesagt. Solche Zurückhaltung ist in jedem Fall bewundernswert, besonders aber in jener Zeit kurz nach dem 11. September, als die schreibende Welt sich in eine Erklärungshysterie hineinsteigerte und alle Meinungsdämme brachen. Der wie üblich überraschende Abschluss dieses Gedichts zeigt abermals, dass Friederike Mayröckers Mitteilungsbedürfnis nicht von dieser Welt ist.
Ein ganz gravierend irdisches Ereignis ist jedoch deutlich in der Chronologie der Entstehung dieser Gedichte ersichtlich, allerdings durch eine Leerstelle: Nach dem Tod von Ernst Jandl im Juni 2000 ist eine Lücke von vier Monaten, jene Trauer- und Schreckenszeit, in der das separat veröffentlichte Requiem für Ernst Jandl (2001) entstand. Mayröcker und Jandl waren im Leben ein Paar und in der Kunst siamesische Zwillinge. Ihre Werke wären ohne den Zwilling nicht so geworden, wie sie sind. Er sagte, er wäre ohne sie verdammt gewesen „zum Kinderwagenschieben“ und zu einer mittelmässigen Existenz. Sie nannte ihn schon in früheren Texten ihren „Vorsager“ und ihren „Ohrenbeichtvater“. Sie hat ihn in alle ihre Bücher einbezogen. Hier aber, in dem neuen Band Mein Arbeitstirol, geht eine Schwellenlinie durch den Textkorpus, etwa in der Mitte des Buches. Sie teilt diese Gedichte in diesseits und jenseits von Jandls Tod.
Ewige Finsternis
Als Jandl im Sterben liegt, Anfang Juni 2000, schreibt Mayröcker: „ach ich KLEBE an diesem / Leben an diesem LEBENDGEDICHT“. Dann folgt die besagte Lücke von vier Monaten. Danach geistert „ER“ noch deutlicher als früher durch ihre Verse, entstehen noch mehr Gedichte in seinem Angedenken, wie diese private Erinnerung an ein Weltereignis:
SONNENFINSTERNIS ’99 / BAD ISCHL
für Ernst Jandl
erst wieder in 700 Jahren sagt ER
1 Jahrhundert Ereignis sagt ER
solltest du nicht versäumen sagt ER
auf dem Balkon ER setzt die Spezialbrille auf
verkrieche mich mit dem Hündchen in der Schreibtischnische
die Vögel verstummen –
1 Jahr danach SEINE ewige Finsternis
Nach dem grossen Verlust sind die Gedichte noch häufiger ausdrücklich ihm gewidmet, wie zur Demonstration, dass auch der Tod seine Grenzen hat. Die Widmungen waren immer schon ein eigentümlicher Aspekt in Mayröckers Lyrik. Sie dienen der Autorin zur Hervorhebung des Intimen, gleichzeitig aber auch zur Verbindung des lyrischen Subjekts mit der Aussenwelt, die mehr und mehr zu verschwimmen droht. So kam es im Lauf der Jahre zu einer wahren Widmungswut, die das Rätsel mancher Texte noch verschärfte, denn kaum jemand weiss, wer „Sara Barni“ ist. Es sollte den Leser nichts angehen, doch steht es auch für ihn da. Und so mag er rätseln, wer denn dieser „Hans Haider“ ist und was es auf sich hat mit dem „Univ. Prof. Herbert Zeman“. Solche Intimisierung kann rasch an befremdliche Kumpanei grenzen, so wie es auch nur ein kleiner Schritt ist vom poetisch Wunderbaren zum Wunderlichen. Aber im Fall von Ernst Jandl ist es um diese Zueignungen anders bestellt, weil er mit den Texten in jeder Hinsicht was zu tun hat. Manche Mayröcker-Gedichte hat er derart mit seiner erdbodenhaften Strenge beeinflusst, dass es auch ohne Widmung sichtbar ist:
WENN ICH VOR IHM GESTORBEN WÄRE
an zu weinen fing
der Mann Fink / an zu weinen
es wäre im Frühjahr gewesen während
alle Bäume jauchzten (Fink Amsel Fink)
er hätte geweint in seinem schönsten Kleide
an meinem Grabe und wäre mir nach
weil in die Tiefe zog es ihn
Um die letzten Dinge geht es in den besten Gedichten dieser Sammlung, um die Frage „wirst auferstehen je? werden / einander wiedersehen wir?“ Leider kennt sie seine Antwort. Ernst Jandl und Friederike Mayröcker haben die Rollen des mythischen Paars vertauscht: Orpheus ist vorausgegangen, hat nie an eine Wiederkehr, nicht im Geringsten ans Jenseits geglaubt. Eurydike weiss das, will es aber nicht glauben in ihrem herzzerreissenden Gesang.
Franz Haas, Neue Zürcher Zeitung, 26.6.2003
Zauber der Alltäglichkeit
Es ist ein zauberhaftes Buch der Mayröcker, beinahe überirdisch. Themen des Alltags, oft beinahe banale Dinge nimmt sie auf und verwandelt sie in Kunstwerke, mit wunderbaren Wortschöpfungen und verklärt durch Liebe und Weisheit. Die Gedichte sind chronologisch sortiert, so daß der Bruch nach dem Tode ihres großen Freundes Ernst Jandl deutlich wird. Es ist ein Bruch, der das Thema Abschied noch stärker betont. Mayröckers Kreativität und ihr sensibler Umgang mit der Sprache haben nicht gelitten. Lassen Sie sich anrühren vom „sterbenden Azaleenbäumchen in der Küche“, und vom vorerst letzten Gedicht für Ernst Jandl: „die Küsse auf dem Campingtisch“. Es lohnt.
Johannes Wöstemeyer, amazon.de, 17.7.2003
Filigrane Wortwebereien
Worte, so hintereinandergereiht, dass sie abhängig von der Verfassung des Lesers stark unterschiedliche Wirkungen erzielen, das ist Mayröckers Arbeitstirol. Da sind feinste Webearbeiten aus zarten Worten, die bei einem missgünstigen Blick, einer momentanen Aversion zur Bedeutungslosigkeit zerfallen können. Mit Reimen, mit Gedichten hat die Lyrik Mayröckers wenig zu tun, melodoisch ist sie dennoch, man muss nur genau hinhören. Die Gedichte sind neben Ernst Jandl verschiedenen Personen zugedacht, von denen ich einige im Verdacht habe, der Phantasie der Autorin entsprungen zu sein, sie sind ein Teil des Wortteppichs, auf dem sich der Leser räkeln kann. Mein Prädikat: ganz besonders wertvoll.
Till Seidler, amazon.de, 1.11.2003
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Dieter M. Gräf: Diese Fähigkeit, unerschöpflich neu wahrzunehmen
Basler Zeitung, 14. 3. 2003
Samuel Moser: Gnadenlose Wörtlichkeit
Der Standard, 3. 5. 2003
Franz Haas: Ein herzzerreissend poetisches Larifari
Neue Zürcher Zeitung, 26. 6. 2003
Nico Bleutge: Die kleinen Intervalle zwischen unseren Zungen
Süddeutsche Zeitung, 30.6.2003
Nico Bleutge: Bouquet aus Sprachen
Stuttgarter Zeitung, 8. 8. 2003
Rolf-Bernhard Essig: Ausgespuckte Tage
Die Zeit, 10. 7. 2003
Ulrich Weinzierl: Es scherbt der Knochen spinnenkraus
Die Welt, 26. 7. 2003
Michael Opitz: Das Staunen, das Vermissen
Neues Deutschland, 1. 8. 2003
Andreas Kohm: Die Welt in Sprache verwandeln
Mannheimer Morgen, 11. 8. 2003
Martin Reiterer: Friederike Mayröcker: „Mein Arbeitstirol“
Wespennest, Heft 132, 2003
Harald Hartung: Wie süß sind verständliche Worte
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 26. 11. 2003
Bildnisse von Dichtern – Friederike Mayröcker
Sie ist nie am blauen Nil gewesen, nie in hängenden Gärten spazierengegangen, jedenfalls hat man keine Spuren von ihr gefunden. Allerdings hinterläßt sie auch keine Spuren. In Paris aber war sie, das wissen wir. Sie war Platzanweiserin in einem Kino, mein Großvater, der damals einen Zylinder trug, hat sie gesehen. Sie trug ein kurzes, wippendes Röckchen und knickste, falls wir die krakelige Schrift meines Großvaters richtig entziffern. Sie sah sich das Programm durch den Spalt des Vorhangs an. Manchmal stieß sie kleine Schreckensschreie aus. Am besten gefiel ihr, daß der Klavierspieler so schön spielte. Sie sang dann leise mit. Mein Großvater kniff sie einmal in die Wange und sagte Charmant, très charmant, aber dann wurde doch nichts daraus. Später, als wir dann selber ins Kino durften, haben wir sie in einem Film gesehen, sie ritt zusammen mit Rodolfo Valentino auf einem Elefanten durch Indien und stürzte in eine mit Bambusstäben getarnte Falle. Der Film ist inzwischen unauffindbar. Sie wurde auf dem Sklavenmarkt verkauft. Man weiß nicht, was aus ihr geworden ist. Wir haben Hunderte von Stummfilmen angesehen und Tausende von Asienforschern befragt. Manche erinnern sich dunkel an ihre Stimme. Es gibt eine alte Platte von ihr. Man muß sie ganz laut abspielen, dann hört man ein fernes Zwitschern darauf. Es ist unendlich süß, ein großes Sehnen packt einen. Schnüffelnd steht man auf und gibt seinen trockenen Topfpflanzen Wasser. Auf der Plattenhülle sieht man sie, auf einem Foto, in weißen Kleidern in einer Hängematte liegend. Sie ist ganz jung, sie trinkt einen glühenden Kaffee und schaut in die Kamera. Jünglinge, die sonst nur Bilder von Sportlern sammeln, starren minutenlang auf das Bild, stumm. Wie die unbekannte Frau auf dem Bild machen sie mit der Hand eine Muschel und halten sie ans Ohr. Sie hören, durch eine ferne Brandung hindurch, einen Gesang, den sie aus einem sehr viel früheren Leben kennen, einem, in dem sie auf Mammuts sitzend durch Lianen ritten.
Urs Widmer, manuskripte, Heft 47/48, 1975
Wie man den Mainstream sabotiert
– Eine kurze Betrachtung zum langen Werk der Friederike Mayröcker. –
Vielleicht sollte ich damit beginnen zu beschreiben, wo ich meine Betrachtungen zu einer der überzeugtesten Verteidigerinnen des Glaubens an die Sprache unter den zeitgenössischen österreichischen Schriftstellerinnen und Schriftstellern verfasse. Der Ort heißt Gargellen, es ist ein alpines Dörfchen, im malerischen Montafon gelegen, der bergigen Landschaft am westlichen Rand von Mayröckers Land. Man würde nicht erwarten, sie hier anzutreffen, denn Mayröcker ist ein durch und durch urbaner Mensch, tief verwurzelt in Wien, selbst wenn sie mit dem Ursprung ihres Schreibens pastorale Erinnerungen verbindet. So saß sie als Sechsjährige einmal an einem Brunnen im niederösterreichischen Dorf Deinzendorf und spielte auf ihrer Harmonika; Mayröcker assoziiert diese ein wenig melancholische Szene, diese „Ur-Idylle“, wie sie es nennt, mit genau jener Stimmung, die seitdem ihr Schreiben beeinflusst.
Nein, das winterliche Gargellen wäre ganz und gar nicht Mayröckers Ort, mit seinen Brigaden von teuer ausgerüsteten Schifahrern, die einander wie Kühe beim Almauf- und -abtrieb folgen, ihre Montafoner Kartenschlüssel und elektronischen Tickets um den Hals tragend wie Symbole tonloser Kuhglocken, während sie auf dem Weg zur hyper-modernen Seilbahnstation sind, die die Schifahrer hinauf in den Tiefschnee-fun park und zu den Abfahrten auf einer alpinen Hochebene bringt, die den passenden Namen Schafsberg trägt.
Oder sind wir hier doch schon am Beginn eines Mayröckerschen Satzes angelangt, der durch seine reichhaltige Textur genau jenes tiefe Eingebundensein der Autorin in seine Umwelt zeigt? Mayröcker würde jedenfalls, wäre sie hier in Gargellen, über diese höchst absurde Form der Massenbewegung aus der Perspektive der Einzelgängerin schreiben, vielleicht einer Gehbehinderten, einer begeisterten Nicht-Schifahrerin, einer auf irgendeine bestimmte Art Verletzten oder einer Person, die mitten unter diesen Sportfanatikern mitspaziert, allerdings als Außenseiterin in langem schwarzem Mantel mit einem langen schwarzen Schal und einem schwarzen Umhängetäschchen, die französische Baskenmütze nicht zu vergessen.
Die zuvor angesprochene Machart der Texte Mayröckers erinnern die Leser an Stücke eines dichten Textilgewebes mit intrikaten Mustern, aber ohne eine Stickerei, die es einfasste; sie selbst verweist auf den Umstand, dass ihre Mutter handgeknüpfte Teppiche hergestellt habe. Während man diese Texte liest, ist man sich ihrer Stofflichkeit, ja materiellen Textur bewusst. Mayröckers Worte und Sätze wollen von den Augen und Händen der Leser berührt werden. Diese Autorin respektiert die Realität der Worte, ihre Präsenz und ihr Verlangen danach entweder autonom oder abwesend zu sein; sie illustriert den Prozess linguistischer Formationen und glaubt daran, dass Worte eine Eigendynamik entwickeln können. Anders als Ernst Jandl, mit dem sie den größten Teil ihres Lebens verbrachte, ist Mayröcker nie bereit gewesen die Verständlichkeit der Wörter zu opfern. Sie weigerte sich ein Wort aufzulösen und seine Klänge zu isolieren, wie es etwa in Jandls sogenannter ,Konkreter Poesie‘ der Fall war.
Immer wieder hat Mayröcker betont, dass sie nie versucht war die Grenzen der Sprache zu überschreiten; sie akzeptiert die Beschränkungen der Sprache, reizt aber jede noch so kleine Möglichkeit aus, die dieses Ausdrucksmedium ihr bietet. Ihre Originalität und ihre meisterhafte Verwendung des (indirekten) Zitats sind oft kommentiert worden. In ihren Texten finden wir zum Beispiel Baudelaire in der Mundhöhle; und mit Flaubert führt sie Notizen auf einem Kamel durch, aber nicht auf einer Reise durch Ägypten, sondern während einer Meditation über die Stadtwüste Wien.
Mayröcker verdankt der Romantik ebenso viel wie dem Surrealismus und dem Erbe der Wiener Gruppe mit ihrem Ethos und Pathos der ständigen, innerlichen Revolution. Sie scheint den Glauben an eine ihr mögliche Sabotage des Mainstream und eine Kreation der perfekten Verbindung von innersten Gefühlen und poetischem Ausdruck zu brauchen. Mayröcker hat erklärt, dass die sinnliche Wahrnehmung die Grundlage ihres Schreibens darstelle. Sie beschreibt sich selbst als einen „Augen- und Ohrenmenschen“, mit anderen Worten, als jemanden, die gänzlich von visuellen Bildern und auraler Wahrnehmung abhängig ist.
Gesprächshalber hat Mayröcker eingeräumt, in ihren Arbeiten jüngeren Datums versucht gewesen zu sein, „Mainstream zu machen“, aber ergänzt, dass dieses Ansinnen „immer wieder sabotiert“ werde „durch ganz winzige experimentelle Punkte und Einschübe“. Mayröcker verdeutlicht, dass es sich bei diesem Umgang mit Mainstream und dessen Sabotage für sie um ein prinzipielles poetologisches Phänomen handelt:
Es ist auch beim Gedichteschreiben nicht anders. Wenn ich anfange, an einem Gedicht zu arbeiten, dann erscheint mir das wie eine ganz gerade Linie. Und dann werden aber Punkte hingepfeffert. Ich begebe mich auf Abwege des Umbruchs und des Umschwungs. Das macht dann den Reiz des Gedichtes aus, das anfänglich als sehr verständlich erscheint. Wenn man es aber dann genauer anschaut, dann ist es in Wahrheit ganz anders.
Es scheint nicht verfehlt, diesen sabotierenden Ansatz als Merkmal im Schreiben der österreichischen Post-Avantgarde zu bezeichnen. Adam Kirsch etwa spricht vom „extravaganten Akt der Sabotage und Selbstsabotage“ in den Texten Thomas Bernhards. Verwandtes trifft für Peter Turrini zu. Im Sabotieren unterläuft der Text bestimmte Verstehenserwartungen, legt sich quer zum bloßen Textkonsum, versinnbildlicht etwa in Ilse Aichingers Erzählung „Der Querbalken“, über die Wolfgang Hildesheimer befand, dass in ihr die Frage Protagonistin sei. Und das scheint das Kriterium für sabotierendes Schreiben zu sein, nämlich die Ermächtigung der Frage, scheinbar konterkariert durch die von Mayröcker paradox behauptete „Askese der [sprachlichen] Maszlosigkeit“. Mayröcker sabotiert alle an die Literatur herangetragenen sinnstiftenden Erwartungen durch ein Verfahren, welches den Text immer wieder von neuem anfangen lässt. Beatrice von Matt spricht von Mayröckers vibrierenden Sprachkörpern, die aus „Wörtern mit glühenden Rändern“ bestehen.
„Es gibt einen Wunsch, zu erzählen, gleichzeitig aber auch den Wunsch, das Erzählen zu sabotieren. Ich bin keine Autofahrerin, aber wenn ich eine wäre, dann würde ich schlecht Auto fahren. Ich würde abwechselnd ganz rasch fahren und dann wieder ganz langsam, gab Mayröcker in besagtem Interview, ihrem poetologisch aufschlussreichsten, zu Protokoll. Beschleunigung und Entschleunigung als Mittel der Sabotage – in die Sprachzeichen Mayröckers umgesetzt schärft das den Blick auf den ,Sinn‘ ihrer Verwendung der Majuskel. Sie bremst das lesende Auge, zwingt zur Konzentration, bringt Wortmuster hervor und läßt das sprachliche Umfeld nur umso diffuser erscheinen. Diese Texte prägt eine mehr oder weniger diskrete „Hinterlist“ (Konstanze Fliedl).
Sucht man dagegen nach Spuren utopischen Denkens in diesen Texten, was in der heutigen Zeit für Intellektuelle und Künstler geradezu rufschädigend ist, so würde ich Mayröckers ungebrochenes Vertrauen in die Kraft der Sprache sowie in der beunruhigenden Qualität innerer Rebellion nennen, etwa gegenüber der Arroganz staatlicher Autorität, aber auch gegenüber der großen Leere, die das (post-)moderne Individuum prägt.
Man kann Mayröckers Texten ihre Suggestivkraft schwerlich absprechen; sie absorbieren einen, sind fast magisch zu nennen. Deswegen könnte auch der Titel Magische Blätter, der entfernt an Schumanns musikalische Sammlung Bunte Blätter erinnert, nicht passender sein. Nur schwer kann man sich dem sinnlichen Einfluss dieser Texte entziehen. Sie fesseln die Leser und lässt sie wünschen, den Texten wieder und immer wieder aufs Neue begegnen zu können. So erging es auch mir, als ich zum ersten Mal Mayröckers Prosasammlung Das Herzzerreißende der Dinge, veröffentlicht 1985, las. Diese Texte waren im Protest gegen die Erkenntnis geschrieben worden, dass der Mensch in der modernen Zeit zunehmend überflüssig geworden sei. Die Autorin dieser Texte weiß genau, dass ihre Schreibtisch-Anstrengungen vergeblich sind, doch ist es gerade dieser Sinn für das Vergebliche, der sie antreibt und dazu inspiriert, dagegen mit Goya, Dali und Canetti als ihren virtuellen Mitstreitern anzugehen. In diesen Texten beschreibt sie Wien als einen Ort, der sowohl von einem Ansturm der Melodien, der „Wahnsinns Musik“, wie Mayröcker es nennt, als auch von hartnäckigem Durchzug tyrannisiert wird. Doch dann ist da das Wort „Capriccio“, das sie fasziniert; sie spricht darüber im Zusammenhang mit ihrem „unermüdlichen Dialog mit Sprache“, der sie dazu bringt alle anderen Formen künstlerischen Ausdrucks, wie Musik und die Bildende Kunst, auszuschöpfen, um sie, wie alles andere auch, in poetische Narrative umzuwandeln. Das heißt nichts weniger, als dass ein Musikstück oder ein Bild für Mayröcker allein der Erschließung ihres verbalen Potentials wegen existieren.
Mayröckers lebenslange Liebesgeschichte mit der Sprache hat es ihr ermöglicht, einige der berührendsten Liebesgedichte der neueren deutschsprachigen Literatur zu schreiben. Ein Beispiel ist das Gedicht „Wie und warum ich dich liebe“, das Ernst Jandl zu dessen siebzigstem Geburtstag gewidmet ist:
wenn du es bist bin ich nicht sicher ob ich es bin
was dich bedroht ist bedrohlich für mich
der Spiegel in den ich blicke an jedem Abend
hält mir gleichzeitig entgegen dein Bildnis und meines
das Geheimnis im Dunkel deines Herzens ist nicht
um von irgendjemandem gelüftet zu werden
es zieht mich an am gründlichsten und am tiefsten
und ist vermutlich das Motiv meiner unbeirrbaren Liebe
Mayröckers Texte sind letztendlich ebenfalls solche Spiegel, auch mehrfach gebrochene. Wenn wir sie lesen, erkennen wir uns selbst und das ewig wechselnde Bild unserer vielsagendsten Leidenschaft, der Sprache.
Rüdiger Görner; aus Rüdiger Görner: Sprachrausch und Sprachverlust, Sonderzahl Verlag, 2011
DANK AN FRIEDERIKE MAYRÖCKER
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamit
einer Schlange in einen Sack gesperrt sein,
spanischer
Heimatling!
heimatling / heimattling
heimattling mattgeliebt matter-
horn, die stierhörner
so im nebel
so im nebel
aussichtlos
die nordwand
José F.A. Oliver
Theo Breuer: „Wie eine Lumpensammlerin“ – Vermerk zu Friederike Mayröckers Werk nach 2000
poetenladen.de, 20.12.2014
Im Juni 1997 trafen sich in der Literaturwerkstatt Berlin zwei der bedeutendsten Autorinnen der deutschsprachigen Gegenwartslyrik: Friederike Mayröcker und Elke Erb.
Protokoll einer Audienz. Otto Brusatti trifft Mayröcker: Ein Kontinent namens F. M.
Zum 70. Geburtstag der Autorin:
Daniela Riess-Beger: „ein Kopf, zwei Jerusalemtische, ein Traum“
Katalog Lebensveranstaltung : Erfindungen Findungen einer Sprache Friederike Mayröcker, 1994
Ernst Jandl: Rede an Friederike Mayröcker
Ernst Jandl: lechts und rinks, gedichte, statements, perppermints, Luchterhand Verlag, 1995
Zum 75. Geburtstag der Autorin:
Bettina Steiner: Chaos und Form, Magie und Kalkül
Die Presse, 20.12.1999
Zum 80. Geburtstag der Autorin:
Nico Bleutge: Das manische Zungenmaterial
Stuttgarter Zeitung, 18.12.2004
Klaus Kastberger: Bettlerin des Wortes
Die Presse, 18.12.2004
Ronald Pohl: Priesterin der entzündeten Sprache
Der Standard, 18./19.12.2004
Michael Braun: Die Engel der Schrift
Der Tagesspiegel, 20.12.2004
Auch in: Basler Zeitung, 20.12.2004
Gunnar Decker: Nur für Nervenmenschen
Neues Deutschland, 20.12.2004
Jörg Drews: In Böen wechselt mein Sinn
Süddeutsche Zeitung, 20.12.2004
Sabine Rohlf: Anleitungen zu poetischem Verhalten
Berliner Zeitung, 20.12.2004
Michael Lentz: Die Lebenszeilenfinderin
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20.12.2004
Wendelin Schmidt-Dengler: Friederike Mayröcker
Zum 85. Geburtstag der Autorin:
Elfriede Jelinek, und andere: Wer ist Friederike Mayröcker?
Die Presse, 12.12.2009
Gunnar Decker: Vom Anfang
Neues Deutschland, 19./20.12.2009
Zum 90. Geburtstag der Autorin:
Herbert Fuchs: Sprachmagie
literaturkritik.de, Dezember 2014
Andrea Marggraf: Die Wiener Sprachkünstlerin wird 90
deutschlandradiokultur.de, 12.12.2014
Klaus Kastberger: Ich lebe ich schreibe
Die Presse, 12.12.2014
Barbara Mader: Die Welt bleibt ein Rätsel
Kurier, 16.12.2014
Sebastian Fasthuber: „Ich habe noch viel vor“
falter, Heft 51, 2014
Marcel Beyer: Friederike Mayröcker zum 90. Geburtstag am 20. Dezember 2014
logbuch-suhrkamp.de, 19.1.2.2014
Maja-Maria Becker: schwarz die Quelle, schwarz das Meer
fixpoetry.com, 19.12.2014
Sabine Rohlf: In meinem hohen donnernden Alter
Berliner Zeitung, 19.12.2014
Tobias Lehmkuhl: Lachend über Tränen reden
Süddeutsche Zeitung, 20.12.2014
Arno Widmann: Es kreuzten Hirsche unsern Weg
Frankfurter Rundschau, 19.12.2014
Nico Bleutge: Die schöne Wirrnis dieser Welt
Der Tagesspiegel, 20.12.2014
Elfriede Czurda: Glückwünsche für Friederike Mayröcker
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Kurt Neumann: Capitaine Fritzi
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Elke Laznia: Friederike Mayröcker
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Hans Eichhorn: Benennen und anstiften
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Barbara Maria Kloos: Stadt, die auf Eisschollen glimmt
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Oswald Egger: Für Friederike Mayröcker zum 90. Geburtstag
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Péter Esterházy: Für sie
Manuskripte, Heft 206, Dezember 2014
Zum 93. Geburtstag der Autorin:
Einsame Poetin, elegische Träumerin, ewige Kinderseele
Die Presse, 4.12.2017
Zum 95. Geburtstag der Autorin:
Claudia Schülke: Wenn Verse das Zimmer überwuchern
Badische Zeitung, 19.12.0219
Christiana Puschak: Utopischer Wohnsitz: Sprache
junge Welt, 20.12.2019
Marie Luise Knott: Es lichtet! Für Friederike Mayröcker
perlentaucher.de, 20.12.2019
Herbert Fuchs: „Nur nicht enden möge diese Seligkeit dieses Lebens“
literaturkritik.de, Dezember 2019
Claudia Schülke: Der Kopf ist voll: Alles muss raus!
neues deutschland, 20.12.2019
Mayröcker: „Ich versteh’ gar nicht, wie man so alt werden kann!
Der Standart, 20.12.2019
Zum 96. Geburtstag der Autorin:
Fakten und Vermutungen zur Autorin und Interview 1 + 2 + 3 + 4
Archiv 1 + 2 + KLG + IMDb + ÖM
DAS&D + Georg-Büchner-Preis
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Galerie Foto Gezett +
Dirk Skiba Autorenporträts + Autorenarchiv Susanne Schleyer
shi 詩 yan 言 kou 口
Friederike Mayröcker – Trailer zum Dokumentarfilm Das Schreiben und das Schweigen.

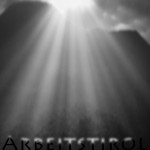
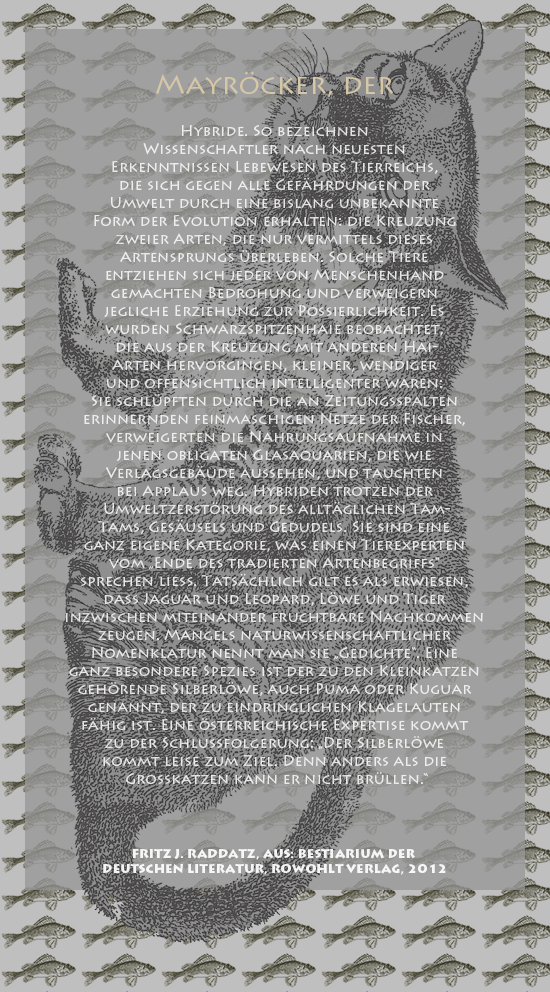








Schreibe einen Kommentar