„Der von Männern dominierte Literaturbetrieb tut sich schwer mit queerer Literatur: Männer, die mit Männer schlafen, und etwas über Liebe sagen: schwierig. Frauen, die von ihnen nicht begehrt werden können: heikel.“ In seinem Essay gibt Donat Blum eine Einordnung über die äußere und seine innere Wahrnehmung seiner Literatur, wobei sich die Frage stellt, was einen Text als queer deklariert. Ist OPOE ein queeres Buch? War das Schreiben dieses Romans ein emanzipatorischer Akt?

(c) Melanie Hauke
Mit OPOE habe ich kein politisches, kein queeres Buch geschrieben. Ich habe ein Buch geschrieben. Es ist aber, ob ich es will oder nicht, eines geworden: Denn ich sage in ihm «Ich».
Ich bin ein politischer Mensch. Ob ich es will oder nicht.
Ich sage «Liebe» und die Leute sind überrascht, dass ich dazu etwas zu sagen habe, geht es «uns» Homosexuellen doch nur um Sex.
Ich sage «wir Männer» und Männer schauen beschämt zu Boden, weil zwischen mir und ihnen, da besteht doch einen großer Unterschied.
Ich schreibe ein Buch, das, neben vielen anderen, queere Protagonisten aufleben lässt, und ich werde gefragt – und das bemerkenswerte ist, ich frage mich danach auch selbst – ist das ein queeres Buch?
Ich bin ein politischer Mensch. Die Gesellschaft stellt Fragen, also antworte ich.
Ich bin ein politischer Mensch – ein wenig, weil ich es gewählt habe, ein wenig aus Lust an der Sache, an der Rhetorik, dem Perspektivenwechsel, dem Altruismus und dem Kampf für eine sozialere Welt. Aber vor allem, weil ich so geboren wurde, nicht direkt politisch, aber schwul oder queer.
Als Jugendlicher war für mich eine der prägendsten Erfahrungen die erlebte Dissonanz zwischen der Realität meiner Existenz und der Abwesenheit eines Platzes, den die Gesellschaft dafür vorgesehen hat. Ich stand vor der Wahl, meine Eigenheiten zu ignorieren, zu verstecken oder einen Platz für sie zu erkämpfen.
Der Platz als queer denkender und als «schwul» gelesener «Mann» ist, wie der Platz von vielen anderen Minderheiten, umstritten. Sowohl außerhalb als auch in mir. Die Gesellschaft sieht es als Selbstverständlichkeit an, dass sie einen großen Teil meiner Identität in der Öffentlichkeit verhandeln darf. Das Ringen um die «Ehe für alle» ist da genauso gemeint wie die Anfrage zu diesem Blog-Beitrag, «wie und ob man in einem literarischen Text das Queersein von Charakteren erzählt».
Der Platz als queer denkender und als «schwul» gelesener «Mann» ist, wie der Platz von vielen anderen Minderheiten, umstritten.
Verstehen Sie mich nicht falsch: Über Identität zu reden ist nichts Verwerfliches. Eine funktionierende Gesellschaft muss sich austauschen. Identität ist keine Konstante, sie verändert sich ständig und verlangt nach anhaltender Reflexion. Nicht zu Letzt aus Respekt für mein Gegenüber stelle ich gerne zur Disposition, was immer ich von mir zur Disposition stellen kann. Meine Existenz, deren Essenz das Lieben ist, verhandle ich aber nicht.
Im Gegenteil, ich bin ein politischer Mensch:
«Ich».
«Ich, als Mensch, der als schwuler Mann gelesen wird».
«Ich, der das Queersein von Charakteren erzählt.»
«Ich, der Menschen liebt.»
Ich sage «Ich» im Wissen um den Kontext, dass es umstritten ist – sowohl das literarische als auch mein persönliches Ich. In der Gesellschaft genauso wie im Literaturbetrieb. Ich kriege es fast täglich zu spüren. Aber ich bin nicht bereit, eine Opferrolle einzunehmen.
«Ich».
«Ich, ein queerer Autor»,
«Ich, der schwule Protagonist».
«Ich, der sich nicht scheut, seinen Platz zu erkämpfen».
«Das ist Nabelschau.»
«Das ist Selbstbeweihräucherung.»
«Das ist nicht vorgesehen.»
«Warum meint hier jemand sein Ich sei relevant?»
Ich höre die Stimmen, die das rufen. Ich höre sie da draußen, manchmal, und noch öfter in mir drin. Ich für Ich ist das Schreiben von OPOE so zu einem Emanzipationsakt geworden – ein Dagegenhalten, ein Darüberhinwegsetzen, Selbstermächtigung und Befreiung.
Die Gesellschaft sieht es als Selbstverständlichkeit an, dass sie einen großen Teil meiner Identität in der Öffentlichkeit verhandeln darf.
In einem Essay analysierte das Anke Stelling messerscharf[1]:
«Wenn ich »ich« sage und anhand meines Beispiels etwas und mich selbst behaupte, dann geschieht das gegen Widerstände. […] In der feministischen Theorie nennt man das Politik der ersten Person.»[2]
Ich bin ein politischer Mensch. Ich sehe mich als Teil des Umfeldes, in dem ich lebe. Der Nahbeziehungen, des Viertels, der Gesellschafft, der Welt – und auch des Literaturbetriebs.
Die Frage, ob ich queere Akteure erzählen wolle, ist keine aus der Luft gegriffene:
Eine befreundete Autorin hat ihre frauenliebende Protagonistin im letzten Moment zu einem männlichen Protagonisten umgeschrieben. Eine andere lässt ihre weiblichen Hauptfiguren alle asexuell auftreten, um sie nicht als lesbisch outen zu müssen und eine dritte und eine vierte lehnten ab, ihre Texte in einem «queeren Rahmen» vorzustellen.
Sie fürchten, wären ihre Protagonistinnen – oder sie selber – offen queer, dann landeten ihre Bücher – und sie mit ihnen – in der «Nische». Keine irrationale Angst. Es gibt sie, die Nische. Sie ist eng und dunkel. Oder im Gegenteil: weit und leer. Auf alle Fälle ist in ihr schon manch guter Text verschwunden.
Der von Männern dominierte Literaturbetrieb tut sich schwer mit queerer Literatur: Männer, die mit Männer schlafen, und etwas über Liebe sagen: schwierig. Frauen, die von ihnen nicht begehrt werden können: heikel. Oder in Literaturbetriebs-Worten: «zu klein», «zu wenig mehrheitsfähig», «zu spezifisch», «ich als Mann tue mir hier natürlich schwer, diese Sexszene zwischen Männern zu lesen».
Es gibt sie, die Nische. Sie ist eng und dunkel. Oder im Gegenteil: weit und leer. Auf alle Fälle ist in ihr schon manch guter Text verschwunden.
Sie fürchten den Verlust von Einnahmen, sie fürchten den Verlust ihrer fast wie angeborenen Selbstverständlichkeit. Aber sie übersehen, dass sie mit ihrer Einschätzung ziemlich allein dastehen. Zahlreiche Umfragen zeigen und der Blick ins Publikum bei Lesungen bestätigt es: Der Großteil der Leser*innen (und Hörer*innen) von erzählender Literatur ist weiblich. Sie haben mit Homosexualität nicht nur in aller Regel kein Problem. Nein, es ist für viele Frauen sogar entspannend, nicht noch von einem weiteren Mann sexualisiert zu werden, gedanklich «kuscheln» zu können statt schon wieder als Objekt von Männerbegierden herhalten zu müssen. Früher gingen Musikproduzenten davon aus, dass ein Outing eines Popstars, die Karriere ruinieren würde: Welches Mädchen schwärmt schon für einen schwulen Popstar? Heute feiern selbst die heterosexuellsten Produzenten nicht nur Troye Sivan.
Die Erkenntnis, dass Queerness nicht vor allem abstößt, sondern geradezu anziehend wirken kann, hat sich in der englischsprachigen Pop-Kultur durchgesetzt. Call Me By Your Name, Ellen DeGeneres und Hannah Gadsby sind nur einige der bekanntesten Beispiele. In der deutschsprachigen Literatur hält diese Einsicht hingegen erst gemächlich Einzug. Meistens durch Übersetzungen: «Ein wenig Leben», «Rückkehr nach Reimes», «Das Ende von Eddy». Der hiesige Literaturbetrieb zögert, zu realisieren, dass Queerness nicht nur okay ist, sondern ein Verkaufsargument sein kann. Nicht weil Queerness besonders hip ist oder cool, nicht weil Frauen Sex außerhalb der Norm nicht schlimm finden, sondern weil das queere Leben anders ist, weil es eine neue Welt eröffnen kann, weil es Freiraum lässt und schafft, weil Menschen neugierig sind.
Auf Netflix und Co. haben sich Emanzipationsserien zu einem regelrechten Genre entwickelt: «Grace and Frankie», «Dear White People» oder «Transparent» sind nur einige Titel. Sie alle leben von der Schönheit der Momente, in denen sich Menschen aus einem viel zu engen Korsett befreien. Sie verführen mit der Lust des wirkungsvollen Befreiungsschlags.
Das Verkaufsargument interessiert mich persönlich aber nur am Rande. Dass ich queere Charaktere thematisiere, hängt einerseits mit meiner Lebensrealität zusammen und andererseits vor allem damit, dass es kaum ein besseres Medium gibt als die Literatur, um diese wortwörtlich «sensible» Themen, äußere und verinnerlichte Normen, zu verhandeln:
Kein anderes Medium trifft in einem solch geschützten Rahmen auf sein Gegenüber. Ein Rahmen, der es sowohl Schreiber*innen als auch Leser*innen erlaubt, tief in sich zu gehen und in aller Ruhe das Gelesene mit den eigenen Erfahrungen abzugleichen – ohne argwöhnisch beäugt, ohne verurteilt zu werden. Kein anderes Medium, das sich so nahe beim eigenen Ich, bei den eigenen Gefühlen und Gedanken bewegt. Also genau da, wo auch queere Themen ihren Anfang nehmen: Bei der körperlichen und geschlechtlichen, bei der sprachlichen, der emotionalen, der geistigen und der gesellschaftlichen Identität.
Der hiesige Literaturbetrieb zögert, zu realisieren, dass Queerness nicht nur okay ist, sondern ein Verkaufsargument sein kann.
«Ich bin ein politischer Mensch.»
Die Entschiedenheit dieses Satzes passt nur bedingt in diesen sensiblen Raum. Politik wird gerne mit Haudegen gleichgesetzt, mit markigen Sprüchen und dem Widerspruch zu oder dem Schüren von Ängsten. Mich von dieser Vorstellung zu lösen war einer der intensivsten aber auch spannendsten Prozesse der letzten Jahre, während derer ich immer tiefer ins Schreiben und Erzählen eingetaucht bin. Ich drang, wie ich es meistens beim Schreiben tue, von Außen nach Innen vor und mit jedem Durchgang fiel eine nächste Schicht, die mich und meinen Text vom Kern, um den wir uns drehten, trennte:
Ich lernte, dass Literatur, die mir gefällt, in leisen Tönen spricht, um das empfindliche Innerste nicht zu erschrecken.
Ich lernte, dass Literatur dadurch nicht weniger eindringlich wird. Im Gegenteil.
Ich lernte, dass Literatur, die mir gefällt, kein tagespolitisches Ziel verfolgt, sondern Raum zum Abwägen schafft, von eigenen und gelesenen Erfahrungen.
Ich lernte, dass Literatur, die mir gefällt, nicht argumentiert, sondern der Welt und ihren Normen sorgfältige Geschichten, Vielfalt, entgegensetzt.
Ich lernte, und kam immer wieder darauf zurück, dass diese meine erste Geschichte in Buchform wohl von einem Ich erzählt werden muss. Nicht von einem queeren Ich, aber, weil ich und es in einer heteronormativen Gesellschaft queer leben und denken, von einem Ich:
Ein Ich, das hin steht und die Herausforderung annimmt, seinen inneren und äußeren Platz zu erkämpfen, ein Ich, das sich erfahrbar macht und sich so befreit, um 1001 neue Welten zu entdecken.
[1] https://www.aargauerzeitung.ch/kultur/buch-buehne-kunst/oben-ist-die-luft-fuer-frauen-duenn-im-literaturbetrieb-liegt-die-macht-noch-immer-bei-maennern-132851538
[2] https://www.jungewelt.de/artikel/334294.die-stimme-verstellen.html
Das Buch
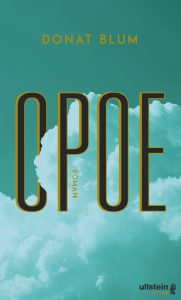 Opoe ist die Fremde. Die fremd gebliebene Großmutter. Nun ist sie tot. Die einsame und exzentrische Frau, die ihn bis zum Schluss gesiezt hat. Der Enkel reist zu den Orten, an denen sie gelebt hat. Nach Holland und in die Schweiz. Versucht, ihrem Schweigen eine Stimme zu geben. Versucht, herauszufinden, wer sie war und was das mit ihm zu tun hat. Beide Leben verschränken sich im Ringen um einen Platz in der Gesellschaft. Elegant erschafft Donat Blum eine atmosphärisch verdichtete Welt.
Opoe ist die Fremde. Die fremd gebliebene Großmutter. Nun ist sie tot. Die einsame und exzentrische Frau, die ihn bis zum Schluss gesiezt hat. Der Enkel reist zu den Orten, an denen sie gelebt hat. Nach Holland und in die Schweiz. Versucht, ihrem Schweigen eine Stimme zu geben. Versucht, herauszufinden, wer sie war und was das mit ihm zu tun hat. Beide Leben verschränken sich im Ringen um einen Platz in der Gesellschaft. Elegant erschafft Donat Blum eine atmosphärisch verdichtete Welt.
„Opoe“ auf den Seiten der Ullstein Buchverlage


[…] In seinem jüngst erschienenen Essay »Die Gesellschaft stellt Fragen, also antworte ich« (Link: http://www.resonanzboden.com/u/donat-blum-queere-literatur) setzt er sich mit dem politischen Aspekt des queeren literarischen Ichs auseinander. Donat Blum […]