|
rezensiert von Thomas Harbach
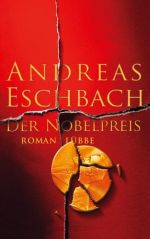 Andreas Eschbachs neuer Roman „Der Nobelpreis“ ist nach „1 Billionen Dollar“ und „Der Letzte seiner Art“ das dritte Hardcover im Bastei Lübbe Verlag. Ähnlich wie bei „Das Jesus- Video“ spricht er mit diesen modernen Thrillern ein breiteres Publikum an und präsentiert sich als unterhaltsamer Spannungsautor. Konnte „1 Billionen Dollar“ mit seiner verblüffend simplen Idee – man legt in der Vergangenheit ein kleines Vermögen Zins bringend an und erhält fünfhundert Jahre später eine unfassbare Summe, um ganze Wirtschaftssysteme aus den Angeln zu heben – und einem interessanten Konzept überzeugen, wirkte der Universal Soldier- Verschnitt „Der Letzte seiner Art“ seltsam inhalt- und blutleer. Nur die Umgebung – Irland – hob den Roman aus seinem inhaltlichen Klischeebrei etwas heraus.
Andreas Eschbachs neuer Roman „Der Nobelpreis“ ist nach „1 Billionen Dollar“ und „Der Letzte seiner Art“ das dritte Hardcover im Bastei Lübbe Verlag. Ähnlich wie bei „Das Jesus- Video“ spricht er mit diesen modernen Thrillern ein breiteres Publikum an und präsentiert sich als unterhaltsamer Spannungsautor. Konnte „1 Billionen Dollar“ mit seiner verblüffend simplen Idee – man legt in der Vergangenheit ein kleines Vermögen Zins bringend an und erhält fünfhundert Jahre später eine unfassbare Summe, um ganze Wirtschaftssysteme aus den Angeln zu heben – und einem interessanten Konzept überzeugen, wirkte der Universal Soldier- Verschnitt „Der Letzte seiner Art“ seltsam inhalt- und blutleer. Nur die Umgebung – Irland – hob den Roman aus seinem inhaltlichen Klischeebrei etwas heraus.
Auch „Der Nobel-Preis“ scheint in erster Linie von einer Reise inspiriert worden zu sein. Der Trip führte nach Stockholm und wahrscheinlich auch in die Heiligen Hallen der Akademie. Was lag also näher, als im Zeitalter der Konspiration einen echten Verschwörungsthriller zu schreiben? Der wichtigste Preis, das elitäre Komitee inbegriffen, ist das Ziel von Manipulationen aus der immer rücksichtsloser werdenden Wirtschaft. Es halten sich Gerüchte, dass zumindest ein Nobelpreis – Medizin 1986 – im Vorwege seltene und seltsame Unterstützung aus den Kreisen eines italienischen Pharmakonzerns erhielt. Und wer sich mit den Verstrickungen in anderen Bereichen unserer Wirtschaft – VW, Daimler, das Investmentbanking auf dem Höhepunkt seiner „Macht“ zu Beginn des Jahres 2001 – auseinandersetzt, der erkennt schnell, dass Eschbach seine potentielle Fiktion durchaus auf realen Wurzeln aufbaut, bzw. aufbauen könnte.
Eine glänzende Ausgangssituation, die Andreas Eschbach über fast ein Viertel des Buches herausragend extrapoliert. Er schlägt seine Leser in seinen Bann. Ein augenscheinlich harmloses Mitglied des Vergabekomitees wird erst mit 3 Millionen schwedischer Kronen bestochen, für eine Kandidatin zu stimmen, die er schon aus Überzeugung gewählt hätte. Ein wichtiges Element dieses Romans besteht aus dieser augenscheinlich sinnlosen Bestechung. Er lehnt das Angebot ab und wendet sich an seine Vorgesetzten. Kurz darauf wird seine Tochter entführt. Obwohl die Kandidatin den Preis erhält und der Eindruck erweckt wird, als wenn viele Mitglieder der Versammlung bestochen worden sind, wird seine Tochter nicht freigelassen. Sie soll bis zur Übergabe des Preises in zwei Monaten bei den Entführern bleiben. Verzweifelt wendet er sich an die einzige Person, die ihm helfen kann. Der verhasste Schwager seiner bei einem Autounfall verstorbenen Frau, der wegen Industriespionage im Gefängnis sitzt. Dank eines generellen Amnestiegesetzes kommt dieser auf freien Fuß und kann die Suche beginnen. Das weiß er allerdings nicht, er geht davon aus, dass Schwager hat ihn dank seines Einflusses aus dem Gefängnis holen können. Der Beginn einer Reihe von Fehlprognosen.
Es ist schon ungewöhnlich, wenn ein Autor die Perspektive im Roman an sich wechselt. Aus der unzugänglichen dritten Erzählebene springt die Handlung in die Ich- Erzählung. Am Ende eines Kapitels und bevor der eigentliche, neue Handlungsträger Gunnar Forsberg inthronisiert worden ist. Das anfänglich verwirrende Element scheint sich über weite Strecken des Buches als Glücksgriff zu entpuppen, bevor, ja… bevor Eschbach den Handlungsbogen ein weiteres Mal dreht und den Leser – ohne zu viel vom Plot zu verraten – hungrig und unzufrieden zurücklässt.
Wenn Autor und Verlag dermaßen mit einem Verschwörungsthriller hausieren gehen, dann sollte und muss dieser Gedanke zumindest in der generellen Konzeption durchdacht worden sein. Mitten im Roman spricht Forsberg seine Leser direkt an- er fühlt sich verraten und missbraucht. Genau wie seiner Ansicht nach der Leser. Eschbach versucht die sicherlich nachvollziehbaren Gefühle seiner Leser auf seinen Charakter zu übertragen und so das „Buch in die Ecke werfen“ zu verhindern. Ein interessanter Trick, vielleicht sogar eine literarische Schutzbehauptung, nachdem der Leser dem interessant gestalteten Protagonisten Forsberg durch dick und dünn gefolgt ist. Dazu sollte näher auf den Plot eingegangen werden und wer sich die latente Spannung erhalten möchte, dem sei abgeraten, die Besprechung weiter zu lesen.
In erster Linie erzählt Eschbach eine zutiefst menschliche Geschichte. Forsberg – zusammen mit seiner Schwester früh Waise geworden – hat immer versucht, sein Leben selbst zu gestalten. Das ist ihm im Grunde nie richtig gelungen. Obwohl ein geschätzter Industriespion wurde er sein Leben lang manipuliert. Das begann mit seiner Schwester, die aus dem Waisenheim geflohen ist und deren Existenz er mit Einbrüchen sicherte. Nach den ersten Gefängnisstrafen unterlag er der Versuchung, seinem kriminellen Bewährungshelfer zu folgen, eine tiefer gehende Beziehung zu Frauen konnte er nicht aufbauen und nur seine Schwester und später deren Tochter stilisierte er zu Ikonen. Darum kommt es – im Nachhinein – auch nicht überraschend, dass er im Verlauf des Buches wieder zu einem Opfer gewissenloser Manipulationen geworden ist. Am Ende der Handlung stellen alle Charaktere in einer fast tränenreichen Deklaration fest, dass sie berechenbar sind ohne das der jeweilige „Partner“ die Hintergründe gekannt hat oder kennen konnte. Nach und nach schält Eschbach seine Figuren, entblößt deren Inneres und legt ihre Schwächen, aber auch überraschenden Stärken frei. Literarisch wieder ein durchdachter Zug, wenn… ja wenn dieser nicht am Ende eines über weite Strecken gut konzipierten Romans gestanden hätte, der auf einer literarischen Lüge basiert. Eschbach liegt seine Leser mehrmals an. Er schiebt das später auf eine verzerrte Realitätswahrnehmung einer seiner Figuren, aber der Leser fühlt sich betrogen. Weder von seinem Partner im Roman, sondern in erster Linie von dem Autoren. Diese ungeschickten Manipulationen hätten in Form von persönlich erzählten Rückblenden deutlich überzeugender und für den Leser nachvollziehbarer integriert werden können. Aber in der dritten Person eine Handlung aufzubauen und diese schließlich als Fiktion darzustellen, ist fatal und für diesen Roman tödlich. Selbst Alfred Hitchcook musste nach der Erstaufführung seines Filmes „The Wrong Man“ feststellen, dass man sein Publikum nicht anlügen darf. Manipulation ist erlaubt, Lügen nicht. Diese Grenze überschreitet Eschbach mehrmals und reduziert seinen reißerischen Plot auf eine Familiengeschichte mit kleinen Hinweisen auf Einzeltäter, die sich in ihrer kranken Phantasie Märkte für eigene Produkte schaffen. Nichts mehr von einer langjährigen Verschwörung des Großkapitals gegen das ehrwürdige Nobelpreiskomitee, keine Bestechungen in der Form von Reisen, nicht einmal der Hinweis auf potentielle Kinderpornographie kann genutzt werden. Alles Lügen, alle Puzzlesteine, die in unterschiedlicher Form zu vollkommen anderen Bildern zusammengesetzt werden können. Vielleicht sah Eschbach in die Form ein Novum, das Buch der Zukunft, vielschichtig zu schreiben und noch vielschichtiger zu interpretieren.
Aber es funktioniert nicht. Wie bei „Die Letzten Ihrer Art“ erwartet der Leser mehr und möchte zumindest die Richtung kennen, in die die Handlung fließen könnte. Selbst die Mühe, die sich Eschbach macht, seinen Figuren ein Leben nach dem Roman zu geben, geht ins Leere. Zwei Menschen finden sich, die Tochter darf ihr Leben weiterführen und wird von allen Verwandten unterstützt. Der Betrüger bestraft sich selbst und schließt mit seinem bisherigen Leben ab, der verbrecherische Hacker – da er immer wieder benötigt worden ist – verschwindet im Zeugenschutzprogramm und lernt eine Frau fürs Leben kennen, natürlich ein Polizistin, sonst würde der Schlusssatz ja keinen Sinn machen und der Leser… tja… der Leser muss beim nächsten Mal nach den Roman Dan Browns oder Theodore Roszaks „Schattenlichter“ greifen, um einen echten Verschwörungsthriller zu lesen.
Grundsätzlich funktioniert das Buch in dieser Konstellation nicht. Da hilft alles lamentieren nicht, der Leser fühlt sich vom Autoren betrogen.
Diese Konstellation ist noch so tragischer, als dass es Eschbach gelingt, überzeugende Charaktere zu erschaffen. Der einsame, verwirrte Professor, gefangen in einem Elfenbeinturm aus Forschung und Konflikten im eigenen Haus. Seine Frau ist vor einigen Jahren bei einem Autounfall umgekommen, an dem er selbst – trotz einer Verkettung unglücklicher Umstände – sicherlich eine gewisse Mitschuld trägt. Er beginnt auch seine Tochter zu verlieren. Als er einen zweiten persönlichen Fehler begeht, bleibt ihm nur die Flucht in seine eigene Welt. In dieser stellt er sich natürlich als Opfer und nicht als Täter dar. Eschbach beginnt diese Figur erst gegen Ende des Romans wirklich zu entwickeln, zu wenig geht er auf den in seiner Existenz bedrohten Mann zu Beginn des Buches ein. Im Mittelteil mit dem dominierenden Ich-Erzähler Forsberg wird er aus einer leicht verzerrten Perspektive dargestellt. In der Sekunde, in der der Seelenstriptease der einzelnen Charaktere beginnt, ist es fast zu spät und viele Ansätze werden einfach überlagert. Dem Buch hätte eine Entzerrung dieser Charakterzüge gut getan. Eschbach hätte viel mehr potentielles, aber persönliches Konfliktpotential in den ersten Teil des Romans integrieren müssen, so wird der Leser – vergleichbar Forsberg – am Ende förmlich überrannt.
Konträr hat der Autor den sympathischen Gewohnheitsverbrecher – das ist nun einmal jeder Industriespion, egal wie positiv Eschbach versucht, ihn zu charakterisieren – angelegt. Bodenständig, clever, lernfähig, aber auch gewaltbereit, aufbrausend und seinen Schwager hassend. Auch wenn Eschbach seinen Hintergrund und seine Motivation deutlich herausarbeitet und sein literarisches Gewicht zu Gunsten dieser Figur in die Waagschale legt, bleiben Fragen offen. Ist ein Industriespion wirklich „gut“ – den großen Firmen die Geheimnisse zu stehlen und an die Kleinen teuer zu verkaufen - ? Was unterscheidet ihn vom gewöhnlichen Dieb? Warum – das wird rückblickend nirgends deutlich erläutert – ist Forsberg verschiedenen Menschen – von seiner Schwester über den Bewährungshelfer bis letzt endlich seinem Schwager – hörig? Warum beschreibt ihn Eschbach trotz seiner kriminellen Fähigkeiten und Energie als sklavisch leichtgläubig? Im Grunde nimmt sich Eschbach damit auch ein erhebliches Spannungspotential. Es gibt auf die entscheidende Frage im Grunde wenig Hinweise. Die sehr intelligente Nobelpreisträgerin stellt Forsberg diese Frage und ab diesem Moment beginnt der Roman im wahrsten Sinne des Wortes auseinander zu brechen. Warum sie diese Frage stellt, ist nicht klar ersichtlich. Sie selbst ist – so will es Eschbach – von ihrer Preiswürdigkeit überrascht worden, im Komitee selbst herrscht die Meinung vor und wird von der Presse an die Öffentlichkeit gebracht, dass es eine gewisse Anstandswartezeit zwischen erster Nominierung und Preisvergabe gibt. Warum sollte die Theorie, dass der Nobelpreis manipuliert und der Druck auf die Abstimmenden materiell und familiär enorm ist, nicht stimmen. Warum stellt sie die Frage nach den Beweisen, akzeptiert allerdings fraglos den Flugzeugabsturz, der drei Mitgliedern des Abstimmungskomitees das Leben kostet. Selbst Forsberg wäre über fehlende Pressenachrichten gestolpert, in denen die Öffentlichkeit über die Ereignisse auf dem Laufenden gehalten worden wäre. Nicht zuletzt entsprechende Trauerminute bei der NÄCHSTEN Vergabe der Preise. Die letzte Frage, die sich stellt, warum hat Eschbach dieses fragwürdige Element überhaupt in seinen Roman aufgenommen. Es ist vollkommen unnötig, verwirrt gezielt die Leser und stellt sich – wie viele andere Punkte des Plots – als Lüge heraus. Das Buch hätte auch ohne diese zusätzliche Schärfe funktioniert, wahrscheinlich sogar besser. Diese Passagen erwecken den Anschein, dass der Roman ursprünglich gänzlich anders konzipiert worden ist und Eschbach einen Ansatz suchte, vom Verschwörungsthriller wieder zu einer Familiengeschichte zurückzukehren. Dabei hat er einige lose Fäden im wahrsten Sinne des Wortes baumeln lassen und versucht, ihnen einen Knoten zu verordnen. Wie beim großen Hollywoodkino funktioniert dieser Ansatz meistens nicht.
Das Fazit ist zwiespältig. Eschbach ist inzwischen ein routinierter Autor. Stilistisch fehlerfrei, meistens ein geradliniger, in seinem Kurzgeschichtenwerk oft ironischer Zeitgeist. In seinen Romanen oft zu geradlinig und im Grunde einfallslos. Sowohl seine Jugendbücher um das Marsprojekt und sein Roman „Die seltene Gabe“ funktionierten in der Gesamtkonzeption nicht, sein „Der Letzte seiner Art“ ist experimentierfreudig angelegt – sehr gelungene Charakterisierung bei unterdurchschnittlicher Handlung -, während er in diesem Buch eher mit literarischen Gesetzen spielt als effektive eine stringente Geschichte zu erzählen. Über weite Strecken liest sich der Roman sehr gut, unterhält auf ordentlichem und handwerklich solidem Niveau, um dann wie das berühmte Kartenhaus kurz vor dem Abschluss in sich zusammenzufallen. Vielleicht schreibt irgendwann irgendjemand einen befriedigenden Wirtschaftsthriller um Korruption, Macht und die elitäre Nobelpreisgesellschaft, Andreas Eschbach hat es in diesem Buch nicht gemacht, nicht gewollt und auch nicht vollbracht.
Andreas Eschbach: "Der Nobelpreis"
Roman, Hardcover
Bastei Lübbe 2005
ISBN 3-7857-2219-2

Leserrezensionen
|
13.12.07, 16:53 Uhr
|
frell
hat Staffel 4 von Farscape nun auf Englisch gesehen...
registriert seit:
Apr 2007
|
Nein, das hat Herr Eschbach schon besser hinbekommen - z.B. in "Das Jesus-Video" und "Die Solarstation".
In vielen Eschbach-Büchern habe ich den Eindruck, er baut seinen Spannungsbogen enorm auf - nur um am Ende alles auf einer Seite überhastet aufzulösen.
Vielleicht hat er den Fehler selbst bemerkt? Denn hier passiert es fast genau umgekehrt. Der Spannungsbosgen wird aufgebaut, die Auflösung folgt und dann ... folgen noch weitere 40 völlig unnötige Seiten.
Aber wäre das nur das einzige Manko...
Ich bin nicht wirklich ein Freund von Ich-Erzählern (Ausnahmen bestätigen die Regel), aber das, was Eschbach hier macht, geht dann doch zu weit. Das Buch beginnt in der dritten Person - und nach einem Viertel springt es dann in die 1.Person.
Und mittendrin ist eine kleine Szene wieder in der 3. Person erzählt, jedoch nicht aus Sicht des ersten Erzählers, sondern aus Sicht eines für den Roman völlig unbdeutenden Polizisten. Ich gebe zu, diese Szene war eine der besten; vermutlich wollte sie Eschbach nicht rausnehmen, hätte er sie aber als Ich-Erzähler erzählt, wäre sie nur noch halb so gut.
Dennoch: Das sind mir ein paar Stilbrüche zu viel!
Außerdem, wie schon in der Review dargelegt, ist der Beginn in der 3. Person eine glatte Lüge - und das stößt durchaus schon am Ende des Buches auf und läßt einen recht unbefriedigt zurück.
Wie alle Eschbach-Bücher läßt sich das Buch zwar gut lesen, aber streckenweise ist es auch recht langweilig. Ich habe mich immer wieder erwischt, wie ich den Text nur noch überflogen habe.
Leider wurde hier eine gute Idee (Verschwörung beim Nobel-Preis) völlig vertan. Schade, Herr Eschbach.

Rygel: "...We can't escape."
Jool: "We're trapped?!?"
Rygel: "That's what 'we can't escape means.' Go help Stark hyperventilate."
(Unrealized Reality / Farscape 4.11)
|
|
|
|
|