|
rezensiert von Thomas Harbach
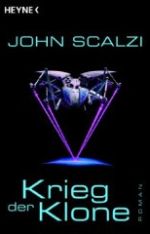 „Krieg der Klone“ ist John Scalzis Erstlingsroman. In den USA ist das Buch mit dem JOHN W. CAMPBELL AWARD als bestes neues Werk ausgezeichnet worden. Über Jahre die erste Ehrung für hoffnungsvolle Autoren und gleichzeitig ein Hinweis für die Science Fiction Leser, sich mit diesem Buch auseinanderzusetzen. Dabei hatte das Jurorenteam selten ein unglückliches Händchen. Der 1969 geborene Scalzi arbeitet als Journalist, Kolumnist und Sachbuchautor. In seinem Nachwort dankt er zu guter Letzt und damit als Priorotät Robert A. Heinlein, dessen Einfluss auf diesen Roman insbesondere im Mittelteil deutlich spürbar ist. Scalzi hat sich aber nicht an dessen farbenprächtigen Jugendromanen orientiert, sondern „Star Ship Troopers“ in den Mittelpunkt seiner Space Opera gestellt. Dabei fehlen seinem Roman ebenso wie dem Original die ironisch überzeichneten Sequenzen, welche Paul Verhoevens Verfilmung so akzeptabel gemacht haben. Im Original heißt das Buch „Old Man´s War“ und diese Aussage betrifft zumindest den größten Teil des Buches. Es gibt einen interstellaren Krieg zwischen der Menschheit und im Grunde dem Rest der Galaxis. Auf der Heimatwelt der Menschen bekommt man fast nichts davon mit, sie wirkt seltsam bodenständig extrapoliert, wenig spürbaren technischen Fortschritt, allenfalls in den Bereichen der Biomedizin, welche es den Menschen ermöglicht, zumindest in Ehren um die neunzig Jahre alt zu werden. Die einhundert ist weiterhin eine magische Barriere. Für den Krieg im All werden allerdings nur Menschen rekrutiert, welche das fünfundsiebzigste Lebensjahr überschritten haben. Der Dienst dauert – wenn man ihn überlebt – zehn Jahre. Für die alten Menschen eine neue Aufgabe, eine Mission. Weitere Daten gibt die geheimnisvolle Organisation, die das rekrutieren übernimmt, nicht heraus. John Perry ist ein sich langweilender Witwer, der jeden Tag das Grab seiner vor einigen Jahren verstorbenen Frau besucht. Er ist allein. An seinem Geburtstag schreibt er sich ein und beginnt ein neues Leben. Mit dem Fahrstuhl zu den Sternen werden sie in eine technologisch weiter als erwartet fortschrittliche neue Welt gebracht. Hier herrscht militärische Ordnung. Nach einer Reihe psychologischer Test – die einzigen Passagen, die satirische Elemente enthalten- erfahren sie das Geheimnis, das es ihnen ermöglicht, überhaupt die Strapazen einer militärischen Kampagne zu überstehen. Ihre Gehirne werden in neue, eigens gefertigte Klonkörper verpflanzt. Durch ihre Lebenserfahrung werden sie mit diesen Superkörpern – das erste, was die älteren Herrschaften machen, ist sexuelle Betätigung, es richtig krachen zu lassen, bevor der Ernst des Lebens beginnt, in allen Variationen – zur Ausbildung und schließlich in einen im Grunde aussichtslosen Krieg geschickt. Bei den sie begleitenden Spezialtruppen macht John Perry eine weitere überraschende Entdeckung, er begegnet einem jüngeren Ebenebild seiner Frau, die sich allerdings nicht an Perry erinnern kann.
„Krieg der Klone“ ist John Scalzis Erstlingsroman. In den USA ist das Buch mit dem JOHN W. CAMPBELL AWARD als bestes neues Werk ausgezeichnet worden. Über Jahre die erste Ehrung für hoffnungsvolle Autoren und gleichzeitig ein Hinweis für die Science Fiction Leser, sich mit diesem Buch auseinanderzusetzen. Dabei hatte das Jurorenteam selten ein unglückliches Händchen. Der 1969 geborene Scalzi arbeitet als Journalist, Kolumnist und Sachbuchautor. In seinem Nachwort dankt er zu guter Letzt und damit als Priorotät Robert A. Heinlein, dessen Einfluss auf diesen Roman insbesondere im Mittelteil deutlich spürbar ist. Scalzi hat sich aber nicht an dessen farbenprächtigen Jugendromanen orientiert, sondern „Star Ship Troopers“ in den Mittelpunkt seiner Space Opera gestellt. Dabei fehlen seinem Roman ebenso wie dem Original die ironisch überzeichneten Sequenzen, welche Paul Verhoevens Verfilmung so akzeptabel gemacht haben. Im Original heißt das Buch „Old Man´s War“ und diese Aussage betrifft zumindest den größten Teil des Buches. Es gibt einen interstellaren Krieg zwischen der Menschheit und im Grunde dem Rest der Galaxis. Auf der Heimatwelt der Menschen bekommt man fast nichts davon mit, sie wirkt seltsam bodenständig extrapoliert, wenig spürbaren technischen Fortschritt, allenfalls in den Bereichen der Biomedizin, welche es den Menschen ermöglicht, zumindest in Ehren um die neunzig Jahre alt zu werden. Die einhundert ist weiterhin eine magische Barriere. Für den Krieg im All werden allerdings nur Menschen rekrutiert, welche das fünfundsiebzigste Lebensjahr überschritten haben. Der Dienst dauert – wenn man ihn überlebt – zehn Jahre. Für die alten Menschen eine neue Aufgabe, eine Mission. Weitere Daten gibt die geheimnisvolle Organisation, die das rekrutieren übernimmt, nicht heraus. John Perry ist ein sich langweilender Witwer, der jeden Tag das Grab seiner vor einigen Jahren verstorbenen Frau besucht. Er ist allein. An seinem Geburtstag schreibt er sich ein und beginnt ein neues Leben. Mit dem Fahrstuhl zu den Sternen werden sie in eine technologisch weiter als erwartet fortschrittliche neue Welt gebracht. Hier herrscht militärische Ordnung. Nach einer Reihe psychologischer Test – die einzigen Passagen, die satirische Elemente enthalten- erfahren sie das Geheimnis, das es ihnen ermöglicht, überhaupt die Strapazen einer militärischen Kampagne zu überstehen. Ihre Gehirne werden in neue, eigens gefertigte Klonkörper verpflanzt. Durch ihre Lebenserfahrung werden sie mit diesen Superkörpern – das erste, was die älteren Herrschaften machen, ist sexuelle Betätigung, es richtig krachen zu lassen, bevor der Ernst des Lebens beginnt, in allen Variationen – zur Ausbildung und schließlich in einen im Grunde aussichtslosen Krieg geschickt. Bei den sie begleitenden Spezialtruppen macht John Perry eine weitere überraschende Entdeckung, er begegnet einem jüngeren Ebenebild seiner Frau, die sich allerdings nicht an Perry erinnern kann.
Viele Jungautoren haben für den ersten eigenständigen Roman oft auf bisher publizierte Kurzgeschichten zurückgegriffen und diese zu einem längeren Werk zusammengefügt. Das scheint bei dem bislang gänzlich unbekannten John Scalzi nicht der Fall zu sein, trotzdem wirkt sein Buch fragmentarisch. Es lässt sich im Zuge der Rezension in sehr unterschiedliche Teile aufspalten. Der Auftakt ist gut geschrieben. Scalzi stellt dem Leser überzeugend einen Protagonisten vor, der sein Leben im Grunde gelebt hat, sich einsam fühlt und eine neue Herausforderung sucht. Im Laufe des Buches erfährt man noch, dass er Werbetexter gewesen ist und durch eine weltberühmte Kampagne sehr viel Geld verdient hat. Der Hintergrund dieser zukünftigen Erde bleibt verschwommen, er ist im Grunde nicht wichtig. Mit der Reise zu den Sternen beginnt der eigentliche Roman. Hier fügt John Scalzi Elemente der Military Science Fiction zusammen und versucht aus diesen bekannten Teilen ein neues eigenständiges Werk zu machen. Die einzige wirklich originelle Idee im Mittelabschnitt ist die Verpflanzung der alten Persönlichkeiten in neue Superkörper. Die wahrscheinlich von Fremdvölkern zusammen gestohlene Technologie macht es möglich. Der Unterschied des technischen Standes auf der Erde und im All wird durch die Vorherrschaft der kolonialen Verteidigungskräfte erklärt, wirkt allerdings in diesem starken Kontrast nicht sonderlich überzeugend, sondern dient nur als Plotelement, um die Spannung möglichst lange hochzuhalten. Sowohl der Ich- Erzähler John Perry als auch der Leser sollen möglichst spät die Hintergründe der Rekrutierung von alten Menschen erkennen. Kaum sind diese Erläuterung und der Transfer pragmatisch durchgeführt, verliert John Perry die Übersicht. Seine Schwäche als junger Autor liegt weniger am eher routinierten Niederschreiben von Actionszenen, sondern in einer überzeugenden tiefer gehenden Charakterisierung seiner Figuren. Kaum sind die neuen Superkörper da, lassen es die alten Leute richtig krachen. Moral und Sitte fallen dank der potenten künstlichen Fähigkeiten unter den Tisch. Vom belanglosen Sex über die Gruppenorgie bis zu wenigen festen Partnerschaften ist alles vorhanden. Das erstaunliche und fragwürdige an diesem Abschnitt ist die kritiklose Akzeptanz der neuen Situation. Hüte dich vor den Militärs, die Geschenke bringen. Dank ihrer neuen Fähigkeiten werden die Lebens erfahrenen zu willigen Werkzeugen. Die Ausbildung – insbesondere der Einpeitscher ist nach dem Sergeant aus Stanley Kubricks unterschätztem „Full Metal Jacket“ moduliert worden - und die ersten Einsätze zeigen dagegen, dass Scalzi ein Anhänger des wehrhaften Militarismus ist, welcher mehr und mehr das politische Geschehen der USA zu beherrschen scheint. Die unendlichen Feinde werden in Anlehnung an Heinleins erzkonservativen Roman und im Gegensatz zu Joe Haldeman „Der ewige Krieg“ oder der Ender- Serie aus der Feder Orson Scott Cards als widerliche, „schleimig“ minderwertige Kreaturen charakterisiert, mit denen sich die Menschheit im Kampf um ihre Position im All insbesondere auf den Kolonialplaneten auseinandersetzen muss. Es gibt keine Basis für eine Verständigung, beide Seiten suchen den Kampf auf Biegen und Brechen. Dazu kommen die Spezialtruppen- das extreme Gegenteil der alten Kampftruppen, hier werden die „Seelen“ der Kinder in neue Körper verpflanzt - für Sondermissionen. Wie John Perry zumindest körperlich auf seine gestorbene Frau trifft, hätte sehr viel mehr Potential und Sprengstoff beinhalten können. Diese unverhoffte und anders als erwartende Begegnung hätte Perrys Glauben an das System erschüttern können oder müssen, statt dessen integriert der Autor diese sehr interessante und aber nur in Ansätzen erfolgreich angesprochene Handlungsebene viel zu schnell und viel zu glatt wieder in seinen geradlinigen verlaufenden Plot. Die militärischen Auseinandersetzungen sind packend geschrieben, John Perrys Liebe zu seinen Waffen und sein Glaube an die Richtigkeit seiner Mission reduziert seinen im ersten Drittel des Buches noch überzeugenden Charakter auf eine Schablone. Auch die Sympathieebene zwischen Protagonisten und Leser leidet unter dieser übertriebenen Simplifizierung. Die Beschreibung der militärischen Auseinandersetzungen erdrückt das zarte Pflänzchen von Originalität. Im Gegensatz allerdings zu brachialen erzkonservativen Autoren mit faschistoiden Zügen wie John Ringo, David Weber oder William Forstchen gelingt es John Scalzi zumindest im Kontext seines Roman der Ansatz einer Differenzierung. Ob es daran liegt, dass er seinen alten Protagonisten zumindest phasenweise die Möglichkeit eines latent kritischen Denkens ermöglicht oder er sich nicht traut, seine insbesondere im Mittelteil waffenfetischistischen Tendenzen gleich im Erstlingsroman auszuleben, lässt sich nicht befriedigend beantworten. „Krieg der Klone“ wird im Verlaufe seiner nicht immer originellen Handlung – im Gegensatz zum Ausgangsplot – politisch immer konservativer. Im Gegenzug hätten zumindest satirische oder gesellschaftskritische Elemente aufgebaut werden müssen, um dem Buch wieder ein Gleichgewicht zu geben. Das Buch ist unterhaltsam geschrieben auf einem fragwürdigen Niveau, denn ob Krieg per se ohne kritische Reflektion Unterhaltung sein sollte, muss jeder Leser für sich entscheiden. Das ein solches Buch mit dem John W. Campbell Award ausgezeichnet worden ist, zeigt allerdings beängstigende Tendenzen in der amerikanischen Science Fiction auf, die für das Genre im Allgemeinen nichts Gutes bedeuten könnten.
John Scalzi: "Krieg der Klone"
Roman, Softcover, 429 Seiten
Heyne Verlag 2007
ISBN 3-4535-2267-2

Leserrezensionen
:: Im Moment sind noch keine Leserrezensionen zu diesem Buch vorhanden ::
:: Vielleicht möchtest Du ja der Erste sein, der hierzu eine Leserezension verfasst? ::
|