|
rezensiert von Thomas Harbach
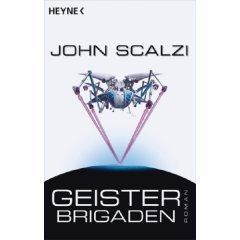 Mit John Scalzis zweitem Roman „Geisterbrigaden“ kehrt der junge amerikanische Science Fiction Autor zwar in das Universum seines Ernstlings „Krieg der Klone“ zurück, der Roman ist allerdings ein Einzelabenteuer, das bestimmte Tendenzen seines ersten Buches extrapoliert. Es ist nicht die auf dem Cover proklamierte Fortsetzung zu „Krieg der Klone“.
Mit John Scalzis zweitem Roman „Geisterbrigaden“ kehrt der junge amerikanische Science Fiction Autor zwar in das Universum seines Ernstlings „Krieg der Klone“ zurück, der Roman ist allerdings ein Einzelabenteuer, das bestimmte Tendenzen seines ersten Buches extrapoliert. Es ist nicht die auf dem Cover proklamierte Fortsetzung zu „Krieg der Klone“.
Die Themen erscheinen auf den ersten Blick ähnlich: ein futuristisches Krieg gegen Außerirdische Wesen, die Eliminierung des Schwachpunkts Mensch in einer technologisch hochgerüsteten irdischen Armee durch Kloning und Konditionierung sowie die Frage nach der eigenen Identität und der Chance, sein Schicksal selbst zu wählen. Beide Romane spielen vor dem Hintergrund eines inzwischen verzweifelt gewordenen Verteidigungskampfes der Menschheit gegen zahllose – nun, im vorliegenden Band sind es drei Rassen, die sich plötzlich gegen die Menschen verbünden als sich weiter wie bisher die Schädel gegenseitig einzuschlagen – außerirdische Angreifer. Die Kolonialen Verteidigungsstreitkräfte bestehen in Erster Linie auf der Kommandoebene aus Freiwilligen der älteren und augenscheinlich oberen Bürgerschicht. Im ersten Band werden ihnen neue Körper gegeben, damit sie wie aus dem Jungbrunnen, aber mit ihrer Lebenserfahrung gegen die Aggressoren vorgehen können. Zumindest theoretisch macht die Kombination von Lebenserfahrung und jungen, vitalen und künstlichen Körpern Sinn. In seinem ersten Roman macht John Scalzi nicht unbedingt das Optimale aus dieser Prämisse, die Hommage an Robert A. Heinleins „Sternenkrieger“ wirkt vor allem nach dem soliden Auftakt langatmig – trotz der Kürze des Buches – und teilweise unsympathisch geschrieben. Die einzelnen Charaktere sind stellenweise recht hölzern und eindimensional entwickelt worden.
Im vorliegenden zweiten Buch fehlt es ihm deutlich leichter, eine andere menschliche Taktik dieses aussichtslos erscheinenden Krieges zu beleuchten. Zu den Geheimwaffen der Menschheit gehören die so genannten Geisterbrigaden, eine Truppe, die aus der DNA von jung verstorbenen Soldaten – allerdings nicht an der Front, sondern während der Ausbildung – gezüchtet worden ist. Ihre Gehirne sind im wahrsten Sinne leer. Innerhalb von drei Monaten wird ihr Körper gezüchtet. Ihre neuronalen Netze werden durch ein künstliches Implantat – BrainPal mit der für Scalzis bisheriges Werk charakteristischen ironischen Art genannt – zu einer überdurchschnittlichen Entwicklung stimuliert, in denen ihnen immer wieder das zu nutzende Wissen vorgekaut und dann im entscheidenden Moment wie bei einem Nürnberger Trichter infiltriert wird. Diese Erwachsenen ohne Kindheit, die Menschen ohne eine echte Vergangenheit und vor allem den durch Eigenerleben angesammelten Erfahrungsschatz, diese seelenlosen Soldaten stellt John Scalzi an einem in doppelter Hinsicht bemerkenswerten Beispiel vor. Zu Beginn des Romans beschreibt der Autor die Besetzung eines außerirdischen Stützpunkts und die Befreiung eines Wissenschaftlers, der zumindest über das Wissen verfügt, warum sich drei in ihrem Wesen spinnefeindliche außerirdische Rassen plötzlich nicht mehr bekämpfen. Einer der besten Researchwissenschaftler Charles Brolin der Menschheit ist heimlich übergelaufen und ermöglicht es den menschlichen Feinden, ihren Genozid Gedanken tatsächlich in die Tat umzusetzen. Um sich vor den Nachstellungen durch die Geheimdienste zu schützen, hat Charles Brolin einen eigenen Klon geschaffen, den er an seiner Stelle tötet und verstümmelt. Gleichzeitig hat er sein Bewusstsein in einen Computer gespeichert, um zumindest sein Wissen zu retten. Ein Vorhang, welcher die bisherigen technischen Kapazitäten der Menschen übersteigt. Man plant, aus dem vorhandenen Genmaterial einen weiteren Klon zu erschaffen, sein Bewusstsein leer zu lassen und in diese Hülle das in dem Computer befindliche Zweite Ich Brolin zu transferieren. Zumindest technisch gelingt die Operation gelingt, allerdings scheint der Transfer von Brolins Bewusstsein nicht gelungen zu sein. Also schickt man den willenlosen Körper zu den Spezialtruppen, wo er zusammen mit anderen geklonten Kriegern ausgebildet werden soll. Jane Sagan wird seine neue Kommandantin – ein Charakter aus Scalzis erstem Roman -, während die verschiedenen Geheimdienste weiterhin mehr als ein Auge auf Brolin richten. Es besteht ja die wage Hoffnung, dass sich Brolins Geist doch noch regt. In einer Hommage an Dicks „A scanner darkly“ zeichnet sich nach und nach Brolins Bewusstsein in dem Klonkörper ab. Als sich der perfide Plan des Original Brolins allerdings – auch für den Leser - abzuzeichnen beginnt, sind die Militärs im ersten Augenblick überfordert, den Klon auf seinem Weg zu stoppen.
Noch mehr als in seinem ersten Roman differenziert Scalzi zwischen der klassischen Military Science Fiction Handlung und seiner Intention. Die Actionszenen sind von Beginn an kraftvoll geschrieben worden. Der Hang zum Waffenfetischismus ist allerdings deutlich spürbar und nur selten gelingt dem Autor die ironische Abkopplung von seinem Handlungsgeschehen. Dazu gehört unter anderem ein Teil der Ausbildung der seelenlosen Klone. Sie schauen sich unterschiedliche Science Fiction Streifen an. Neben tatsächlichen Verfilmungen wie „War of the Worlds“ – die Außerirdischen sind fies, nur das Ende unglaubwürdig – oder „Starshiptroopers“ – sehr gute Action aber zu viele fremde Begriffe – fügt John Scalzi in seine fast als Parodie zu wertende Aufstellung noch zwei fiktive Streifen ein. Deren Inhalt gibt er komprimiert wieder, kann sich aber einige Zwischentöne nicht verkneifen. Insbesondere der Hinweis auf „Ender´s Game“ , Orson Scott Cards hervorragenden Roman um einen Jungen, dem seine Unschuld und seine Jugend genommen worden ist, um die Erde vor fiesen außerirdischen Angreifern zu schützen, zeigt, welche Auffassung Scalzi zumindest im vorliegenden Roman vertritt.
Hinter der vordergründigen Handlung steht aber viel stärker eine Auseinandersetzung mit dem Recht auf ein eigenes Leben, eine eigene Persönlichkeit und damit verbunden, die Pflicht, eigene Entscheidung treffen zu dürfen und diese auch zu vertreten. Unabhängig von der strengen militärischen Hierarchie wird den Mitgliedern der Geister Brigade das Recht auf eine menschliche Existenz vom Augenblick ihrer künstlichen Erzeugung abgesprochen. Natürlich sind es Soldaten auf einer verzweifelten Mission, aber der Leser spürt ein ungutes Gefühl, wenn er der strengen Ausbildung folgt. Ganz bewusst stellt der Autor diese seelenlosen, aber bemitleidenswerten Kreaturen gegen die rücksichtslose, brutale und fremde Obin. Während die Mitglieder der Geister Brigade in erster Linie als verzweifelte letzte Front geschaffen worden sind, hat eine technologisch überlegene Rasse die Obin im Grunde nur aus wissenschaftlicher Experimentierfreude geschaffen. Damit schließt sich der Kreis. Beide Antagonisten sind unvollständig, die Geisterbrigade kennt nur die Existenz in ihrer streng militärischen Umgebung, den Obin fehlt es an Bewusstsein. Über ein Gewissen verfügen beide nicht. Sie führen ihren Krieg nicht aus Hass auf die anderen Rassen, sondern sie kennen nur den bewaffneten Konflikt, um ihre persönlichen Ziele zu erfüllen. Die Mitglieder der Geister Brigade kennen nur Angriff und Verteidigung, im Grunde sind beide Rassen nicht oder nicht mehr in der Lage, zu kommunizieren. Beide Gruppen haben keinen freien Willen und doch müssen sie den Pfad, den ihnen ihre Schöpfer vorgegeben haben, verlassen, um überleben zu können.
Scalzi lässt den einzelnen eindimensionalen Figuren – diese Charakterisierung ist pure Absicht und wirkt auch zu Gunsten des Romans – Raum, sich zu entwickeln, ihre Umgebung zum ersten Mal kennen zulernen. Nach der Hälfte des Buches macht er allerdings einen Kompromiss, wenn er Brolins Tochter Zoe einführt und damit sowohl den Helden als auch dem Bösewicht ein Handlungsschema vorgibt, das zu klar zu erkennen ist. Damit nimmt er seinem über weite Strecken sehr vielschichtig und interessant geschriebenen Roman ein wichtiges Überraschungselement und lenkt auf eine plumpe Art und Weise von seiner philosophisch erstaunlich tief schürfenden Intention ab. Im Vergleich zu anderen Military Science Fiction Autoren wie David Weber oder vor allem John Ringo, geht es ihm weniger um das grenzenlose Abenteuer zwischen den Sternen – dieses findet in einem ausreichenden Maße statt -, sondern er versucht vor diesem farbenprächtigen Hintergrund Themen anzusprechen, welche die heutigen Leser berühren sollen und können. In der Mitte des Buches beginnt er sich unwillkürlich zu fragen, wie viel Freiheit er selbst in seiner Umgebung hat und ob der freie Wille der einzige Maßstab ist, an dem sich die Entwicklungsfähigkeit einer ganzen Rasse ablesen lässt. Deutlich stringenter und homogener geschrieben als der „Krieg der Klone“ ist „Geisterbrigaden“ nicht nur ein vielschichtigerer, nuancierter Roman. Es werden viele Ideen des Erstlings aus einer neuen, interessanten Perspektive beleuchtet und wie schon eingangs erwähnt extrapoliert. Alleine diese Vorgehensweise hebt John Scalzi aus der Masse der Autoren heraus, die in ihren Endlos- Zyklen immer wieder die gleichen Ideen und plottechnisch Vorgänge abspulen.
John Scalzi: "Geisterbrigaden"
Roman, Softcover, 428 Seiten
Heyne- Verlag 2007
ISBN 3-4535-2268-0

Leserrezensionen
:: Im Moment sind noch keine Leserrezensionen zu diesem Buch vorhanden ::
:: Vielleicht möchtest Du ja der Erste sein, der hierzu eine Leserezension verfasst? ::
|