|
rezensiert von Thomas Harbach
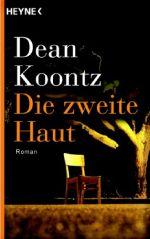 Fünfundfünfzig Romane mit einer Auflage von mehr als einhundert Millionen Büchern sind ein eindrucksvolles Ergebnis. Die Problematik von Bestsellerautoren spricht Koontz mehrmals im vorliegenden Buch an. Wieviel Publicity verträgt das eigene Ego, ab welchem Grad beginnt sich ein Autor vielleicht auch unbewusst zu verbiegen, um mehr Bücher zu verkaufen. Koontz gibt auf diese grundsätzlichen Fragen keine Antworten. Sein Roman ist ein inzwischen zu einem Synonym gewordener Koontz: rasante Unterhaltung gemischt mit originellen und überzeugenden Charakteren, aber keinem wirklich innovativen und überzeugenden Plot.
Fünfundfünfzig Romane mit einer Auflage von mehr als einhundert Millionen Büchern sind ein eindrucksvolles Ergebnis. Die Problematik von Bestsellerautoren spricht Koontz mehrmals im vorliegenden Buch an. Wieviel Publicity verträgt das eigene Ego, ab welchem Grad beginnt sich ein Autor vielleicht auch unbewusst zu verbiegen, um mehr Bücher zu verkaufen. Koontz gibt auf diese grundsätzlichen Fragen keine Antworten. Sein Roman ist ein inzwischen zu einem Synonym gewordener Koontz: rasante Unterhaltung gemischt mit originellen und überzeugenden Charakteren, aber keinem wirklich innovativen und überzeugenden Plot.
Dean Koontz inzwischen dreizehn Jahre alter Roman „Mr. Murder“ erscheint neu in einer einladend preiswerten Taschenbuchausgabe neu im Heyne- Verlag. Das Buch wurde Ende der neunziger Jahre als zweiteiliger TV- Movie verfilmt. Die Umsetzung von Koontz in seinen längeren Werken vorherrschendem oft verblüffend einfachen, aber packenden Stil, seinen überzeugend lebensecht charakterisierten eher gewöhnlichen Protagonisten und seine fast einzigartige Art, aus dem Nichts heraus selbst bei einer vorhersehbaren Handlung eine bedrohliche Atmosphäre zu erzeugen, lassen sich kaum adäquat umsetzen. Nur die Kombination dieser scheinbar widersprüchlichen Elemente macht den besonderen Reiz seiner Romane aus. Im Gegensatz zu Stephen King zeichnen sich seine Werke trotz übernatürlicher oder gerade wegen der dezenten Nutzung dieser Elemente durch eine Bodenständigkeit aus. Sofern möglich sucht Koontz die Erklärungen in einem wissenschaftlich fundierten Background und verzichtet auf effekthascherische Spielchen wie es King so meisterlich mit Autos, Gefrierschränken oder jetzt Handys versteht.
Beide Autoren stellen aber öfter Autoren in den Mittelpunkt ihrer Romane. Stephen Kings „The Dark Half“ gehört zu seinen empfehlenswerten Romanen und auf den ersten vielleicht einhundertsiebzig Seiten hat der Leser das Gefühl, eine intelligente Variation des King´schen Stoffs vorzufinden. Während King die Bedrohung als eine Inkarnation unterdrückter innerer Werte sieht, findet sich bei Koontz eine eher bodenständige, utopische und damit greifbarere Lösung. Im Gegensatz zu King, dessen längere Arbeiten sich inzwischen durch eine gewisse Zügellosigkeit in Struktur und Handlung negativ auszeichnen, verknüpft Koontz oft verschiedene Thematiken zu einem komplexen, aber sehr gut strukturierten Roman. Kaum ist der Leser der Ansicht, der Spur des Stoffes folgen zu können, wendet Koontz sehr überraschend den bisherigen Themenaufbau und setzt sich in diesem Fall mit unethischen Wissenschaftlern und Klonigprozessen, sowie militärischer Forschung durch privat finanzierte radikale Gruppen demokratischer Gesellschaften auseinander.
Im Mittelpunkt seines Romans steht der Krimischriftsteller Marty Stillwater. Seine letzten Romane haben sich gut verkauft, die Arbeit am neusten Buch geht gut voran, Hollywood hat noch nicht angerufen. Er lebt mit seinen beiden Töchtern und seiner attraktiven Frau in einem kleinen Haus in einem Vorort. Sein geordnetes, friedliches und schönes Leben erhält einen ersten Bruch, als er feststellt, dass er beim Diktieren eines Briefes sieben Minuten lang die beiden Worte „Ich muß“ ins Diktaphon gesprochen hat. Obwohl ihn sein Arzt für gesund erklärt, bleibt Marty misstrauisch. Bei der Rückkehr vom Arztbesuch begegnet er in seinem Haus einem Einbrecher, einem Ebenbild seiner Selbst. In einer Parallelhandlung hat Koontz diesen namenlosen Profikiller in die Handlung eingeführt. Dieser beginnt nach seinem letzten Auftrag die Suche nach einer eigenen Identität und wird von Marty Stillwater und seiner Familie wie ein Magnet angezogen. Er glaubt, wenn er Martys Position einnimmt, seine Persönlichkeit finden zu können. Der Angriff auf den Autoren gelingt nicht ganz. Im Kampf wird der Fremde schwer verwundet und kann fliehen. Tief erschüttert bleibt der Theoretiker zurück und ahnt nicht, wie hartnäckig der Feind sein kann. Stillwater entschließt sich, mit seiner Familie zu fliehen.
Koontz Stärke liegt in der Charakterisierung seiner Protagonisten. Mit liebevollen Details beschreibt er eine Vorzeigefamilie. Er bemüht sich, diese Charaktere sehr dreidimensional und überzeugend zu entwickeln. Als Übervater gibt er ihnen eine Historie. Dabei wirken seine Ansätze an einigen Stellen zu perfekt und erscheinen konstruiert. Wenig überzeugend sind dabei die inneren Monologe Stillwaters. Es wäre interessanter gewesen, der Familie einige dunklere Strukturen zu geben. Beispielhaft Erziehungs – oder Beziehungsprobleme oder materielle Ängste. Dadurch hätten die einzelnen Familienmitglieder wieder zu einer Einheit werden können und sich auf das wirklich wichtige im Leben konzentrieren können. So wirkt alles zuckersüß und in diese Perfektion dringt der perfekte Killer ein. Der Kontrast könnte nicht größer sein. Durch die fehlenden inneren Konflikte ist Koontz im ersten Drittel des Buches angewiesen, eine Parallelhandlung zu montieren und den namenlosen Killer als denkendes Wesen ohne Vergangenheit einzuführen. Das funktioniert nur selten effektiv, da der Leser nicht in der Lage ist, eine wirklich Beziehung zu ihm – oft positiv oder negativ sei dahingestellt – aufzunehmen. Während die Stillwaters in warmen Farben fast grell auf die Seiten gemalt worden sind, wirkt der Antagonist farblos. Die Handlung macht beim Zusammentreffen der beiden Handlungsstränge einen rasanten Sprung. Die erste Konfrontation zwischen Marty Stillwater und seinem anonymen Gegner ist beängstigend effektiv und dramatisch sehr gut in Szene gesetzt. Das Eindringen in die Privatsphäre, das Durchsuchen der persönlichen Gegenstände und das Töten der Haustiere tragen verstörende Züge in sich.
Leider, aber unausweichlich beginnt Konntz dann mit einer weiteren Handlungsebene. Diese enthält die Erklärungen für die Ähnlichkeit dieser beiden „Menschen“. Damit geht allerdings auch der Roman einen Schritt zurück. Koontz hat seine Leser sehr geschickt manipuliert und liefert jetzt eine eher science fiction mäßige Erläuterung hinterher. Der Attentäter Alphie ist Martys Klon. Das Netzwerk, eine faschistische geheime Untergrundorganisation hat ihn als Prototyp entwickelt, um nach der Weltherrschaft zu greifen. Ausgestattet in bester Terminatoranlehnung verfügt er auf gutes Heilfleisch und übermenschliche Kraft. Im Geheimen haben die Wissenschaftler des Netzwerkes ihn aber auch mit einem emotionalen Zentrum – von Seele oder Identität zu sprechen, wäre etwas zu hoch gegriffen – ausgestattet. Aus dem Nichts heraus ist Alphie der Meinung, sein Original hätte ihm das Leben gestohlen und er könnte mit Martys Tötung seinen Platz in der Familie einnehmen und dessen Leben annehmen.
Interessant ist der Kontrast zwischen den beiden Ebenbildern. Alphie hat sich sein Leben aus dem Kino gesaugt- zwischen den Mordanschlägen verbringt er am liebsten seine Zeit im Kino oder vor dem Fernseher und verwandelt die unterschiedlichen Illusionen in eine für seine Umwelt gefährliche Halbwahrheit. Fast rührend beschreibt Koontz, wie Alphie seinen unterschiedlichen Leinwandidolen nacheifert – die entsprechenden Filmtitel werden mitgeliefert – und mit den unterschiedlichsten Frauen der glitzernden Hollywoodwelt schläft oder eine Familie gründet.
Marty steht dagegen für die Büchermenschen. Er sieht Literatur jeglicher Art als Ausgleich zu Krisensituationen. Zu seinem täglichen Ritual gehört es, selbst geschriebene Geschichten oder Gedichte seinen beiden Töchtern vor dem Schlafengehen vorzulesen. Diese Szenen drücken die Homogenität der Familie aus. Koontz löst die schwierigste Situation des Buches sehr geschickt auf. Oft wirken Kinder nicht sonderlich überzeugend oder ihr Handeln wirkt unglaubwürdig. Der Autor arbeitet hier auf zwei Ebenen. In den familiären Abschnitten gibt er den beiden Mädchen durchaus ein gut beschriebenes und nachvollziehbares Eigenleben. Koontz bemüht sich, im Rahmen der Bedrohung nicht auf Klischees auszuweichen. In den Kampfszenen dagegen treten die Mädchen gänzlich in den Hintergrund.
Neben den Stillwaters und Alphie führt Koontz noch ein Suchteam des Netzwerkes ein. Dessen finstere, verschwörerischere Absichten werden nur durch Beschreibungen, aber nicht direkte Taten beleuchtet. Viele Verbindungen zwischen den Stillwaters und dem Klon halten einer genaueren Beobachtung nicht stand und wirken eher bemüht. Latente übernatürliche Kräfte zusätzlich zum fast unbesiegbaren Körper und die Transformation zu einem Terminatorähnlichen Geschöpf im Endkampf wirken übertrieben und bemüht.
Interessanterweise verwendet Koontz den schon angesprochenen Dopplereffekt Bücher- Filmmenschen auch bei den Mitgliedern des Netzwerkes. Filmmenschen gegen Buchmenschen. Das implizierte Urteil wirkt ein wenig sehr verwegen und die gesellschaftliche Kritik – einschließlich der Medien, die grell und einseitig dargestellt werden – holzhammerartig und im Vergleich zur laufenden Handlung steif.
„Die zweite Haut“ ist auch in erster Linie eine zwar cineastische geschriebene packende Story, aber eignet sich aufgrund der umfangreichen psychologisch interessanten Charakterisierung weder für die große Leinwand noch den Bildschirm. Den vielfältigen, manchmal sehr brutalen und in Hollywoodmanier überdrehten Actionszenen stehen ruhige, stilistisch ausgefeilte und auch in der guten Übersetzung durch Joachim Körber spürbare Passagen gegenüber. Der Höhepunkt des Buches ist eine Hommage an Hitchcocks „Vertigo“ – wahrscheinlich dessen ultimativer Film zu Dopplereffekten.
Dean Koontz ist ein Autor, der packend schreiben kann. Das zeigt sich am vorliegenden Roman, in welchem er eine schon vor dreizehn Jahren angestaubte Idee zu neuem Leben erweckt und ohne auf technische Ausreden zurückzufallen, eine spannende, über weite Strecken packende utopisch angehauchte Gruselmär schreibt.
Dean Koontz: "Die zweite Haut"
Roman, Softcover
Heyne 2005
ISBN 3-4537-2101-2

Leserrezensionen
:: Im Moment sind noch keine Leserrezensionen zu diesem Buch vorhanden ::
:: Vielleicht möchtest Du ja der Erste sein, der hierzu eine Leserezension verfasst? ::
|