|
Zoom |
|||
|
Literatur im Lichthof - Zoom
|
|||
zoom.html - zoom.html
 Eine Japanerin, eine Amerikanerin, Fukushima und dann auch noch zweisprachig Deutsch-Englisch – mitten in Tirol? Das macht neugierig.
Eine Japanerin, eine Amerikanerin, Fukushima und dann auch noch zweisprachig Deutsch-Englisch – mitten in Tirol? Das macht neugierig.  Die „Bauerngeschichte zwischen Tirol und Spanien“, die „Gschicht'“, wie sie die Hauptfigur Max Bair nennt, ist in den Augen derselben im Grunde relativ schnell erzählt: Er hat halt seine Küh' verkauft und ist nach Spanien gefahren, um im Bürgerkrieg zu kämpfen. Gut, das ist arg knapp, aber nach einigem Nachfragen kann Egon Erwin Kischs literarisches Reporter-Alter-Ego dem Wortkargen über die „Gschicht'“ weitere Details entlocken: Max Bair, ein junger Wipptaler Bauer, erbt in der Zwischenkriegszeit den elterlichen Hof, wobei das ohnehin überschuldete Anwesen vom Onkel verwaltet wird, weil die Geschwister noch minderjährig sind. Wegen dessen Misswirtschaft und Trunksucht gerät das Anwesen allerdings in noch stärkere wirtschaftliche Schwierigkeiten. Als Bair mit zwanzig Jahren den Hof übernehmen kann, bessert sich die Situation nicht; der junge Bauer muss Schulden machen, um Vieh zu kaufen. Über den Knotzer Johann, einen Arbeiter der Wildbachverbauung, kommt Bair in Kontakt mit sozialistischem Gedankengut, organisiert mit Gleichgesinnten Leseabende, liest illegale Zeitungen, erfährt dort unter anderem auch von der Sowjetunion und von Spanien, und schließlich keimt der Gedanke, die Heimat hinter sich zu lassen, in den Männern auf. 1937 gibt Bair seine bäuerliche Existenz in Tirol auf, treibt seine drei Kühe (die „Graue“, die „Moltl“ und die „Schwarze“) auf den Markt und veräußert die Tiere. Er fährt mit dem Erlös und einigen Freiwilligen zunächst nach Paris und dann weiter nach Spanien, wo sich die jungen Männer im Bürgerkrieg den Internationalen Brigaden im Kampf gegen Francos Truppen anschließen. Bair wird einige Tage lang ausgebildet, in einem Gefecht schwer verwundet, kann aber von seinen Kameraden gerettet werden.
Die „Bauerngeschichte zwischen Tirol und Spanien“, die „Gschicht'“, wie sie die Hauptfigur Max Bair nennt, ist in den Augen derselben im Grunde relativ schnell erzählt: Er hat halt seine Küh' verkauft und ist nach Spanien gefahren, um im Bürgerkrieg zu kämpfen. Gut, das ist arg knapp, aber nach einigem Nachfragen kann Egon Erwin Kischs literarisches Reporter-Alter-Ego dem Wortkargen über die „Gschicht'“ weitere Details entlocken: Max Bair, ein junger Wipptaler Bauer, erbt in der Zwischenkriegszeit den elterlichen Hof, wobei das ohnehin überschuldete Anwesen vom Onkel verwaltet wird, weil die Geschwister noch minderjährig sind. Wegen dessen Misswirtschaft und Trunksucht gerät das Anwesen allerdings in noch stärkere wirtschaftliche Schwierigkeiten. Als Bair mit zwanzig Jahren den Hof übernehmen kann, bessert sich die Situation nicht; der junge Bauer muss Schulden machen, um Vieh zu kaufen. Über den Knotzer Johann, einen Arbeiter der Wildbachverbauung, kommt Bair in Kontakt mit sozialistischem Gedankengut, organisiert mit Gleichgesinnten Leseabende, liest illegale Zeitungen, erfährt dort unter anderem auch von der Sowjetunion und von Spanien, und schließlich keimt der Gedanke, die Heimat hinter sich zu lassen, in den Männern auf. 1937 gibt Bair seine bäuerliche Existenz in Tirol auf, treibt seine drei Kühe (die „Graue“, die „Moltl“ und die „Schwarze“) auf den Markt und veräußert die Tiere. Er fährt mit dem Erlös und einigen Freiwilligen zunächst nach Paris und dann weiter nach Spanien, wo sich die jungen Männer im Bürgerkrieg den Internationalen Brigaden im Kampf gegen Francos Truppen anschließen. Bair wird einige Tage lang ausgebildet, in einem Gefecht schwer verwundet, kann aber von seinen Kameraden gerettet werden. Japanische Impressionen – bei Toni Kleinlercher werden sie Takes genannt. Einmal abgesehen von den jüngsten Eindrücken eines zerstörten rauchenden Reaktors am Meeresstrand von Fukushima hat fast jeder westliche Mensch ein paar Japanbilder in sich gespeichert: eine traditionelle Robe oder das schwarze hochgesteckte Haar einer Geisha, bunte, mit schönen Schriftzeichen gezierte Lampions, ein gepudertes Gesicht, ein Shinto-Schrein, kleinschrittiges Laufen in Holzpantinen oder die höfliche Verneigung eines Geschäftsmannes. Andererseits ganz zeitgenössisch: Hochbahnen und überfüllte U-Bahnen, das der Stadt übergestülpte grelle Reklamegewand, die gebleichten und anschließend hennagefärbten Haare junger Leute, in den Konsumtempeln Sony, Honda, Toyota usw.
Japanische Impressionen – bei Toni Kleinlercher werden sie Takes genannt. Einmal abgesehen von den jüngsten Eindrücken eines zerstörten rauchenden Reaktors am Meeresstrand von Fukushima hat fast jeder westliche Mensch ein paar Japanbilder in sich gespeichert: eine traditionelle Robe oder das schwarze hochgesteckte Haar einer Geisha, bunte, mit schönen Schriftzeichen gezierte Lampions, ein gepudertes Gesicht, ein Shinto-Schrein, kleinschrittiges Laufen in Holzpantinen oder die höfliche Verneigung eines Geschäftsmannes. Andererseits ganz zeitgenössisch: Hochbahnen und überfüllte U-Bahnen, das der Stadt übergestülpte grelle Reklamegewand, die gebleichten und anschließend hennagefärbten Haare junger Leute, in den Konsumtempeln Sony, Honda, Toyota usw.  Man darf sich diesen Samuel Finley Morse nicht als Gegenteil eines John Franklin vorstellen: Der eine überwindet, der andere entdeckt die Langsamkeit. Der eine versucht im reißenden Druck des Zeitstroms zu überholen, der andere schwimmt gegen ihn an. Allein mit solcher Beschreibung geraten Bild- und Sinnhaftigkeit aneinander. Was bleibt, sind zwei Buchtitel: jener geniale, „Die Entdeckung der Langsamkeit“, von Sten Nadolnys Welterfolg über den englischen Seefahrer und Nordpolforscher, und der darauf anspielende, „Die Überwindung der Langsamkeit“, von Margit Knapps Biografie des „Begründers der modernen Kommunikation“, so der Untertitel.
Man darf sich diesen Samuel Finley Morse nicht als Gegenteil eines John Franklin vorstellen: Der eine überwindet, der andere entdeckt die Langsamkeit. Der eine versucht im reißenden Druck des Zeitstroms zu überholen, der andere schwimmt gegen ihn an. Allein mit solcher Beschreibung geraten Bild- und Sinnhaftigkeit aneinander. Was bleibt, sind zwei Buchtitel: jener geniale, „Die Entdeckung der Langsamkeit“, von Sten Nadolnys Welterfolg über den englischen Seefahrer und Nordpolforscher, und der darauf anspielende, „Die Überwindung der Langsamkeit“, von Margit Knapps Biografie des „Begründers der modernen Kommunikation“, so der Untertitel. Große Romane müssen nicht lang und schon gar nicht langwierig sein! Ein beeindruckender Erzählfluss, ein Strom, der diejenigen, die sich hineinwerfen, mit sich reißt. So lässt sich der neue Roman von Martin Kolozs, erschienen 2012 im mitter|verlag, wohl am ehesten beschreiben.
Große Romane müssen nicht lang und schon gar nicht langwierig sein! Ein beeindruckender Erzählfluss, ein Strom, der diejenigen, die sich hineinwerfen, mit sich reißt. So lässt sich der neue Roman von Martin Kolozs, erschienen 2012 im mitter|verlag, wohl am ehesten beschreiben.  Buchtitel können ganz schlimm sein. Sie können in die Irre führen, sie können viel zu gewollt sein und manchmal versprechen sie einfach viel zu viel. Selten treffen sie den Nagel auf den Kopf. Im Falle von Markus Koschuhs gesammelten Poetry-Slam-Texten, die jetzt im Haymon Verlag erschienen sind, ist das anders. Gut, der Autor, der auf dem Cover in weißem Feinripp-Unterhemd und offener Jacke schief in die Kamera blickt, sieht ein wenig fertig aus. Davon darf man sich nicht irritieren lassen, das Stilmittel heißt Ironie, das ist Teil der Inszenierung. Er soll nicht so aussehen, wie man sich einen Mann vorstellt, der sagt, was der Titel sagt: „Voulez-vous KOSCHUH avec moi?“ Das sitzt. Und zwar tatsächlich, denn schließlich geht es bei Poetry Slams ja genau darum, die „Gunst“ des Publikums zu erwerben, das Publikum zu „verführen“ – zu applaudieren, mehr als bei den anderen literarischen Mitwerbern, sodass man am Ende siegt.
Buchtitel können ganz schlimm sein. Sie können in die Irre führen, sie können viel zu gewollt sein und manchmal versprechen sie einfach viel zu viel. Selten treffen sie den Nagel auf den Kopf. Im Falle von Markus Koschuhs gesammelten Poetry-Slam-Texten, die jetzt im Haymon Verlag erschienen sind, ist das anders. Gut, der Autor, der auf dem Cover in weißem Feinripp-Unterhemd und offener Jacke schief in die Kamera blickt, sieht ein wenig fertig aus. Davon darf man sich nicht irritieren lassen, das Stilmittel heißt Ironie, das ist Teil der Inszenierung. Er soll nicht so aussehen, wie man sich einen Mann vorstellt, der sagt, was der Titel sagt: „Voulez-vous KOSCHUH avec moi?“ Das sitzt. Und zwar tatsächlich, denn schließlich geht es bei Poetry Slams ja genau darum, die „Gunst“ des Publikums zu erwerben, das Publikum zu „verführen“ – zu applaudieren, mehr als bei den anderen literarischen Mitwerbern, sodass man am Ende siegt.  “Sie verstehe, sie müsse zu dem stehen, was gewesen war. Deshalb rede sie jetzt. Reden tue ihr gut“ (290), so die Worte aus der Perspektive der Protagonistin Hanna in Anna Maria Leitgebs Roman Mutter der sieben Schmerzen. Als Zugreisende erzählt sie ihre Lebensgeschichte im Rückblick und im Anschluss daran will sie „nur mehr aus dem Fenster schauen“ (299). Was sie erfahren hat, sind lieblose Zeiten, zwei Weltkriege, den Verlust ihres Mannes und beinahe aller Kinder, die Armut, wenig Unterstützung von Seiten der Mitmenschen, dagegen viel Entwürdigung. Sie ist mit zahlreichen Stigmata behaftet – ein außereheliches Kind von einem „Karrner“ macht sie im Südtiroler Dorf Stallbach zur Hure; nach dem Tod ihres Mannes, der, infiziert mit Tuberkulose und geplagt von zahlreichen unverarbeiteten Erfahrungen, vom Krieg heimkehrt, werden ihr die noch verbliebenen Kinder entzogen; mehrere sind bereits im Kindesalter verstorben. Auch den Kindern widerfährt nichts Gutes: Verachtung, Hungersnot, Misshandlung, Vergewaltigung. Martha nimmt sich schließlich selbst das Leben, Nannele stirbt im Heim an Bronchitis und Anton fällt während des Zweiten Weltkrieges in Finnland. Lediglich Kurt wird später mit Hilfe eines deutsch-englischen Paares ein Pharmaziestudium absolvieren können.
“Sie verstehe, sie müsse zu dem stehen, was gewesen war. Deshalb rede sie jetzt. Reden tue ihr gut“ (290), so die Worte aus der Perspektive der Protagonistin Hanna in Anna Maria Leitgebs Roman Mutter der sieben Schmerzen. Als Zugreisende erzählt sie ihre Lebensgeschichte im Rückblick und im Anschluss daran will sie „nur mehr aus dem Fenster schauen“ (299). Was sie erfahren hat, sind lieblose Zeiten, zwei Weltkriege, den Verlust ihres Mannes und beinahe aller Kinder, die Armut, wenig Unterstützung von Seiten der Mitmenschen, dagegen viel Entwürdigung. Sie ist mit zahlreichen Stigmata behaftet – ein außereheliches Kind von einem „Karrner“ macht sie im Südtiroler Dorf Stallbach zur Hure; nach dem Tod ihres Mannes, der, infiziert mit Tuberkulose und geplagt von zahlreichen unverarbeiteten Erfahrungen, vom Krieg heimkehrt, werden ihr die noch verbliebenen Kinder entzogen; mehrere sind bereits im Kindesalter verstorben. Auch den Kindern widerfährt nichts Gutes: Verachtung, Hungersnot, Misshandlung, Vergewaltigung. Martha nimmt sich schließlich selbst das Leben, Nannele stirbt im Heim an Bronchitis und Anton fällt während des Zweiten Weltkrieges in Finnland. Lediglich Kurt wird später mit Hilfe eines deutsch-englischen Paares ein Pharmaziestudium absolvieren können. Dass Staunen nicht zwangsläufig den Beginn des Philosophierens bedeutet, lässt sich gut an einem Sammelband nachweisen, der auf Initiative der Schule für Dichtung in Wien entstanden ist. Das Verhängnis begann damit, dass Christian Ide Hintze vor dem Goldenen Dachl in Innsbruck stand und plötzlich „dieses schriftband“ sah. Es ist Teil eines Reliefs und ist mit Schriftzeichen bedeckt, die seit den fünfhundert Jahren des Bestehens, seit Maximilians Zeiten also, noch niemand entziffern konnte. Das liegt vermutlich daran, dass es sich um willkürlich gesetzte fiktive Zeichen handelt, denen kein Sinn unterlegt werden kann. Christian Ide Hintze jedenfalls ließ dieses Band nicht los, und er setzte eine Internetklasse darauf an, Gedichte zu verfassen zur Deutung der Zeichen. Und das war definitiv keine gute Idee.
Dass Staunen nicht zwangsläufig den Beginn des Philosophierens bedeutet, lässt sich gut an einem Sammelband nachweisen, der auf Initiative der Schule für Dichtung in Wien entstanden ist. Das Verhängnis begann damit, dass Christian Ide Hintze vor dem Goldenen Dachl in Innsbruck stand und plötzlich „dieses schriftband“ sah. Es ist Teil eines Reliefs und ist mit Schriftzeichen bedeckt, die seit den fünfhundert Jahren des Bestehens, seit Maximilians Zeiten also, noch niemand entziffern konnte. Das liegt vermutlich daran, dass es sich um willkürlich gesetzte fiktive Zeichen handelt, denen kein Sinn unterlegt werden kann. Christian Ide Hintze jedenfalls ließ dieses Band nicht los, und er setzte eine Internetklasse darauf an, Gedichte zu verfassen zur Deutung der Zeichen. Und das war definitiv keine gute Idee.  „Ich will die Hilfe von Vordenkern annehmen“ (S. 8), schreibt Angelika Rainer im ersten lyrischen Stück ihres aktuellen Buches „Odradek“ (Haymon 2012). Odradek, so nennt sich das gesichtslose Zwirnspulenwesen, das Franz Kafka in der kurzen Erzählung „Die Sorge des Hausvaters“ beschreibt. Wie schon ihrem Debüt, der lyrischen Erzählung Luciferin (hier ging die Autorin von der Erzählung „Die drei Leben der Lucie Cabrol“ aus), legt Angelika Rainer auch ihrem zweiten Buch einen Referenztext zu Grunde. Als flinkes, außerordentlich bewegliches Wesen wird Odradek von Kafka beschrieben, das als Ganzes „zwar sinnlos“ erscheint, „aber in seiner Art abgeschlossen“ ist. Auf dem Dachboden, im Treppenhaus, auf den Gängen oder im Flur des Hausvaters, ist Odradek die meiste Zeit anzutreffen, wenn er sich nicht gerade in anderen Häusern herumtreibt. Manchmal, so heißt es bei Kafka, überkommt einen die Lust, das Wesen anzusprechen. Hier setzt Angelika Rainers Auseinandersetzung in Form lyrischer Prosaskizzen mit dem kafkaschen Geschöpf ein: „Unterredung (Der Hausvater spricht zu Odradek.)“ nennt sie den ersten Abschnitt ihres Bandes. Es folgen die Kapitel „Nachtstücke (Odradek erzählt.)“, „Von der Seele (ein Auge allein zu klein es zu fassen“ und „Coda“, die im Buch jeweils mit Zitaten aus Kafkas Erzählung versehen sind, mit Ausnahme des Abschnitts „Coda“, der von einem Ausschnitt aus dem Gedicht „Dunkles Aug im September“ von Paul Celan eingeleitet wird.
„Ich will die Hilfe von Vordenkern annehmen“ (S. 8), schreibt Angelika Rainer im ersten lyrischen Stück ihres aktuellen Buches „Odradek“ (Haymon 2012). Odradek, so nennt sich das gesichtslose Zwirnspulenwesen, das Franz Kafka in der kurzen Erzählung „Die Sorge des Hausvaters“ beschreibt. Wie schon ihrem Debüt, der lyrischen Erzählung Luciferin (hier ging die Autorin von der Erzählung „Die drei Leben der Lucie Cabrol“ aus), legt Angelika Rainer auch ihrem zweiten Buch einen Referenztext zu Grunde. Als flinkes, außerordentlich bewegliches Wesen wird Odradek von Kafka beschrieben, das als Ganzes „zwar sinnlos“ erscheint, „aber in seiner Art abgeschlossen“ ist. Auf dem Dachboden, im Treppenhaus, auf den Gängen oder im Flur des Hausvaters, ist Odradek die meiste Zeit anzutreffen, wenn er sich nicht gerade in anderen Häusern herumtreibt. Manchmal, so heißt es bei Kafka, überkommt einen die Lust, das Wesen anzusprechen. Hier setzt Angelika Rainers Auseinandersetzung in Form lyrischer Prosaskizzen mit dem kafkaschen Geschöpf ein: „Unterredung (Der Hausvater spricht zu Odradek.)“ nennt sie den ersten Abschnitt ihres Bandes. Es folgen die Kapitel „Nachtstücke (Odradek erzählt.)“, „Von der Seele (ein Auge allein zu klein es zu fassen“ und „Coda“, die im Buch jeweils mit Zitaten aus Kafkas Erzählung versehen sind, mit Ausnahme des Abschnitts „Coda“, der von einem Ausschnitt aus dem Gedicht „Dunkles Aug im September“ von Paul Celan eingeleitet wird. 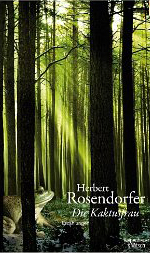 Rosenbach ist eine Künstlerin und Beuys-Schülerin, Rosenberg, Alfred, ab 1923 Leiter des „Völkischen Beobachters“, die Rosenbürstenhornwespe etwa 1 cm groß und Herbert Rosendorfer Schriftsteller und Jurist. Diese zufällige Reihenfolge sieht Band 12 des Brockhaus 1998 vor. Der Stein-Satz „Rose is a rose is a rose is a rose“ hat nichts von dieser Zufälligkeit, und auf ihn anspielend könnte man durchaus (und nicht zufällig) den Grund-Satz „Rosendorfer is a Rosendorfer is a Rosendorfer is a Rosendorfer“ prägen. Er trifft zu. Seit Rosendorfers erste Erzählung Die Glasglocke 1956 in Wort im Gebirge veröffentlicht wurde, sind viele Bücher dieses Autors erschienen, bis hin zum vorliegenden postumen Erzählungsband vom Oktober 2012. Dass dieses letzte Buch, Die Kaktusfrau, ein echter Rosendorfer ist, so echt, wie es Die Glasglocke Jahrzehnte früher war, ist unverkennbar. Rosendorfers Kaktusfrau hat so richtig gar nichts von einer Esther Greenwood, jener literarischen Figur, die in der Glasglocke eine Rolle spielt, aber eben in einer ganz anderen…
Rosenbach ist eine Künstlerin und Beuys-Schülerin, Rosenberg, Alfred, ab 1923 Leiter des „Völkischen Beobachters“, die Rosenbürstenhornwespe etwa 1 cm groß und Herbert Rosendorfer Schriftsteller und Jurist. Diese zufällige Reihenfolge sieht Band 12 des Brockhaus 1998 vor. Der Stein-Satz „Rose is a rose is a rose is a rose“ hat nichts von dieser Zufälligkeit, und auf ihn anspielend könnte man durchaus (und nicht zufällig) den Grund-Satz „Rosendorfer is a Rosendorfer is a Rosendorfer is a Rosendorfer“ prägen. Er trifft zu. Seit Rosendorfers erste Erzählung Die Glasglocke 1956 in Wort im Gebirge veröffentlicht wurde, sind viele Bücher dieses Autors erschienen, bis hin zum vorliegenden postumen Erzählungsband vom Oktober 2012. Dass dieses letzte Buch, Die Kaktusfrau, ein echter Rosendorfer ist, so echt, wie es Die Glasglocke Jahrzehnte früher war, ist unverkennbar. Rosendorfers Kaktusfrau hat so richtig gar nichts von einer Esther Greenwood, jener literarischen Figur, die in der Glasglocke eine Rolle spielt, aber eben in einer ganz anderen… Zwei Kapitel lang sieht es fast so aus, als ob Durnitalien wirklich ein Roman sei - ein satirischer Roman, wie der Untertitel suggeriert, und wie man es sich von Helmuth Schönauer erwartet.
Zwei Kapitel lang sieht es fast so aus, als ob Durnitalien wirklich ein Roman sei - ein satirischer Roman, wie der Untertitel suggeriert, und wie man es sich von Helmuth Schönauer erwartet.  Bereits 2011 ist im Bozener Verlag Edition Raetia ein Roman von Renate Scrinzi erschienen, der es allemal verdient, bekannt gemacht zu werden: „Und Emilio lächelt“. Er beginnt mit einem Zitat von und einem Hinweis auf Emil Zátopek (1922-2000), einem siegreichen tschechoslowakischen Langstreckenläufer, der sich während des Prager Frühlings verdient gemacht hat – eine erste historische Verortung. Darauf öffnet sich ein Rahmen um die Figur des Emilio, der sich 2001 auf einer Reise befindet, deren Ziel er nicht kennt und die am Ende des Buches wiederaufgenommen werden wird. Es folgen Tagebucheinträge eines deutschen Offiziers aus den Jahren 1942-1943, der Emilios Erzeuger genannt wird. Erst dann setzt unter dem Kapitelnamen „Anfang“ die Erzählung um Emilio selbst in vier Teilen ein, beginnend mit seiner Geburt 1945. Ein Junge, der ohne Vater aufwachsen wird, denn niemand außer seiner Mutter Angelina wird jemals wissen, wer sein Vater ist. Emilio ist ein Kind der reinsten Liebe, mit einem Merkmal ausgestattet, das ihm Herzen zufliegen lässt und ihm seinen Kosenamen „Sole“ einbringt. „Er kann sein Lächeln anknipsen, wenn ihn etwas überrascht. Spontane Freude zum Beispiel. Dann wieder knipst er es plötzlich und unerwartet aus. Die Welt hat keinen Anfang. Die Leute keine Ahnung. Da wird es dunkel und er selbst ist nicht mehr da. Nur wenn er lächelt, ist er da. Flüchtiger Moment des Glücks ohne fremde Zutaten.“ Wenn Emilio lächelt, wird es hell. „Ganz nach innen geht es dann, dieses Lächeln, und Soles ganze Gestalt taucht darin ein.“ Dieses Lächeln erleuchtet Räume und Menschen, aber er „macht“ nichts Besonderes daraus, es scheint fast unabhängig von ihm zu sein.
Bereits 2011 ist im Bozener Verlag Edition Raetia ein Roman von Renate Scrinzi erschienen, der es allemal verdient, bekannt gemacht zu werden: „Und Emilio lächelt“. Er beginnt mit einem Zitat von und einem Hinweis auf Emil Zátopek (1922-2000), einem siegreichen tschechoslowakischen Langstreckenläufer, der sich während des Prager Frühlings verdient gemacht hat – eine erste historische Verortung. Darauf öffnet sich ein Rahmen um die Figur des Emilio, der sich 2001 auf einer Reise befindet, deren Ziel er nicht kennt und die am Ende des Buches wiederaufgenommen werden wird. Es folgen Tagebucheinträge eines deutschen Offiziers aus den Jahren 1942-1943, der Emilios Erzeuger genannt wird. Erst dann setzt unter dem Kapitelnamen „Anfang“ die Erzählung um Emilio selbst in vier Teilen ein, beginnend mit seiner Geburt 1945. Ein Junge, der ohne Vater aufwachsen wird, denn niemand außer seiner Mutter Angelina wird jemals wissen, wer sein Vater ist. Emilio ist ein Kind der reinsten Liebe, mit einem Merkmal ausgestattet, das ihm Herzen zufliegen lässt und ihm seinen Kosenamen „Sole“ einbringt. „Er kann sein Lächeln anknipsen, wenn ihn etwas überrascht. Spontane Freude zum Beispiel. Dann wieder knipst er es plötzlich und unerwartet aus. Die Welt hat keinen Anfang. Die Leute keine Ahnung. Da wird es dunkel und er selbst ist nicht mehr da. Nur wenn er lächelt, ist er da. Flüchtiger Moment des Glücks ohne fremde Zutaten.“ Wenn Emilio lächelt, wird es hell. „Ganz nach innen geht es dann, dieses Lächeln, und Soles ganze Gestalt taucht darin ein.“ Dieses Lächeln erleuchtet Räume und Menschen, aber er „macht“ nichts Besonderes daraus, es scheint fast unabhängig von ihm zu sein. Mit dem Superlativ sollte man vorsichtig umgehen; aber wo er angebracht ist, muss man ihn doch bemühen, und in diesem Fall ist er angebracht: Die beiden Erzählungen, die Zoderer in diesem Band zusammengestellt hat, gehören ganz bestimmt zu seinen schönsten Prosatexten. In beiden Erzählungen setzt Zoderer ein Denkmal: in dem einen seinem Bruder, in dem andern seinem besten Freund; und er setzt – wirklich unentwegt darauf bedacht, wie am besten zu erzählen wäre – auf Genauigkeit, auf die akribische Wahrnehmung unterschiedlicher Identitätsentwürfe und auf die unablässige scharfe Beobachtung einer jeden, das heißt: auch der eigenen Stimme. So hat es schon Tumler gehalten, der väterliche Freund des Autors, jedenfalls seit den späten fünfziger Jahren, in der Überzeugung (oder wenigstens: in der Hoffnung), damit künftig allen ideologischen Verlockungen und Fallen souverän entkommen zu können. Zoderers Erzähler hält es ganz ähnlich, in seinem Fall: um den Figuren nie Unrecht zu tun, beispielsweise durch Behauptungen, die womöglich am Ende nur der Selbstbehauptung des Ich-Erzählers dienen. Er stellt vielmehr ständig in Frage, was er berichtet, er stellt seine eigene Position also am schärfsten in Frage; so überschreiten denn auch die beiden Erzählungen permanent die Grenze zur Autobiographie.
Mit dem Superlativ sollte man vorsichtig umgehen; aber wo er angebracht ist, muss man ihn doch bemühen, und in diesem Fall ist er angebracht: Die beiden Erzählungen, die Zoderer in diesem Band zusammengestellt hat, gehören ganz bestimmt zu seinen schönsten Prosatexten. In beiden Erzählungen setzt Zoderer ein Denkmal: in dem einen seinem Bruder, in dem andern seinem besten Freund; und er setzt – wirklich unentwegt darauf bedacht, wie am besten zu erzählen wäre – auf Genauigkeit, auf die akribische Wahrnehmung unterschiedlicher Identitätsentwürfe und auf die unablässige scharfe Beobachtung einer jeden, das heißt: auch der eigenen Stimme. So hat es schon Tumler gehalten, der väterliche Freund des Autors, jedenfalls seit den späten fünfziger Jahren, in der Überzeugung (oder wenigstens: in der Hoffnung), damit künftig allen ideologischen Verlockungen und Fallen souverän entkommen zu können. Zoderers Erzähler hält es ganz ähnlich, in seinem Fall: um den Figuren nie Unrecht zu tun, beispielsweise durch Behauptungen, die womöglich am Ende nur der Selbstbehauptung des Ich-Erzählers dienen. Er stellt vielmehr ständig in Frage, was er berichtet, er stellt seine eigene Position also am schärfsten in Frage; so überschreiten denn auch die beiden Erzählungen permanent die Grenze zur Autobiographie.