
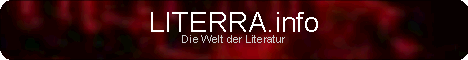
|
|
Startseite > Bücher > Mystery-Thriller > Sieben Verlag > Gian Carlo Ronelli > GOWELI - DER LETZTE ENGEL > Leseproben > GOWELI I |
GOWELI I
| GOWELI - DER LETZTE ENGEL
Gian Carlo Ronelli Taschenbuch, 200 Seiten |
Thinner lenkte den Wagen auf die Beschleunigungsspur der Autobahn. Ron hätte jede Wette verloren. Entgegen all seinen Erwartungen passte die Melone hinter das Lenkrad des Opel Corsa, ein Modell aus dem Jahr 1994. Damals gab es Extras wie Servolenkung, Airbag, Sitzheizung nur gegen einen enormen Aufpreis, der den Wert des Wagens beinahe verdoppelt hätte. Thinner schien sich nicht für Autos zu interessieren. Anderenfalls hätte er sein Fahrzeug besser gepflegt, zumindest die Staubschicht vom Lack entfernt, damit die Farbe zu erkennen war. Von einer Wachspolitur hatte dieser Ignorant offensichtlich noch nie etwas gehört.
Thinner trat das Gaspedal bis zum Boden durch. Mit Klapper- und Knarrgeräuschen im Innenraum quälte sich das sechzig PS starke Gefährt die sanierungsbedürftige Fahrbahn entlang. Die Nadel des Tachometers schien bei hundert km/h festzuhängen. Zwei Stunden bis Turin. Ohne Klimaanlage.
Zahllose Autos überholten, jedes zweite hupte. Thinner schien das nicht zu beeindrucken.
Er lächelte und quittierte die unmissverständlichen Handzeichen der
italienischen Autofahrer mit freundlichem Nicken.
Mark saß auf dem Beifahrersitz und starrte aus dem Seitenfenster. Ron lehnte sich zurück und versuchte, seine Beine in eine annehmbare Position zu falten.
Vergeblich.
„Was treibt Sie nach Turin, Häuptling? Hat ein Poltergeist eine alte Dame erschreckt?“
Mark seufzte, sein Desinteresse an dieser Unterhaltung war damit kundgetan.
Thinners Mundwinkel konnten sich nicht sofort entscheiden, ob sie ein dämliches Grinsen oder ein mitfühlendes Lächeln auf sein Gesicht zaubern sollten. Schließlich entschieden sie sich für das Grinsen. Mark drehte sich langsam zur Seite. Sein Blick vertrieb das Grinsen durch das halboffene Fahrerfenster. Thinner griff zum
Rückspiegel und stellte solange daran herum, bis er Rons Gesicht im Blickfeld hatte.
„Top secret“, sagte er, sich wichtig machend.
Mark hatte ihn immer noch im Visier. Thinners Augen schielten auf die Beifahrerseite, meldeten dem Gehirn das erhöhte Gefahrenpotential, das von Mark ausging und widmeten sich wieder dem Verkehr. Mark lehnte sich zurück.
„Das werden Sie noch bald genug erfahren.“
„Haben Sie ihre Liebe zur Sindonologie entdeckt?“
Mark schüttelte den Kopf. „Ihre Grabtücher interessieren mich einen feuchten Dreck. Das sollten Sie eigentlich wissen.“
„Aber doch genug, um sich zwei Stunden in diese Rostlaube zu setzen und mich abzuholen?“
Thinner streichelte das Lenkrad. Mark schaute zurück.
„Hoskins wollte Sie hier haben. Ich hätte gerne auf Sie verzichtet.“
„Was ist passiert?“
Mark schüttelte den Kopf und blickte wieder zum Seitenfenster hinaus. Thinner nahm über den Rückspiegel Blickkontakt zu Ron auf.
„Es ist sensationell. Sie werden begeistert sein, Herr Professor. Das Tuch, es ...“
„Thinner!“ Marks Blick schleuderte einen Tomahawk direkt zwischen Thinners Augen. „Halten Sie das Maul und fahren Sie!“
Ron zog sich an der Lehne des Vordersitzes hoch. „Grimley! Was zum Teufel ist hier los? Welchem Geist jagen Sie nach?“
„Keinem Geist.“
Mark fixierte einen Sprung am oberen Rand der Windschutzscheibe. „Einem Serienmörder.“
„Der Reverend?“
Marks Schweigen war ein eindeutiges Ja. „Ich dachte, die fünf Mädchen wurden in den Staaten ermordet.“
Mark drückte sich in die Lehne des Vordersitzes und starrte auf das Handschuhfach.
„Sechs.“
„Shit.“
Der Reverend hatte in den letzten Monaten in den Vereinigten Staaten für ein Medienspektakel gesorgt. Wilde Gerüchte rankten sich um den Mann, der junge Mädchen ermordete und in betender Haltung zurück ließ. Das FBI hatte eine Nachrichtensperreverhängt und dadurch dem Spekulantentum Tür und Tor geöffnet.
Von einem Kannibalen war die Rede, einem Schlächter, der sich im Blut seiner Opfer religiösen Ritualen hingab. Die spärlichen Informationen, die an die Öffentlichkeit gelangten, stellten vor allem eines klar: Die ermittelnden Beamten tappten im Dunkeln, hatten keinerlei Hinweise auf den Täter. Von einem weiteren Opfer hatte Ron nichts gehört. Die Sperre beim FBI funktionierte.
„Wir haben ein Kruzifix bei dem letzten Opfer gefunden.“ Marks Fingernagel fuhr seine Narbe entlang. „Mit Blut- und Hautspuren des Mörders. Der DNS-Vergleich war erfolgreich. Irrtum ausgeschlossen.“
Ron schob seinen Kopf nach vorne. „Und? Wer ist es?“
Mark holte tief Luft und drehte seinen Kopf zum Beifahrerfenster. „Jesus Christus“, sagte er schließlich.
„Wie bitte? Verarschen Sie mich!“
Natürlich verarschte er ihn. Oder doch nicht? Marks Gesichtsausdruck gefiel Ron nicht. Auf seinen Lippen war kein boshaftes Grinsen zu entdecken. Nicht einmal dieses Zucken im Mundwinkel, das für Marks Verhältnisse als Lächeln zu werten war. Kein Scherz?
„Eine archäologische Datenbank lieferte die Übereinstimmung. Die DNS vom Grabtuch stimmt zu hundert Prozent mit den Blutspuren vom Tatort überein. Ich bin hier, um dieses Ergebnis von Hoskins bestätigen zu lassen.“
„Das ist unmöglich. Hören Sie? Unmöglich! Es tut mir ja sehr leid, Ihnen das mitteilen zu müssen: Der Mann, der in diesem Grabtuch eingewickelt war, starb vor mindestens tausendneunhundert Jahren.“
„Ja, das sollte man meinen. Wenn allerdings die DNS tatsächlich vom Grabtuch stammt, Herr Professor, dann haben wir ein Problem.“
Ron schüttelte den Kopf. „Wir? Nein, Häuptling. Sie haben ein Problem.“
„Dann warten Sie mal, bis Sie das Tuch gesehen haben.“
„Verdammt! Was ist mit dem Tuch?“
„Warten Sie’s ab.“
Da war es. Dieses Zucken im Mundwinkel. Dann wandte Mark sich wieder dem Beifahrerfenster zu und schwieg.
Turin, Via Sàntena
Ron hatte jegliches Gefühl in den Beinen verloren. Seine Lunge lechzte nach Frischluft. Jeder einzelne Wirbel schmerzte, als wäre ein Teil der Rückbank in seinen Körper einmarschiert, um die Wirbelsäule Stück für Stück heraus zu brechen, gefangen zu nehmen und entgegen aller Schutzbestimmungen für Kriegsgefangene auf grausamste Art zu foltern. Er sah aus dem Seitenfenster. Der Stadtteil war ihm fremd.
„Das ist definitiv nicht die Straße zur Kathedrale.“
„Das Tuch ist nicht in der Kathedrale.“
„Sondern?“
Mark zeigte nach rechts. Ein Gebäude, dreigeschossig, vergitterte Fenster im Erdgeschoss. Eine graubraune Fassade bettelte um Erneuerung. Der rechte, kleinere Teil des Gebäudes schien angebaut worden zu sein. Backsteinziegel trugen ein seltsames Gebilde. Eine moderne Glasfront, eingefasst von bedauernswertem
Mauerwerk. Hatte man es aus der ursprünglichen Bausubstanz herausgerissen und hier, einer fragwürdigen Laune des Architekten folgend, wie einen unpassenden Hut einfach aufgesetzt?
Thinner lenkte den Wagen nach rechts und hielt vor einem geschwungenen schmiedeeisernen Tor. Sezione di Genetica, Biologia e Biochemica stand auf einem Schild daneben. Ein Institutsgebäude der Turiner Universität.
Ron schüttelte verwundert den Kopf. „Befindet Italien sich im Krieg?“
Militärfahrzeuge säumten die Straße, Soldaten patrouillierten die Mauer des Institutsgeländes entlang. Ein Soldat, das Sturmgewehr im Anschlag, kam auf das Auto zu und forderte Thinner durch Handzeichen auf, die Einfahrt zu verlassen.
„No entrata!“
„FBI!“
Thinner zeigte seinen Ausweis. Der Soldat nahm ihn an sich. Ein Winken zum Tor. Eine weitere Militärperson eilte herbei, ohne Sturmgewehr. Ein Offizier? Er studierte den Ausweis und starrte Thinner ins Gesicht. Ein prüfender Blick ins Wageninnere. Mark nickte ihm zu. Der Offizier lächelte und gab Thinner den Ausweis
zurück. Das Tor öffnete sich. Thinner fuhr los. Er parkte den Wagen neben einer Treppe zum Eingang des Institutes. Ron quälte sich aus dem Wagen, füllte seine Lungen mit der angenehmen Abendluft und streckte die Arme von sich.
Langsam kehrte das Gefühl in seine Beine zurück.
„Ron! Endlich!“
Professor Hoskins stolperte die Treppe herab, direkt auf Ron zu, der ihn mit einem Lächeln begrüßte.
„Schön, Sie zu sehen, Einstein.“
„Wer? Ah! Ein kleiner Scherz. Ausgesprochen komisch.“
Er klopfte Ron kurz auf die Schulter und rückte seine Nickelbrille zurecht. Hoskins war einer dieser Menschen, die sich nie änderten. Er hatte immer noch die zerzausten weißen Haare, die jeden Kamm das Fürchten lehrten. Den Schnauzbart, der Albert Einstein mit Sicherheit dazu veranlasst hätte, ihn wegen Verletzung des
Urheberrechtes zu verklagen. Die buschigen Augenbrauen, die ihn ohne Zweifel zum Weihnachtsmann des Jahres nominierten. Und den braunen Anzug, der sich erfolgreich weigerte, an irgendeiner Körperstelle zu passen.
„Wie war die Reise?“, fragte Hoskins und strich über seinen Schnauzbart.
„Der Flug war laut, die Autofahrt, na ja.“
Ron zeigte zum Wagen, Hoskins Blick folgte seiner Hand.
„Verstehe.“
Hoskins räusperte sich. „Genug geplaudert! Die Arbeit ruft!“
Sie folgten dem Professor über die Treppe und betraten das Gebäude. Eine Frauenstimme überholte sie, drang vom Einfahrtstor ins Haus.
„Lassen Sie mich rein! Der Professor erwartet mich! Verstehen Sie mich, Soldat?“
Ron und Mark blieben wie auf Kommando stehen und starrten sich an.
„Nein“, flüsterte Ron.
„Doch“, antwortete Mark.
„Ah! Sie ist schon da!“
Hoskins stürmte aus dem Gebäude und raste die Treppe hinab. Der Wachposten versperrte einer Frau den Weg. Sie war um anderthalb Köpfe kleiner als er, wobei der Soldat Goliath keine Konkurrenz machte. Eine dunkelbraune Locke fiel ihr vor die Augen. Mit einer hastigen Handbewegung wurde sie aus dem Gesicht geschleudert.
Ihr Mund war eine Schießscharte, ihre Stimmbänder wurden in diesem Moment nachgeladen. Ihre Augen visierten das Ziel an. Entsichern. Feuer!
„Ich! Muss! Hier! Rein!“
Der Soldat hatte keine Ahnung, wem er hier den Krieg erklärt hatte. Mercedes Brightman, der Koryphäe auf dem Gebiet der Genetik und Biochemie. Sie hatte Rons vollsten Respekt, wenn er bedachte, was diese Frau mit ihren siebenundzwanzig Jahren alles erreicht hatte. Ihre Fachkenntnis und Kombinationsgabe erstaunten nicht nur eingesessene Hardcore-Genetiker. Sie galt in der Wissenschaftswelt
als Genie. Ron schmunzelte über die Zweideutigkeit des Wortes in
diesem Zusammenhang. Genie.
Das Genie drängte sich an dem Wachposten vorbei und hob die Arme.
„Und? Werden Sie mich jetzt erschießen?“
Händeringend lief Hoskins zum Tor.
„Er wird“, flüsterte Ron.
„Ich würde es verstehen“, antwortete Mark.
Sie grinsten sich an.
„Miss Brightman! Alles in Ordnung! Aprire, prego!“
Das Tor wurde geöffnet und Mercedes betrat das Gelände. „Was ist hier los?“
„Sicherheitsvorkehrungen. Die italienischen Behörden.“
Professor Hoskins schüttelte ihre Hand. Sie blickte nach hinten, verengte ihre Augen und feuerte eine Salve Giftpfeile in Richtung Tor. Der Soldat murmelte unbeeindruckt vor sich hin.
„Das habe ich verstanden! Sie mich auch!“, rief sie und schien zu überlegen, ob sie nochmals zum Tor zurückkehren und diesem Soldaten zeigen sollte, wie man mit einer selbstbewussten amerikanischen Frau umzugehen hatte.
Hoskins war bereits am Treppenansatz. „Kommen Sie! Wir sind vollzählig.“
Mercedes nahm zwei Stufen mit einem Satz. „Vollzählig? Wer ...“ Ihr Blick fiel auf Ron. „Das hätte ich mir allerdings denken können.“
„Hallo, Mercy.“
„Ron.“ Sie streckte ihre Hand in Rons Richtung, zog sie aber gleich wieder zurück.
„Oh. Ich vergaß. Das kleine Problem.“ Ihr süßsaures Grinsen war ein Schlag in seine Weichteile. Jeder Ringrichter wäre sofort dazwischen gegangen, hätte Mercy des Ringes verwiesen. Ron lächelte und schaute zu dem Soldaten beim Tor. Er hätte schießen sollen. „Na, wen haben wir denn hier? Agent Sitting Bull. Hat man
dich doch aus deinem Reservat gelassen?“
„Ich freue mich auch, dich zu sehen.“
Mark schüttelte ihre Hand. Sein Blick gesellte sich zu Rons. Seine Gedanken waren offensichtlich: Der Soldat hätte schießen sollen.
Mercedes Brightman war bei der Männerwelt ungefähr so beliebt wie ein Pickel auf der Stirn vor der ersten Verabredung. Sie hatte das Talent, in jedes nur denkbare Fettnäpfchen zu treten, auch wenn es noch so gut versteckt war. In einigen Ausnahmefällen liebte sie es geradezu mit Genuss hineinzuspringen und den Inhalt um sich zu spritzen, bis ihr Opfer Fett triefend am Boden lag. Ron und Mark waren solche Ausnahmefälle. Sie selbst behauptete von sich, ein sehr umgänglicher Mensch zu sein. Höflich, zuvorkommend, zurückhaltend, ein wenig schüchtern, und nicht im Geringsten neugierig.
„Seid ihr auch so gespannt wie ich? Ich sterbe vor Neugierde! Professor?“
Hoskins starrte auf einen Eimer in der Ecke neben dem Eingang. „Wie? Natürlich!
Das Tuch. Kommen Sie. Es ist unglaublich! Da vorne.“
Hoskins zeigte auf das Ende des Ganges. Zwei Soldaten standen vor einer Tür.
Sie nickten dem Professor zu, als er an ihnen vorbei ging und die Klinke drückte.
„Sie werden begeistert sein.“
Er öffnete die Tür. Ein Labor kam zum Vorschein. Die Stirnseite war mit Computerbildschirmen verbaut. Vor der rechten Wand war das vier Meter lange und einen Meter breite Tuch aufgehängt. Wie ein altes Bettlaken auf Mutters Wäscheleine.
Im Licht zweier Halogen-Scheinwerfer konnte man vage die braunen Verfärbungen erkennen: Vorder- und Rückseite des Körpers eines gefolterten und gekreuzigten Mannes.
„Na? Was sagen Sie? Ron?“
Ron ging zum Tuch, wollte es anfassen. Eine eisige Kälte, zwei Zentimeter vor dem Stoff, ließ seine Finger zurückzucken. „Was zum Teufel ist das?“
Mercy stellte sich neben ihn. „Ist es das, wofür ich es halte?“
Der Professor nickte. Ron betrachtete jene Stelle, an der das Gesicht des Mannes abgebildet war. Dorneneinstiche, Verletzungen im Kieferbereich, eine Stichwunde seitlich der Brust. Wundmale des Gekreuzigten an Händen und Füßen. Das alles kannte Ron nur zu gut. Aber das Tuch hatte sich verändert. An all diesen Stellen,
an jeder einzelnen noch so kleinen Wunde, war das Tuch durchtränkt von einer dunkelroten Flüssigkeit.
„Blut“, sagte Hoskins und gesellte sich zu Mercy. „Blutgruppe und erste genetische Tests haben eine Übereinstimmung ergeben. Wer immer hier eingewickelt war, das ist definitiv sein Blut.“
„Wie ist das möglich?“, fragte Ron und starrte zu Hoskins, dann zu Mercy.
„Deswegen seid ihr hier. Ich hoffe, dass du mit Miss Brightmans Hilfe eine Erklärung findest.“
„Haben Sie die Geräte von der Liste?“, fragte Mercy.
Der Professor zeigte auf die linke Seite des Raumes. „Alles vorhanden. Sie müssen nur noch ihre Software einspielen, dann können Sie beginnen.“
Mercys Lächeln war der Inbegriff von Motivation. Sie ging zu einem Computer, strich mit den Fingern darüber, entfernte die Hülle von einem Apparat und drehte sich zu Hoskins. Ihre Augen blitzten frech, sprühten vor Tatendrang.
„Los geht’s!“ Sie rieb ihre Handflächen aneinander. „Ron? Ich brauche eine Probe von dem Blut.“
Mark schlich aus dem Raum, dicht gefolgt von Professor Hoskins.
Weitere Leseproben
| Goweli – der letzte Engel |
[Zurück zum Buch]
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info





