- Das Haus
- Newsletter
- Service
- Publikationen
- Veranstaltungen
- Ausstellungen
- Buchmagazin & AutorInnen
- Bibliothek & Sammlungen
- Katalogsuche
- Museen, Festivals & Reisen
- Preise, Projekte, Archive, Tagungen, Akademien
- Literaturhäuser
- Partner

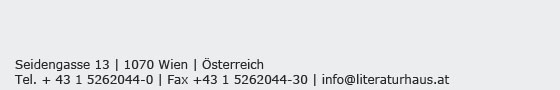
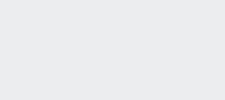
FÖRDERGEBER

PARTNER/INNEN

Richard Krafft-Ebing: Psychopathia sexualisGelesen von: Irina von Bentheim "Was seinerzeit als 'Sexualstörung' kriminalisiert wurde [...], gilt nunmehr als sexuelle 'Vorliebe' oder 'Praxis' - und hat heute, sofern darüber berichtet wird, eher voyeuristischen Wert. [...] Das Buch kann heute als ein medizinhistorisches Dokument gelesen werden, gleichzeitig aber auch als einer der Gründungstexte der Psychoanalyse - oder einfach als Kuriosum einer vermeintlich überholten Wissenschaftspraxis, um dann festzustellen, dass der Text auch heute noch an Aktualität besitzt." Abgesehen vom Grammatikfehler ist dieser abschließenden Aussage des Booklets auch inhaltlich zu misstrauen. Denn so, wie der Text hier präsentiert wird, bleibt von den drei vorgeschlagenen Lesarten nur die des Kuriosums übrig. Irina von Bentheim, Synchronsprecherin u. a. der Sarah Jessica Parker aus der Kultserie "Sex and the City", liest den Text munter und gleichmäßig fröhlich, fast mit einem schulmädchenhaften Drall in der Stimme, und das keineswegs nur in den lateinischen Passagen, in die Krafft-Ebing an den delikatesten Stellen flieht. Die forcierte Harmlosigkeit des Vortrags drängt den Hörer fast unfreiwillig in eine Haltung der Belustigung. Selbst all jene Passagen, in denen Krafft-Ebing als Vorgeschichte und Erklärungsansatz für die sexuellen Straftaten und Perversionen die Lebensumstände, (Erb)Krankheiten und das Sozialmilieu der Täter zu beschreiben sucht, wirken hier nicht wie in der Entstehungszeit der Studien verankerte Bemühungen um wissenschaftliche Empirie, sondern wie lustige Anekdoten. Man muss gewissermaßen gegen den Strich hören, wenn man hier aus Krafft-Ebings Geschichtensammlung eine kulturhistorische Information heraushören möchte. Der 1840 in Mannheim geborene Psychiater und Gerichtsmediziner veröffentlichte seine Sammlung über Sexualtäter erstmals 1886 und arbeitete fortan an ihrer stetigen Erweiterung; als er 1902 verstarb, war soeben die 12. Auflage erschienen, aus den ursprünglich 110 Seiten mit 45 Krankengeschichten waren 437 Seiten und 238 Fallgeschichten geworden. Auch nach seinem Tod setzte sich die Erfolgsgeschichte fort: 1924 erschien bereits die 17. Auflage, und der Grund dieser Popularität war zweifellos auch damals bereits ihr "voyeuristischer Wert" und nicht nur wissenschaftliches Interesse. Walter Mehring beschrieb 1951 in seinem Erinnerungsbuch "Die verlorene Bibliothek" die Präsenz dieser moralischen und sonstigen "Grenzfälle" in den ehrwürdigen Bücherschränken der Gründerzeitväter: "Mein Vater hatte sie da als "Kulturkuriosa" isoliert; er hielt sie so gut wie möglich vor mir versteckt, wie man hochgeehrte, doch gemeingefährliche Irre in eine geschlossene Heilanstalt überführt." Krafft-Ebings "Psychopathia sexualis" erwähnt Mehring in seiner Aufzählung nicht, aber eine Reihe anderer "abstrus medizinischer, griechisch-lateinischer Kauderwelsch-Titel" wie: "Halluzinative Pseudo-Epilepsie beim Paulus von Tharsus", "Die Confessionen des Hl. Augustinus, die Beichte eines Bisexuellen", oder "Die Bußexerzitien des Hl. Ignatius von Loyola oder Vom erotomanen Militaristen zum sakrosankten Gottesstreiter". (Erotomanie ist übrigens wie Sadomasochismus ein Terminus technicus, den Krafft-Ebing prägte.) Kulturhistorisch interessant sind die Verkrümmungen und Umwege, die erotische Phantasien in Kauf nehmen mussten, um zumindest in einem uneinsehbaren Winkel des Bücherschranks noch Platz zu finden. Es sind diese Verkrümmungen und Umwege, die auch Krafft-Ebings Fallgeschichten eingeschrieben sind. Das macht die harmlos-nette Lesart Irina von Bentheims nicht hörbar, und auch nicht die fast durchgängige Sichtweise der Krankheitsbeschreibungen aus männlichem Blick, der weibliche Part des Sexualaktes ist zumeist nur als unthematisiertes Opfer präsent. Daran haben auch die im Booklet herbeizitierten "Neubewertungen sexueller Praktiken" doch zum Teil ihre Grenze. Dass es die zu große Zurückhaltung des Weibes ist, die "sadistische Neigungen" weckt, oder der zu starke Naturtrieb zur Unzucht mit minderjährigen Mündeltöchtern führt, solche Kausalierungen bleiben in der gleichförmigen Fröhlichkeit der Präsentation unbewertet. Um darüber zu schmunzeln, dafür sind die Tatbestände eigentlich zu aktuell geblieben, auch wenn zu befürchten ist, dass das Lachen manchem Hörer nicht im Halse stecken bleibt. Aktuell wirken auch die vergleichsweise geringen Strafen für sexuelle Verbrechen, die Krafft-Ebing mitunter erwähnt, für 100 geschändete Frauenleichen etwa gab es 1 Jahr Kerker. Als vorletzter Abschnitt der zweiten CD kommt die "Amor lesbicus" in den Blick, die ausschließlich am Phänomen weiblicher Strafanstalten abgehandelt wird, wo die Unglücklichen zu den abscheulichsten Praktiken greifen. Im Wesentlichen handle es sich dabei nur um Prostituierte, die von den Tätigkeiten der Tiere "zu diesen Praktiken gelangen". Bei Homosexualität hingegen setzte sich Krafft-Ebing - wenn auch um den Preis der Pathologisierung - für Straffreiheit ein. Natürlich kann man sich im Abstand von gut einem Jahrhundert lustig machen über Sätze wie "schon in frühen Jahren kam er ohne Verführung zur Onanie". Dabei übersieht man allerdings leicht, dass viele der Formulierungen oft nur das Sprachgewand gewechselt haben, während die zugrunde liegende Vorstellung unverändert oder leicht adaptiert erhalten blieb. Wenn es im Abschnitt über Gerontophilie heißt, er "wollte sie gebrauchen ... das zweite Notzuchtsfaktum trug sich folgendermaßen zu", und als Erklärung für diese beiden Aggressionsakte angeführt wird, dass der Ausführende sich in volltrunkenem Zustand befunden habe - da klingen Krafft-Ebings Formulierungen keineswegs so angestaubt und lustig, wie uns die Stimme glauben machen will. Eine intelligentere Aufbereitung und Präsentation hätte die Spur sichtbar machen können, die Krafft-Ebings Fallbeispiele aus der Gerichtsmedizin subkutan in den Bildern und Vorstellungen von Sexualität, und auch in der Literatur, hinterlassen haben. Das ist zweifellos wert, angehört und wieder gelesen zu werden, aber in dieser dahinplätschernden Lesart wird eben nur ein Kuriosum daraus. Als unterhaltsamer Kuriositätensteinbruch eignen sich Krafft-Ebings Nachrichten aus dem Gerichtsalltag der Gründerzeit aber nicht so gut - das hat schon der Film "Psychopathia Sexualis" von Bret Wood aus dem Jahr 2006 gezeigt. Und vor allem werden solche Herangehensweisen der wissenschaftlichen und kulturhistorischen Bedeutung dieser Materialsammlung in keiner Weise gerecht.
Evelyne Polt-Heinzl Originalbeitrag FĂĽr die Rezensionen sind die jeweiligen Verfasser verantwortlich. Sie geben nicht notwendig die Meinung der Redaktion wieder. |
| Veranstaltungen |
|
"Wir schreiben uns ein"
Mo, 17.09.2018, 19.00 Uhr Projektpräsentation mit Lesungen & Gespräch Das seit 2017...
"20 Jahre Cognac & Biskotten"
Di, 18.09.2018, 19.00 Uhr Ausstellungseröffnung mit Lesung & Musik Sie ist eine... |
| Ausstellung |
|
ZETTEL, ZITAT, DING: GESELLSCHAFT IM KASTEN Ein Projekt von Margret Kreidl
ab 11.06.2018 bis Juni 2019 Ausstellung | Bibliothek Der Zettelkatalog in der... |
| Tipp |
|
flugschrift Nr. 24 von Lisa Spalt
Wenn Sie noch nie etwas vom IPA (dem Institut für poetische Allltagsverbesserung) gehört haben,... |
|
Literaturfestivals in Ă–sterreich
Sommerzeit - Festivalzeit! Mit Literatur durch den Sommer und quer durch Österreich: O-Töne in... |