- Das Haus
- Newsletter
- Service
- Publikationen
- Veranstaltungen
- NEU Livestream
- Ausstellungen
- Buchmagazin & AutorInnen
- AutorInnen
- AUFTRITTE
- Rezensionen Buch
- Rezensionen 2019
- Rezensionen 2018
- Rezensionen 2017
- Rezensionen 2016
- Rezensionen 2015
- Rezensionen 2014
- Rezensionen 2013
- Pressespiegel 2000-2010
- AutorInnen A
- AutorInnen B
- AutorInnen C
- AutorInnen D
- Autorinnen E
- AutorInnen F
- AutorInnen G
- AutorInnen H
- AutorInnen I
- AutorInnen J
- AutorInnen K
- AutorInnen L
- AutorInnen M
- AutorInnen N
- AutorInnen O
- AutorInnen P
- AutorInnen Q
- AutorInnen R
- AutorInnen S
- AutorInnen T
- AutorInnen U
- AutorInnen V
- AutorInnen W
- AutorInnen Z
- Incentives
- Rezensionen Sachbuch
- Verlage
- Dank an Verlage
- Impressum
- Bibliothek & Sammlungen
- Katalogsuche
- Partnerinstitutionen

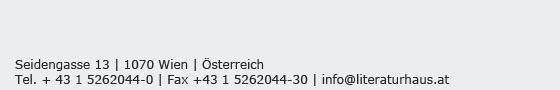
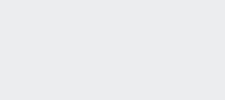


FÖRDERGEBER
PARTNER/INNEN

Leseprobe: Gerhard Ulbrich - "Stillfried." Ich gehe mit meinem Sohn ins Naturhistorische Museum in Wien. Als ich einige Schritte gegangen bin, stoße ich auf die Grabstelle. Die Skelette sind so wieder in den Sand gelegt, wie sie gefunden wurden, und ein rundes Glasdach ist darübergestülpt. Obwohl nur Skelette, sind die Körper für mich so deutlich vorstellbar, daß ich meinen Blick von der ungewöhnlichen Lage der Toten nicht abwenden kann und mir klar wird, daß jene Menschen noch lebend in jenes Grab gezwungen oder gelegt worden sind. Ich sehe aus dem Fenster und es regnet. Es wurde verlauutbart, mit kleinen Kindern nicht im Regen spazieren zu gehen. Die Wolkendecke schiebt sich langsam nach Süden und ich nehme an, daß radioaktive Teilchen darin enthalten sind. Ein Reaktorkern brennt. Hiroshima war ganz einfach verschwunden. Aus einer seltsamen flachen Wüste ragen einige verkohlte Bäume und halbzerstörte Betonwände empor. Es fehlen alle Anzeichen des Lebens. Kein Grün, kein Gras, keine Blätter, nicht einmal Insekten beleben die Wüste. Hie und da begegnen mir Männer mit entstellenden Gesichtsnarben, manche Frauen haben den Kopf mit Tüchern verhüllt, weil ihr Haar ausgefallen ist. Ohne Richtung und Ziel streifen die Menschen wie Geister durch die Landschaft. Heute ist unser Wunsch, in der vergänglichen Welt die stabilen Muster eines Lebenszyklus zu erkennen, so stark wie zu der Zeit, als die ersten Schöpfungslegenden entstanden. Nur die Weise, in denen sich das Wesen jenes Lebenszyklus ausdrückt, hat sich geändert. © 1999, Triton, Wien.
|
| Veranstaltungen |
|
Junge LiteraturhausWerkstatt - online
Mi, 13.01.2021, 18.00–20.00 Uhr online-Schreibwerkstatt für 14- bis 20-Jährige Du schreibst und...
Grenzenlos? (Literaturedition Niederösterreich, 2020) - online
Do, 14.01.2021, 19.00 Uhr Buchpräsentation mit Lesungen Die Veranstaltung kann über den Live... |
| Ausstellung |
|
Claudia Bitter – Die Sprache der Dinge
14.09.2020 bis 25.02.2021 Seit rund 15 Jahren ist die Autorin Claudia Bitter auch bildnerisch... |
| Tipp |
|
LITERATUR FINDET STATT
Eigentlich hätte der jährlich erscheinende Katalog "DIE LITERATUR der österreichischen Kunst-,... |
|
OUT NOW flugschrift Nr. 33 von GERHARD RĂśHM
Die neue Ausgabe der flugschrift des in Wien geborenen Schriftstellers, Komponisten und bildenden... |