- Das Haus
- Newsletter
- Service
- Publikationen
- Veranstaltungen
- NEU Livestream
- Ausstellungen
- Buchmagazin & AutorInnen
- AutorInnen
- AUFTRITTE
- Rezensionen Buch
- Rezensionen 2019
- Rezensionen 2018
- Rezensionen 2017
- Rezensionen 2016
- Rezensionen 2015
- Rezensionen 2014
- Rezensionen 2013
- Pressespiegel 2000-2010
- AutorInnen A
- AutorInnen B
- AutorInnen C
- AutorInnen D
- Autorinnen E
- AutorInnen F
- AutorInnen G
- AutorInnen H
- AutorInnen I
- AutorInnen J
- AutorInnen K
- AutorInnen L
- AutorInnen M
- AutorInnen N
- AutorInnen O
- AutorInnen P
- AutorInnen Q
- AutorInnen R
- AutorInnen S
- AutorInnen T
- AutorInnen U
- AutorInnen V
- AutorInnen W
- AutorInnen Z
- Incentives
- Rezensionen Sachbuch
- Verlage
- Dank an Verlage
- Impressum
- Bibliothek & Sammlungen
- Katalogsuche
- Partnerinstitutionen

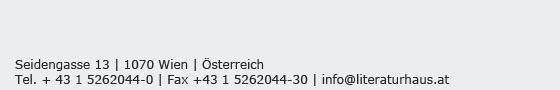
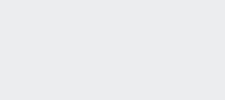


FÖRDERGEBER
PARTNER/INNEN

Jürgen Draschan/ Bertlinde Vögel (Hg.): NACHBEBEN JAPAN.(1) Als sei das Land, das ich für einige Zeit bewohnt und bereist habe, nicht mehr vorhanden: das ist eine Vorstellung, die sich hat überwältigen lassen von der medialen Bilderflut. Es ist eine Vorstellung, die von der nicht nur phantasmatischen Furcht herrührt, das Übermaß an Katastrophe sei nicht lokal zu begrenzen, der Dreißig-Kilometer-Sperrbereich um das kollabierte Kernkraftwerk betreibe eine heimliche Auslöschung von Lebensland, die sich immer weiter über den Globus ausbreite. Die Narayama-Verse sind die Lieder eines Dorfes, die dann zu hören sind, wenn ein Einwohner sich der Regel des Freitodes zu entziehen versucht, indem er sein Alter leugnet: Mutter O-Rin, siebzig, hat sich mit einem Stein die Zähne zerschlagen, als Beweis, dass sie schon keine Esserin mehr ist, die in der Hungersnot das allgemeine Elend durch ihren Egoismus vergrößert. Die Lieder fordern ihre Pflicht ein, in den Berg hinaufzusteigen, den Narayama, und dort den Tod zu erwarten. Der Einzelne zählt nicht, darf nicht zählen, wo es um das Überleben der Gruppe geht. O-Rin bricht auf: „Am besten ist es, beim ersten Schnee auf den Narayama zu gehen.“ Es hat zu schneien begonnen, die Schneeflocken scheinen die Aufgabe zu übernehmen, die Grausamkeit zu besänftigen. (aus dem Beitrag von Elfriede Czurda, Seite 54/55)
(2) Zur Entfernung kommen wir Entfernung springt aus der Sprache. (aus dem Beitrag von Ann Cotten, Seite 40)
© 2012 Luftschacht, Wien
|
| Veranstaltungen |
|
Junge LiteraturhausWerkstatt - online
Mi, 13.01.2021, 18.00–20.00 Uhr online-Schreibwerkstatt für 14- bis 20-Jährige Du schreibst und...
Grenzenlos? (Literaturedition Niederösterreich, 2020) - online
Do, 14.01.2021, 19.00 Uhr Buchpräsentation mit Lesungen Die Veranstaltung kann über den Live... |
| Ausstellung |
|
Claudia Bitter – Die Sprache der Dinge
14.09.2020 bis 25.02.2021 Seit rund 15 Jahren ist die Autorin Claudia Bitter auch bildnerisch... |
| Tipp |
|
LITERATUR FINDET STATT
Eigentlich hätte der jährlich erscheinende Katalog "DIE LITERATUR der österreichischen Kunst-,... |
|
OUT NOW flugschrift Nr. 33 von GERHARD RĂśHM
Die neue Ausgabe der flugschrift des in Wien geborenen Schriftstellers, Komponisten und bildenden... |