- Das Haus
- Newsletter
- Service
- Publikationen
- Veranstaltungen
- Ausstellungen
- Buchmagazin & AutorInnen
- Bibliothek & Sammlungen
- Katalogsuche
- Museen, Festivals & Reisen
- Preise, Projekte, Archive, Tagungen, Akademien
- Literaturhäuser
- Partner



FÖRDERGEBER

PARTNER/INNEN

Arno Geiger: Alles über Sally.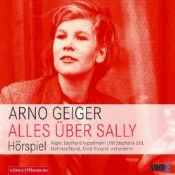 Hörspielbearbeitung von Leonhard Koppelmann Mit "Alles über Sally" hat Arno Geiger 2010 "den" modernen Eheroman geschrieben. Um die Protagonistin Sally richtig einzuordnen, wurden seitens der Literaturkritik Vergleiche mit "Madame Bovary" und "Anna Karenina" angestellt. Sally, eine nicht mehr junge, doch begehrenswerte Frau, vital und neugierig, langweilt sich mit ihrem Ehemann Alfred, der das pure Gegenteil ist, ein schlaff gewordener Museumsmensch, der sich lebensabgewandt in Tagebuchnotizen verkriecht. Sally wagt den Seitensprung mit dem Nachbarn – und das stabile Bild einer dreißig Jahre währenden Ehe samt drei fast erwachsenen Kindern gerät ins Wanken. Im Hörspiel, dessen Hörbuch-Cover ident mit dem der Buchausgabe ist (ein jugendlich wirkendes, in knalliges Rot getauchtes Frauenporträt), drängt sich die Assoziation mit Flaubert und Tolstoi weit weniger auf. Die Eheromane des 19. Jahrhunderts handeln von gesellschaftlichen Vorgaben und der unstillbaren Sehnsucht nach der immerwährenden Leidenschaft. Arno Geiger zeigt zur Jahrtausendwende ein realitätsorientiertes Paar, das um eine für beide gültige Form des Zusammenlebens bemüht ist. Ihrem Naturell entsprechend lebt Sally nach der Devise: Sex ist gesund und macht glücklich. Für diese Anschauung hat sie Vorkehrungen eingerichtet, die ihr den zeitweiligen Ausstieg aus der Ehe erleichtern. Dass Alfred dies akzeptiert, wird im Hörspiel in einer amüsanten ehelichen Beischlafszene demonstriert. Ein Seitensprung führt also nicht zum Tod sondern zum Leben - das ist der grundlegende Unterschied zu "Madame Bovary" oder "Anna Karenina". Und der betrogene Ehemann sagt voller Begeisterung: "Mit Sally kommt so viel Leben in mein Leben." Alfred ist vielleicht ein etwas langweiliger aber durchaus selbstbewusster Mann, weshalb er sich weder grämt noch Rache fordert. Und: Alfreds "Ehre" bleibt unangetastet, weil er die Achtung Sallys nicht verliert. In einer an Feminismus und Geschlechterforschung geschulten Gesellschaft entwirft Arno Geiger mit Sally eine Frauenfigur, die an Selbstbestimmtheit und innerer Freiheit ihresgleichen sucht und sich eher an englischen (wie der Name schon ausdrückt) als an französischen Vorbildern orientiert. Ein Foto auf der Innenseite des Covers zeigt Stephanie Eidt und Matthias Brandt im Aufnahmestudio: er, zurückgelehnt liegend (der Lebenshaltung Alfreds entsprechend), daneben sie, sitzend, lebhaft gestikulierend. Matthias Brandt trifft am selbstverständlichsten die Sprache Arno Geigers, die zuweilen umständlich formuliert (Sally: "Ich hatte stets ein Gefühl der Fremdheit angesichts meiner Individualität."). Aber auch Stephanie Eidt ist überzeugend mit ihrer wandelbaren Stimme, in der sich das ganze Spektrum von Gefühlen - zwischen kaum verhaltener Ungeduld und selbstloser Zärtlichkeit - gegenüber dem unzulänglichen Ehemann ausdrückt. Daneben wirkt Anke Sevenich als Nachbarin Nadja etwas zu "klein", zumindest sollte man der "erfolgreichen Sängerin" eine geschulte Singstimme anhören. Stefan Wilkening als Liebhaber Erik klingt mit seinem tiefen Bass zwar männlich, doch ohne jene verführerische Dynamik, die dazugehört, um drei Frauen gleichzeitig um den Finger zu wickeln. Und ziemlich unglaubwürdig ist es leider, dass die handelnden Personen allesamt Bundesdeutsch sprechen, obwohl sie in Wien zuhause sind. Dass das Hörspiel im Großen und Ganzen aber so geglückt ist, liegt an den beherzten Eingriffen in die Struktur des Romans durch den geübten Hörspielregisseur Leonhard Koppelmann. Während Ernst Konarek die Geschichte von Sally und Alfred erzählt, werden oft gleichzeitig die Stimmen des Ehepaares eingespielt. Dadurch ergibt sich ein stetes Wechselspiel zwischen dem Denken und dem Erzählen, zwischen Alfreds hausgemachter Lebensphilosophie, hörbar auf Tonband konserviert, und den eiligen Bemerkungen der lebenshungrigen Sally. Auch stückelt die Bearbeitung den langen inneren Monolog, den Alfred am Schluss des Romans führt und macht (hörbar) Tonbandaufzeichnungen daraus, die wie Postulate über den jeweils folgenden Abschnitten des Hörspiels stehen. Der Regisseur zitiert Erich Kästner (ein Zitat, das Alfred verwendet) zur Ouvertüre: "Du warst der einzige Mensch, den ich liebte, obwohl ich ihn kannte." In diesem Satz bündelt Koppelmann die Aussage des "modernen Eheromans", nämlich dass ein lebenslanges gegenseitiges Kennenlernen und Befragen Voraussetzung ist, wenn die Liebe die Ehe überdauern soll – eine Interpretation, der ich mich durchaus anschließe. Beatrice Simonsen
|
| Veranstaltungen |
|
"Wir schreiben uns ein"
Mo, 17.09.2018, 19.00 Uhr Projektpräsentation mit Lesungen & Gespräch Das seit 2017...
"20 Jahre Cognac & Biskotten"
Di, 18.09.2018, 19.00 Uhr Ausstellungseröffnung mit Lesung & Musik Sie ist eine... |
| Ausstellung |
|
ZETTEL, ZITAT, DING: GESELLSCHAFT IM KASTEN Ein Projekt von Margret Kreidl
ab 11.06.2018 bis Juni 2019 Ausstellung | Bibliothek Der Zettelkatalog in der... |
| Tipp |
|
flugschrift Nr. 24 von Lisa Spalt
Wenn Sie noch nie etwas vom IPA (dem Institut für poetische Allltagsverbesserung) gehört haben,... |
|
Literaturfestivals in Ă–sterreich
Sommerzeit - Festivalzeit! Mit Literatur durch den Sommer und quer durch Österreich: O-Töne in... |