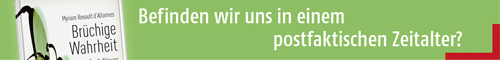1.4.2017 – Palmyra
Die Amseln singen wieder am Abend und am Morgen, auf meiner Tanne, im Wacholder und von meinem Dach herunter, als hätten sie mich dabei im Auge. Sie singen dann nur für mich, ist ja sonst niemand mehr da, der sie hört. Die Spaziergänger sind schon zuhause.
Und ich denke: wenn ich soviel leben darf bei Tag und bei Nacht, dann kann ich doch früher gehen? Ich möchte mir diesen Wunsch vielleicht wieder erlauben dürfen, wo er nach dem Tod meiner Tochter, für den sie sich selbst entschieden hat, bis heute tabu für mich war.
Vielleicht ist ja meine Angst vor dem Ende, die immer so nah ist und mich bei jeder noch so kleinen Gelegenheit anspringt, eine Angst vor dem Wunsch. Und ich möchte ihm das Verbot wieder nehmen. Unverboten soll er sein. Dann ist Bleibenwollen erst richtig gut.
Ich hatte eine Freundin, die mich kannte, wie sonst niemand. Wir haben über alles miteinander sprechen können. Nachdem sie umgezogen war, ging das fast nur noch mit dem Telefon. Oft rief sie an, um mich zu fragen, ob das eine oder andere körperliche Symptom gefährlich sei. Diese Hypochondrie hatte zur Folge, dass ich nicht mehr alles ganz ernst nahm. Als sie so gar keine Ruhe finden konnte und immer wieder nachhakte, sagte ich, was sie dachte – aus der Erfahrung heraus, dass wir oft mit Lachen aus so einem Strudel herausgekommen waren – „das ist bestimmt ganz schlimm und du stirbst daran bald -“
Schlimm war es wirklich: als ich aus Algerien zurückkam, wohin wir gemeinsam hatten fliegen wollen, war sie tot.
Sie soll zuletzt davon gesprochen haben, dass ich gerade allein in Algerien sei.
Wir könnten auch über Kaurismäki reden und würden miteinander neue Gedanken finden. Verdammt, Waltraud fehlt mir immer noch.
Die andere Seite der Hoffnung. Es ist ein Glücksfall, wenn einer wie Kaurismäki die Flüchtlinge in Finnland, also Europa, zu seinem Thema macht und damit gegen seine Regierung spielt.
Es sei sein letzter Film, sagt Kaurismäki. Auch so einer „das-sind-jetzt-aber-die-letzten“. Ihm glaubt man auch nicht.
Aleppo, Palmyra, Timbuktu werden zusammen genannt, wo es um noch bedrohtes und schon verlorenes Weltkulturerbe geht.
Palmyra. Auch diesen Ort habe ich geliebt. Und mein Freund aus Nazareth diesen Text. Er hat ihm am besten gefallen von den neun Begegnungen auf meiner Reise durch Palästina: Israel, Ägypten, Jordanien, Syrien und wieder Israel 1993. borderline habe ich sie genannt.
Syrien 1993Palmyra
TadmorRaida. Die Vorbildliche.Wenn ich nur wüsste, was ich euch glauben soll.
Das Foto: Ich in der Mitte halte in jedem Arm ein Mädchen, das sich an mich schmiegt und den Kopf an meine Schulter lehnt: die strahlend zu mir aufschauende Salwa. Zwei weitere Freundinnen an den äußeren Plätzen. Hinter uns lächelt der Präsident der Arabischen Republik Syrien – Assad – von der Säule am Eingang einer Moschee.
Ich lasse das Bild viermal vergrößern, damit jede, die darauf zu sehen ist, eines bekommt, dazu schreibe ich an Salwa, wie es mir weiter ergangen ist, nachdem ich Aleppo verlassen habe, und dass ich wiederkommen möchte. Ob sie nach Deutschland kommt? Dann bitte ich meinen palästinensischen Freund, mir die Adresse zu übersetzen. Er liest, liest lange, viel zu lange für die wenigen Zeilen, er sucht, schaut mich fragend an und sagt schließlich: das ist keine Adresse. Das ist eine Wegbeschreibung. Auch kein Name. Nicht einmal ein Vorname, der würde auch schon genügen.
Aber ich weiß ja nicht einmal, ob sie wirklich Salwa hieß oder ob der Klang dieses Namens erst später in meinen Ohren zustande gekommen ist.
Salwa ist so schnell verschwunden wie sie aufgetaucht war. Vor der Moschee beim Handwerkerbazar in Aleppo war mir dieses Mädchen, schon eine junge Frau, entgegengetreten, hatte mich freundlich und neugierig begrüßt – in einem Englisch, dem man anmerken konnte, dass es nicht oft gebraucht wurde. Wo ich herkäme, hatte sie wissen wollen, wie lange ich schon in Syrien sei und wie mir Syrien gefiele.
Und dass sie sich freue, mich zu treffen, ob sie mich begleiten dürfe, mir etwas zeigen? – Ob sie denn Zeit hätte? – Natürlich! Der Unterricht sei nicht mehr wichtig, jetzt, wo sie mich getroffen habe. So bot mir Salwa, eine Studentin, die Lehrerin werden wollte, sich, ihre Zeit, ihren Tag an, gab auf der Stelle ihre eigenen Pläne auf, um für mich da zu sein. – Der Lehrer? Ach, der sei kein Problem, nein, wirklich nicht. – Sie und ihre Freundinnen standen nun um mich herum, auch die größte von ihnen war immer noch einen Kopf kleiner als ich. Salwa und eine Freundin, die uns später noch ein Stück begleitete, hatten das hellblaue Kleid einer Uniform an und dazu die weißen Kopftücher eng und tief in das Gesicht gebunden, eine andere trug eine bunte Bluse und einen knielangen Rock und ein dazu passendes farbiges Kopftuch und die vierte einen schicken Hosenanzug und gar kein Kopftuch. Sie gehörten zusammen, seien in der gleichen Klasse, und auf meine Frage, wie die Unterschiede zwischen ihnen zu verstehen seien, wie sie mit ihnen lebten, erzählte Salwa lebhaft und begeistert, als hätte sie nur auf gerade diese Gelegenheit gewartet: das sei überhaupt kein Problem, im Gegenteil. Allahs Größe zeige sich gerade darin, dass es so viele verschiedene Menschen nebeneinander gibt. Die Mädchen umringen mich, wollen mit mir fotografiert werden und sprechen einen Jungen an, um ihn darum zu bitten. Ich sage: Ihr könntet meine Töchter sein! und eine antwortet: You are a beautiful mother! – Sie hat mich keine fünf Minuten gesehen – good bye. Schon dreht sie sich um und weg ist sie.
Wenn ich nur wüsste, was ich glauben soll.Ob ich ihr Institut besuchen wolle, fragte mich nun Salwa, gerne, sagte ich und dachte, sie würde mich gleich mitnehmen, wie sollte ich es sonst finden, aber so war es nicht gemeint, sie wollte mir die Adresse aufschreiben und den Weg dorthin. Sie tat dies auf arabisch, das kann ich nicht lesen, aber das macht nichts, sagte ich, zuhause habe ich einen Freund, der ist Araber und er wird mir helfen. Ich würde ihr die Fotos schicken, wenn ich wieder in Deutschland bin.
Dann schrieb ich ihr auch meine Adresse auf.
Salwa wollte nun mit mir gehen und mir die Dinge zeigen, die die Handwerker hier herstellten. Sie selbst lebte in ihrer Schule, ihre Mutter besuchte sie einmal im Monat in einem Dorf südlich von Aleppo, aus dem sie stammte. Der Vater sei weggegangen und nicht wiedergekommen, jetzt zog die Mutter allein die vier Geschwister groß. Salwa war die Älteste.
Ob ich etwas kaufen wolle, fragt sie mich. Vielleicht – aber ich brauche noch Geld. Es ist Donnerstag, ich sehe auf die Uhr, die Commercial Bank of Syria schließt in einer Viertelstunde und macht erst übermorgen wieder auf. Fast hätte ich es vergessen, dass dies hier ein Samstag ist. Salwa will mich begleiten, nein, der Unterricht bedeute ihr heute gar nichts, wo doch ich da bin. Und immer wieder ihre Beteuerungen, wie froh sie sei, mit mir sprechen zu können und bei mir zu sein.
Wir müssen uns beeilen, ein Stück mit dem Taxi zurücklegen, dann wieder ein Stück laufen, diese Zweigstelle wird gerade umgebaut. Nachdem wir zwischen Zementsäcken und Werkzeugen durchgestiegen sind, finden wir die Wechselstelle geschlossen. Wir müssen noch weiter, als wir die bezeichnete Stelle erreichen, steht dort eine lange Schlange vor dem geschlossenen Fenster. Da kann ich mich einreihen. Salwa ist plötzlich unruhig geworden, spricht von einem Bild, das sie heute noch dem Lehrer zeigen wolle, ich sage, ich würde mich schon zurechtfinden. Wirklich? – ja, bestimmt. Dann: bye. bye. Sofort dreht sie sich um und eilt mit ihren kleinen Schritten davon, ohne sich noch ein einziges Mal umzusehen.
Wenn ich nur wüsste, was ich euch glauben soll.Natürlich finde ich mich zurecht. Aber so allein war ich nicht, bevor ich sie getroffen habe. Ich habe Angst davor, in euer Vergessen zu stürzen. Salwa ist verschwunden. Wie Raida auch. Raida.
Als ich Raida in dem Paradies fotografierte, in das sie mich geführt hatte, wusste ich noch nicht, dass ich nie ein Bild von ihr haben würde.
Ihre ausgestreckten Hände, ihre leuchtenden Augen zeigten mir, dass sie sich nichts Schöneres vorstellen konnte, als dass ich das tat, wozu sie mich aufforderte: dass ich ihr folgte. Ihre Worte, die sie einmal und noch einmal wiederholte, als könnte sie nicht glauben, dass ich nicht verstand, was ihr so selbstverständlich über die Lippen ging. Wenn sie es noch einmal sagte, lauter, deutlicher, immer dasselbe, dann musste ich sie doch verstehen! Nichts verstand ich.
Ich schüttelte den Kopf, zuckte mit den Schultern, lächelte, lachte, lächelte wieder, zuckte wieder mit den Schultern, strich ihr über die Haare und schüttelte wieder den Kopf. Bis sie ging. Was sollte ich sagen. Ich schlenderte weiter. Den Römern hinterher.Raida kam wieder. Dieses wunderschöne Kindergesicht mit dem strahlend-offenen Blick, dem lachenden Mund und dazu die gleichen Gesten, die gleichen – so vermute ich – Worte. Das ganze Mädchen ein einziges Versprechen: Du machst mich glücklich, wenn du mit mir kommst. So habe ich die Römer und ihre Grabtürme gelassen und bin mit Raida gegangen. Sie nahm meine Hand, die noch ein bisschen von den Datteln klebte, die ich gerade geschenkt bekommen hatte. Zwei junge Männer in langen grauen Kleidern und mit um den Kopf geschlungenen Tüchern waren vor mir von ihren Fahrrädern gesprungen, der eine hatte mit beiden Händen in die Kiste auf seinem Gepäckträger gegriffen und mir dunkle Datteln entgegengehalten, der andere hatte mir einen Granatapfel gereicht. Schukran, schukran! So viele, nein!
Es half nichts. Schukran. Inzwischen hatte ich im Weitergehen und später auf einem Säulenrest sitzend die süßen Datteln gegessen, da war Raida wiedergekommen. Nun ließ sie mich keinen Augenblick mehr los, zart und fest hielt ihre kleine Hand die meine. Sie zog mich von dem Weg fort, den ich gekommen war und der, wenn man ihn ein paar Tage lang weitergehen würde, nach Damaskus führte, zog mich von den Säulen weg zur Seite, und als wir zu einem Eselskarren kamen, befahl sie mir aufzusteigen. Als ich dies getan hatte, lachte sie wirklich, als wäre sie glücklich, küsste meine Wange, streichelte meinen Arm – sie schien stolz und froh – streifte mit der freien Hand vorsichtig, zärtlich und selbstverständlich meine Haare hinter das Ohr und redete in einem fort zu mir. Immer die gleichen Wörter, dabei beobachtete sie gespannt meinen Gesichtsausdruck: vielleicht verstand ich ja endlich doch.
Der den Esel antrieb, sprach ein paar Worte englisch. Wie alt ich sei, wollte er wissen – dass sie das immer zuerst interessiert – , genauso alt wie er, stellte sich heraus – er nickte zufrieden – und in wenigen Minuten waren die Familienverhältnisse geklärt. Auf die Idee, was er erfahren hatte, dem Mädchen, das mich ununterbrochen so erwartungsvoll anschaute, zu übersetzen, kam er nicht. Und Raida hätte es nicht verlangt, sie schien schon so glücklich mit dem, was sie hatte. Wenn ich zu ihr hinuntersah, bemühte sie sich schnell, einen Riss in ihren Jeans zusammenzuhalten, damit ich ihn nicht sah, und ihr Lachen wurde leiser und ein bisschen verschämt.
Der Esel hatte sich inzwischen in Bewegung gesetzt und die Tempelstraße verlassen, jetzt war es nur noch ein schmaler Weg zwischen Olivenbäumen und unter Dattelpalmen hindurch, der Esel schwankte, der Karren schaukelte, einmal nach rechts, dann wieder nach links und umgekehrt und das so oft, dass ich bald sicher war: Man würde mich führen müssen, wenn ich hier wieder herauskommen sollte. lm Vorbeifahren Zurufe, Begrüßungen, freundliches Winken von überall her. Radfahrer überholten uns, oft waren es zwei Männer oder zwei Jungen oder ein Mann und ein Junge auf einem Rad, schnell und geschickt nahmen sie ihren Weg und waren an der nächsten Biegung schon wieder verschwunden.
Dort stand jetzt ein Mann neben seinem Fahrrad, der lachte, als er uns kommen sah, Raida winkte und rief ihm etwas zu, da zog er das lange Gewand ein Stück hinauf, stieg auf sein Rad und fuhr vor unserem Karren her, bis wir an ein Gartentor kamen. Der Esel hielt, und Raida bedeutete mir nickend, dass ich absteigen sollte, wir waren da. Ihr Vater war es, den wir getroffen hatten, er begrüßte mich jetzt – welcome in Syria –, öffnete ein Tor, lud mich zum Eintreten ein und machte das Tor wieder zu. Raida zog mich stolz weiter, nun strahlte sie noch mehr, manchmal ließ sie kurz meine Hand los, um ein Stück voraus zu hüpfen, sie rief etwas, dann kam sie schnell wieder zurück. Ein Junge, dessen Gesicht dem ihren sehr ähnlich sah und der einen Kopf größer war als sie, kam zwischen den Olivenbäumen hervor, dann noch einer, noch einen Kopf größer, und dann eine Frau, nicht mehr jung und schon ein bisschen dick in ihrem langen Kleid und mit einem Kopftuch um das runde Gesicht. Alle gaben mir die Hand, die Brüder und die Mutter, und Raida breitete die Arme zum Boden hin aus, damit ich mich hinsetzte. So machte ich es dann. Da lachte die Mutter und schickte Raida fort, sie lief und kam wieder, mit einem dünnen Teppich unter dem Arm, den sie nun vor mich hinlegte. Darauf sollte ich mich setzen, so war es gut. Zufrieden hockte sich Raida neben mich und begann sofort wieder zu erzählen. Was wohl. Es müssen auch Fragen gewesen sein, denn sie machte Pausen, in denen sie mich anschaute, wartete, als sei ich nun dran. Wenn ich die Schultern hob, sprach sie lauter, bis sie merkte, dass auch dies vergeblich war. Dann war sie still.
Aber nicht lange und sie machte einen neuen Versuch.
Inzwischen waren der Vater, die Mutter und der große Bruder ihrer Arbeit nachgegangen, sie ernteten die schwarzen Oliven. Nach einer Weile verschwand die Mutter, sie nahm Raida mit. Als beide wiederkamen, trugen sie in Tücher eingeschlagene Töpfe und Schüsseln, die sie nun auspackten und auf die Decke stellten: Gemüse, in Olivenöl gedünstet, Kartoffeln, Käse und ein paar Fladen Brot, um die Dinge aus den Schüsseln zu greifen.
Von dem Vater erfuhr ich nun, was Raida mir nicht hatte sagen können: dass die Familie hier nicht wohnte, sondern dies der Garten des Großvaters war, dass sie jeden Tag hierher kamen, um darin zu arbeiten, denn das, was der Vater als Direktor der Schule von Palmyra verdiente, genügte nicht, um die Familie zu ernähren. Fünf Kinder hatte er, eigentlich wären es sechs, aber ein Mädchen sei gestorben, so erzählte er, und die Mutter nickte lächelnd. Raida besuchte die erste Klasse seiner Schule, der kleinere der beiden Brüder, Ahmed, die zweite. Raida – ihren Namen hörte ich jetzt zum ersten Mal.
Er mache jeden Morgen, bevor er in die Schule ging, eine Runde durch den Garten, erzählte der Vater weiter. Wo ich wohnte. Wenn ich Lust hätte, könnte ich in diesem Garten die Nacht verbringen, es gebe Touristen, die das gerne tun. Wann ich morgen aufstünde, fragte er mich, um halb sechs gehe die Sonne hinter den Ruinen auf, ob ich schon auf der Burg gewesen sei – nein, noch nicht –, von dort hätte man den schönsten Blick auf den Sonnenaufgang.
Als wir schon satt waren, machte noch Satar die Runde, dieses Gemisch aus Gewürzen, in das man das in Olivenöl getauchte Brot drückt und dem eine kraftspendende Wirkung zugeschrieben wird. Der Vater stellte die Schüsseln zusammen, nachdem er die Reste sortiert und in zwei kleine Töpfchen gefüllt hatte. Die Mutter band wieder die Tücher darum und trug das klein und leicht gewordene Bündel fort. Auch der Vater und der große Junge standen nun auf und gingen wieder an ihre Arbeit.
Raida war während des Essens keinen Augenblick von meiner Seite gewichen, als sie fertig war, lehnte sie sich an mich und schaute zufrieden, glücklich zu mir auf. Ahmed holte Datteln und begann mit ihnen ein Spiel, bei dem man die Datteln hochwerfen und sich gegenseitig wegnehmen musste. Eine Regel, nach der das Wegnehmen geschah, konnte ich nicht erkennen. Ich machte nach, was mir Raida und Ahmed vormachten, die beiden lachten, wahrscheinlich habe ich etwas falsch gemacht, das schien sie aber weiter nicht zu stören, sie freuten sich. Dann kam die Mutter mit dem Tee. Alle tranken ein oder zwei Tässchen, und ich machte noch ein Foto und bat den Vater um die Adresse, damit ich ihnen die Bilder schicken könnte.
Morgen! sagte er und lachte, morgen früh, beim Sonnenaufgang treffen wir uns am Hotel Zenobia. Dann standen der Vater und die Mutter wieder auf, um leere Gefäße für die Oliven zu holen, und Raida bekam wohl den Auftrag, darauf zu achten, dass meine Tasse nicht leer würde ~ nicht anders konnte ich den Vater verstehen, als ich nun sah, wie Raida mein Tässchen nicht mehr aus den Augen ließ, schon bei jedem dritten Schluck wieder nach der Kanne griff und überhaupt keine Rücksicht auf meine dankende Handbewegung nahm. Schukran, schukran genügte nicht, khallas musste ich schließlich sagen. Schluss.
Ich legte mich zurück und schaute zwischen Olivenbäumen und Dattelpalmen hinauf in den Himmel. – Wer hat etwas von einem Paradies gesagt? – Der Wind, der heute morgen den Sand aus der Wüste durch die Straßen fegte, hatte sich wieder beruhigt. Aber er hatte einen Schleier vor das Blau gezogen, an dessen Unveränderlichkeit ich mich in den langen Wochen gewöhnt hatte. Sie sagten alle, dass jetzt der Winter kommt.Ich hatte die Arme unter meinem Kopf verschränkt, und dabei waren die weiten Ärmel meiner Bluse hinaufgerutscht. Noch ehe ich es bemerkte, hatte Raida das schon gesehen und sie duldete es nicht. Als ihr Blick auf meine entblößten Arme fiel, streifte plötzlich ein Schatten ihr Gesicht. Mit einer raschen Bewegung ihrer kleinen Hände griff sie nach meinen Armen und legte sie so zurecht, dass sie die Ärmel der Bluse wieder bedeckten. Dann setzte sie sich zurück auf ihre angewinkelten Unterschenkel, verschränkte die Arme vor ihrer Brust, und schaute mich, den Kopf leicht zur Seite geneigt, nachdenklich an. Ich schämte mich ein bisschen und setzte mich wieder hin.
Es war Zeit zu gehen. Ich zeigte Raida, dass ich das vorhatte, und sie rief ihren Vater, der schlug seinen Rock hoch bis zu den Knien und kletterte die nächste Palme hinauf, um frische Datteln für mich zu pflücken. Als seine Taschen voll waren, kam er wieder herunter und leerte sie in meine Hände, ganz gelb waren sie noch. Dann brachten mich alle ans Gartentor neben einem Granatapfelbaum, von dem ich noch eine Frucht annehmen musste, und der ältere Sohn, den ich kein einziges Wort habe sprechen hören – zu mir sagte er, wenn ich ihn etwas fragte, nur immer wieder: yes, yes! – bekam den Auftrag, mich so weit zu begleiten, bis ich mich wieder alleine zurechtfand.
So bin ich gegangen.
Raida hatte den Kopf gesenkt. Nur noch wenige Augenblicke sah ich ihr Gesicht: die tiefen, jetzt noch dunkleren Augen, die leicht vorgeschobene Unterlippe, dann drehte sie sich – eine Schulter leicht hochgezogen – mit einem entschlossenen Ruck um, warf dabei den Kopf in den Nacken und ging mit festen Schritten in den Garten zurück. Das gelbe Leuchten ihres T-Shirts war plötzlich erloschen wie die Blüte eines Forsythienstrauchs. Der Vater winkte noch lange, immer wenn ich mich umsah, hob er den Arm, dann ging auch er durch das Gartentor und schloß es hinter sich.
An der Straße stehen die Männer, die Oliven und Datteln verkaufen, die sie aus ihren Gärten hierher gebracht haben. Dunkelbraune, hellbraune, gelbe Datteln entlang der Straße so weit man sehen konnte. Die gelben sind die gerade geernteten, die noch nicht so süß sind. Wenn man sie schnell braun und süß haben möchte, muss man sie einen Tag lang mit Plastikfolie einpacken, am besten noch an den Zweigen in eine Tüte stecken und diese zubinden, dann sind sie am nächsten Tag schon so braun, wie wir sie kennen.
An der Straße, die von dem Tempelfeld in den Ort führt, haben Dattelverkäufer ihre offenen Hütten bezogen. Dort wohnen sie, bis alle Datteln verkauft sind.
Dann wird es Weihnachten sein. Weihnachten.
In der Nacht fielen die ersten Regentropfen. Da haben die Restaurants und Hotels schon eine Stunde früher ihre Türen zugeschlossen. Der Winter! Der Winter! Endlich der Winter. Er wird fröhlich begrüßt. Der Sonnenaufgang ist verborgen geblieben. So habe ich Raidas Vater nicht mehr getroffen.
Dass meine Kamera schon mit dem ersten Bild von Palmyra erblindet war, wusste ich da noch nicht. Ein Riss in der Verschlusskappe ließ alle Bilder schwarz werden.
Raida werde ich nie wiedersehen. Aber den Ruck, mit dem sie sich umdrehte und weglief, den spüre ich noch immer als einen Schmerz. Dieser Sturz kann mir jederzeit passieren, auch hier, in meiner Küche, in meinem Bett.
Wenn ich nur wüsste, was ich euch glauben soll.
Euer Schweigen ist noch schwerer zu verstehen als eure Worte. Raida ist verschwunden, Salwa auch.Eine Stimme meldet sich leise, die mir sagt: träfe ich sie eines Tages wieder, so wäre ich wieder alles für sie – solange bis sie sich umdreht.
Um halb acht Uhr am Morgen ruft der Muezzin. Gebetszeit – jetzt? Auch wenn seine Rufe schon zusammengerückt sind zwischen vor Sonnenaufgang und und nach Sonnenuntergang: dies ist nicht seine Zeit. Ein Tod wird gemeldet.
In Palmyra ist heute Nacht einer gestorben.
Aus Heide Tarnowski: überallundnirgends. 2017 mit 74 – Ein Tagebuchroman. Sonderausgabe von literaturkritik.de im Verlag LiteraturWissenschaft.de