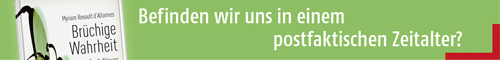11.-12.4.2017 – Einbaum
11.4.2017
entgegen gewachsen
heute Nacht
und reicht mir ihr Weiß ihr Gelb
und ihr Blau aus dem Grün
Um sechs Uhr hat mich die Amsel in den Tag gesungen, um sieben hat ihr Flügel fast meine Wange gestreift, diese Kraft hat mich zum zweiten Mal geweckt.
Der Vollmond ist mit Blitz und Donner heraufgestiegen. Mal war er nur kurz da und gleich wieder weg. Laut trommelt der Regen aufs Blechdach und hört damit gleich wieder auf. Jetzt hat der Mond freie Bahn, begleitet vom Jupiter. Den melden sie schon in den Nachrichten, gleich nach dem Krieg.
Das soll alles in einen Kopf. Wie der Dadord aus Franken, der wohl alles abarbeiten wollte, was unsere Flüchtlinge angeht. In Bamberg. In 90 Minuten?!?
12.4.2017
Hier habe ich eigentlich keinen Namen, außer Frau Yalla. Den habe ich vor zwei Jahren bekommen. Und jetzt habe ich noch einen. Als ich von den Feldern zurückkomme, begegne ich einem Paar, das immer wieder gerne nach meinen Tieren schaut. Deshalb frage ich sie, ob sie vielleicht den Hund nehmen wollten, wenn ich zum Beispiel ins Krankenhaus müsste, was ich gefürchtet habe, als das Knie so dick und heiß geworden ist. Die beiden waren begeistert: „Natürlich, gerne!“ Wo sie doch gerade beide in Pension gehen. Wir nahmen uns vor, die Telefonnummern und Adressen auszutauschen. „Wissen Sie, wie Sie bei uns heißen?“ fragt dann die Frau. „Frau Tuareg!“ – ??? – „Seit der Ankündigung von Ihrem Vortrag in der Zeitung – das war doch: Mit dem Einbaum durch die Wüste? – sagen wir immer: die Frau Tuareg. Ihren Namen konnten wir uns nicht merken.“ Das soll jetzt anders werden.
Ich fühle mich beschenkt, als ich heimkomme. Frau Tuareg. Eine Verwechslung oder eine Auszeichnung? Heute war es ein kurzer Weg nach Mali.
Sollte Afrika für mich wieder offen sein? Wenn ich den Hund versorgt wissen kann, könnte ich noch einmal fliegen wollen?
Der Einbaum ist da. Ich musste ihn lange suchen, hat sich in Timb2 versteckt.
Mali Februar 2007Mit dem Einbaum durch die WüsteAm Abend vor der Pirogenfahrt hole ich mir Mineralwasser, acht Liter habe ich in meinem Rucksack. Ich gehe den Weg durch die Gassen, den ich immer gegangen bin, da sehe ich auf einmal nichts, gar nichts mehr. Stockfinster ist es. Kein Licht natürlich, aber auch kein Mond. Frauen rufen: Madame, tu va tomber! – du wirst fallen! – Ich gehe weiter, bin ich doch hier immer gelaufen, und schon stolpere ich über einen Felsbrocken und gleich über noch einen und falle, der Rucksack zieht mich schwer nach hinten. Schulter, Knie, Ellenbogen tun weh, aber ich rapple mich sofort wieder auf. Die Frauen stehen erschrocken um mich herum, ich hole meine Taschenlampe heraus und sehe jetzt die Steine, die ich sonst immer umgangen habe, weil der Mond so hell schien.
Am nächsten Morgen bringt mich Mamadou mit seinem Auto – in diesem Jahr hatte er eins, damit konnte er seine Klienten selbst herumfahren – nach Koriome und übergibt mich dort Musa. Der soll mich ein paar Tage mit einer Piroge langsam und leise den Fluss hinunter und wieder herauf schaukeln.© H. Tarnowski
Ja – schaukeln. Ich werde geschaukelt wie in einer Wiege – wieder so ein Wort mit W – w wie weich wie warm wie warmer Wind wie Wasser wie Afrika. Ich werde geschaukelt vom Staken und von dem Wind, der eigentlich ein Sandsturm ist und Wellen an die Piroge klatschen lässt. Wasser springt herein. Musa hebt die Stange hoch, lässt sie mal rechts, mal links fallen und hängt sich dann mit seinem ganzen Körpergewicht daran. Wenn wir am Ufer gleiten, setzt er sich hin und nimmt ein Paddel. Noch nie bin ich so nah am Rand gefahren. Manchmal scheuert die Piroge auf dem Sand und bleibt stehen, das Wasser ist schon sehr flach, wir laufen wieder auf. Das machen wir ein paarmal, rückwärts, vorwärts, rückwärts, vorwärts… bis wir uns befreit haben. Dann stochert Musa zurück und hält auf die Mitte des Flusses zu.
Ich mochte Musa gleich, als er mit eiligen Schritten auf uns zukam, um mich in Empfang zu nehmen. Klein und schmal ist er, hat ein ernstes Gesicht, in das sich Anstrengungen eingegraben haben. Er weiß, dass er mehr Mühe hat als andere, seinem Kopf die Erinnerungen abzuzwingen, wenn er die Namen der Dörfer, die wir sehen, aufzählt oder den Zahlen nicht traut oder sich ärgert, wenn er französische Wörter nicht weiß. Dann sieht seine Stirn wie eine Denkerstirn aus. Und das Denken tut ihm weh. Schon beim Einsteigen habe ich ihn eine Tablette nehmen sehen, am nächsten Tag nahm er wieder eine, zeigte auf seinen Kopf und mir die Packung: eine Hunderter Paracetamol. Er fragt mich, ob er eine oder zwei am Tag nehmen solle. Ich sage: eine. Und dass er mehr trinken soll, viel mehr. Aber er mag das Nigerwasser nicht, das hier getrunken wird, sagt er. Das kann ich gut verstehen. Mein Mineralwasser schmeckt ihm, aber dann trinkt er es auch nicht aus.
Wie ernst es ihm ist, es gut für mich zu machen. Umsichtig und in ständig vorausschauender Hilfsbereitschaft. Wie liebevoll er die Piroge ausgestattet hat: eine Matte zum Schuhe ausziehen, eine Matte die Pirogenwände hinauf und darauf eine Matratze, später legte er mir für den Rücken noch eine Decke zusammen. Dass es die kleinste Piroge sei, die es gibt, sagt er, 8-10m lang, mit 4 Querstangen.
Musa ist Analphabet und Französisch spricht er nicht, nur wenige Wörter tauchen schwer verständlich auf. Er sagt immer oui und dann macht er etwas ganz anderes. Es hat keinen Sinn, etwas im Voraus zu besprechen. Wenn es soweit ist, sage ich: hierhin! Dorthin! So geht es. Er scheint zufrieden damit.
Einen Tag lang kämpfe ich noch mit den Skrupeln, dass da einer sich für mich so anstrengen muss. Aber ich kann auch sehen, dass er die Arbeit gerne tut, die ich ihm gebe, und von der er eine Weile leben kann.
Frage ich nach einem Preis, zeigt er sein Geld, wenn er welches hat, wenn nicht, verlangt er, Münzen zu sehen, und wählt fix eine aus.
Musa stellt mir die Dörfer vor, die an uns vorbeiziehen. Er wiederholt ihre Namen immer ein paarmal: das klingt ungefähr so:
Tscheigita – Handou Bono Koina und Handou Bono Beber – Inali – Arnasei – Katanga – Tonka Haman Bab – Takankan (Bozo) – Bori – Iroua (Frafina, Koiroboro) – Dschabel (Bozo) – Krankran: das Bozodorf mit den Zwillingen
Am späteren Nachmittag halten wir nach einem Schlafplatz Ausschau. Nicht zu nah an einem Dorf soll er sein, sonst werden uns die Kinder nicht in Ruhe lassen. Flach am Fluss und oben in den Dünen ein paar Akazien für den Schatten am Morgen, so ist es gut. Wir nehmen alles aus der Piroge, was wir dabei haben. Ich lege Isomatte und Schlafsack in den Sand, Musa nimmt die Matratze und die Kissen und Decken. Und das Kännchen für den Tee und einen kleinen Topf, um Wasser zu kochen.© H. TarnowskiVon wegen: mal schnell einen Kaffee… Es dauert fast zwei Stunden, bis ich dem Nigerwasser traue. Musa hat nur ein ganz kleines Feuer gemacht.
Er legt eine Hand an seine Stirn und verzieht das Gesicht. Er hat wieder Kopfschmerzen. Vor dem Schlafen geht er noch einmal zur Pinasse, um mit der schon angebrochenen Kalebasse das Wasser herauszuschöpfen, das mit der Zeit durch die feinen Ritzen eindringt. Am nachtschwarzen Abend kommen drei Frauen am Fluss vorbei. Musa ruft sie zu uns heran, sie begrüßen sich, sprechen miteinander. Zu mir sagt er scharf: Prend les photos! Das ist ein Befehl. So mache ich das. Sie bekommen zwei Tütchen Nescafe und eine Handvoll Zucker, den sich eine der Frauen in den Zipfel ihrer Pagne knotet.
Die Frauen sind wunderschön, sage ich später zu Musa und er lächelt: ich weiß. Ich kenne sie.
Die Pirogen fahren die ganze Nacht. Immer wenn ich die Augen aufschlage, schiebt sich eine Piroge durch das Bild. So lautlos wie im Traum.
Als wir gefrühstückt haben, ist Musa glücklich. Er strahlt und streckt sich. Mit den Kuchen von gestern sei er jetzt stark. Dann verschwindet er, ohne etwas zu sagen. Eine Stunde später kommt er zurück und hat eine kleine Ziege auf dem Arm.
Bei der Frage nach dem Alter der Ziege und was sie jetzt frisst, wenn sie keine Mutter hat, macht er drei Striche in den Sand und streicht sie dann aus. Er redet dazu ununterbrochen, manchmal klingt es wie: Rien. Rien. Oder lait fini. – Nichts. Nichts. Oder: die Milch aus. Soll es heißen: drei Wochen trinkt die Ziege und dann bekommt sie nichts mehr, frisst alleine? Und sie wäre drei Wochen alt?
In der Piroge habe ich die Ziege auf dem Schoß. Sie scheint das zu mögen. Wie weich sie ist. So zart. Dann pinkelt sie auf die Matte. Was soll sie auch sonst tun.
Musa hat wieder Kopfschmerzen. Und wenn ich ihn richtig verstehe, will er sagen, dass er immer Kopfschmerzen hat. Ich gebe ihm Paracetamol auf Vorrat und versuche ihm verständlich zu machen, dass er mehr trinken soll. Aber besser Brunnenwasser statt des Nigerwassers. Von Abkochen fange ich gar nicht an zu reden.
Unser Mittagessen besteht aus Ölsardinen, Brot von gestern und Gurke.
Immer sind die Vögel so nah. Oder ich bin mitten unter ihnen, wenn sie sich in einem Hunderter-Schwarm kreischend in die Luft werfen.Musa betet, nachdem er mich nach der Zeit gefragt hat. Diesmal erledigt er sein Gebet zügiger als am Nachmittag. Er will heute noch nach Handou Bono Kaina, das Dorf, wo er zuhause ist.
Vom Gebet kommt er – wie so oft – mit Sand auf der Stirn zurück, den er nicht abwischt. Später führt mich Musa durch sein Dorf. Jeder wird begrüßt. In die Moschee muss ich gehen, das ist Musa ganz wichtig. Er führt mich in verschiedene Ecken und Winkel und macht mich auf die Ankündigungen aufmerksam. Verstehen kann ich nur die Uhren mit den Gebetszeiten. Und immer befiehlt Musa: Prend le photo!
© H. TarnowskiDann besuchen wir seine Familie. Man sitzt im Hof herum. Betrachtet mich, spricht über mich – so sieht es jedenfalls aus. Meine Geschenke habe ich verteilt. Die Kinder und auch die jungen Mädchen kommen näher und näher und fangen an, fordernd an mir herumzuzupfen, an meinem Top, meiner Weste, meiner Hose, zeigen auf meine Ohrringe, die Uhr und den Schmuck, den ich gerade von den Tuareg bekommen oder gekauft habe. Als sollte ich mir das alles auf der Stelle vom Leib reißen. Da wird es mir zuviel: das cadeau! cadeau!!! – Geschenk! – Als wir wieder gehen, ist keiner zufrieden. Und die Ziege schreit kläglich, als wir sie zurücklassen.
Abends haben wir noch Kaffee und Kuchen und Erdnüsse.
Morgen will mir Musa die Hippos, die Flusspferde, zeigen – Musa sagt immer „Popotames“ –, die hier hinter einer Insel vor Inali leben. Vor Sonnenaufgang würden sie zum Fressen an Land gehen. Wir werden morgen früh aufstehen.
Ich habe am Ufer schlafend auf die Hippos gewartet, die gegen Morgen ans Ufer kommen sollten. Aber sie sind ausgefallen.© H. TarnowskiDafür treffen wir auf Rinderherden!
Ein paar hundert Rinder werden in Herden mit 30, 40 Tieren von rennenden Jungen und jungen Männern in den Fluss gejagt, es sieht aus, als stürzten sich die Rinder hinein, so spritzt das Nigerwasser. Die jungen Männer schwimmen mit, schlagen mit Stöcken weiter um sich, die schweren Körper der Tiere liegen fast ganz unter Wasser, mit hoch gehaltenen Hörnern und Köpfen. Eine Herde und noch eine und noch eine – 20? 30? Die Männer kehren mit ihren Pirogen zurück, um die nächsten Herden ins Wasser zu treiben.
Am anderen Ufer hat sich eine festlich gekleidete Menschenmenge zum fröhlichen Empfang versammelt.
Kaum haben die Rinder Boden unter den Füßen, galoppieren sie auf das Dorf zu, lachend und schreiend springen die Menschen zur Seite. Am Ende kehren alle Pirogen langsam dorthin zurück, nur ein paar Tiere bleiben auf der anderen Seite bei den Ziegen und Schafen und Eseln.
 © H. Tarnowski
© H. TarnowskiWas man auf den Bildern nicht sehen wird, ist das Blöken, Muhen, Muhen, Muhen, und das Schreien der Kinder, das Trillern der Frauen.
Der Februar sieht anders aus als der Dezember oder der frühe Januar: ein breiter brauner Rand liegt zwischen dem Fluss und den Dünen. Die Bourgoufelder sind abgeerntet. Ich habe zwei große öffentliche Pinassen am Tag gesehen, keine einzige für Touristen. Schon eine, auch meine, Piroge läuft auf Sand. Musa schiebt rückwärts, probiert eine andere Richtung. Die flachen Sandstreifen laufen quer.
Der Reis ist geerntet, der Regen vergessen, wenn er sich nicht mit ein paar Tropfen in Erinnerung bringt. Wie in der letzten Nacht in Timbuktu. Da wusste ich gar nicht, wie ich das verstehen sollte. Ebenso wenig wie diesen Sandwindnebel.
Wind, Schaukeln, dass ich ein bisschen einnicke, Musa kämpft bis zum Schlafplatz gegen die ins Boot spritzenden Wellen.
Nachts fallen wieder einzelne Regentropfen. Musa fährt einmal hoch, sitzt senkrecht auf seiner Matte, legt sich wieder hin, um sofort wieder einzuschlafen.
Und so geht es nun tagelang: die Fische springen, die Flusspferde maulen, Ziegen meckern, Musas Stake schlägt an die Piroge und die streift an ihr entlang. Dann wieder ein kleines Plätschern beim Eintauchen. In der Luft die Stimmen der Vögel.
In Iroua wollen wir in einer Boutique ein paar Lebensmittel kaufen. Ein Tuareg winkt uns einladend heran und zeigt mir das Haus mit den Maschinen, die den Reis aus den Schalen schleudern. Dazu muss er die Leuchtröhre nur berühren. Seine Augen leuchten bei seiner Vorführung.
Vor dem Haus verliest eine Frau den geschälten Reis, nimmt die braunen Körner heraus. Am Fluss macht eine Schwangere die Arbeit für die Maschine, indem sie eine Schale nach der anderen schräg in den Wind hält. Die Körner fallen senkrecht, die Spreu trägt der Wind ein Stück weiter. Das macht sie heute den ganzen Tag, weil morgen Markt in Hondou Bono ist. Alle gehen oder fahren zum Markt an uns vorbei.
Es könnte eine Vorabendserie sein: die mit den Bourgoubergen hoch beladenen Pirogen von links nach rechts. Sie sind schon auf dem Weg zum Markt von morgen.© H. TarnowskiWir haben uns wieder zum Schlafen an einer Düne eingerichtet.
Der Himmel ist zum ersten Mal seit wir unterwegs sind nach oben ganz offen. Ich bin froh, dass ich wegen des späten Kaffees nicht einschlafen kann. Ich mag nicht lesen, nur schauen.
Schauen. Die Nacht ist feucht und kalt, der Schlafsack nass gegen Morgen und zum ersten Mal zu kalt. Musa gibt mir eine Decke. Dann der Morgen. Nur blau. Ein schmaler Streifen gelber Sand zwischen Himmel und Wasser. Das Wasser ein Spiegel.
Um 6 Uhr sind die Bourgou-Pirogen vorbei gezogen, eine Stunde später kommen die ersten Boote mit den Leuten aus den Dörfern, die zum Verkaufen – Reis, Fische, Schafe, Ziegen – und Einkaufen fahren.
Ein Mann reitet auf einem kleinen Pferd, das er zur Eile antreibt, beladene Esel werden angetrieben, die Schritte der Frauen mit den großen schweren Körben auf den Köpfen sind langsamer als die weit ausholenden der Männer. Schön angezogen sind sie alle.
Wir landen zwischen den vielen Pirogen, die wir seit dem frühen Morgen gesehen haben, und treffen auf dem Markt Musas Vater – ihm werde ich zuerst vorgestellt – und seine Mutter, eine etwa Vierzigjährige mit wunderschönen feinen Gesichtszügen. Bei ihnen sind verrotzte Kinder. Die Nasen werden einmal am Tag beim Waschen im Fluss sauber.© H. TarnowskiAuf dem Rückweg machen wir nur einmal Halt. Alles geht irgendwie schneller als in der anderen Richtung, obwohl wir doch gegen den Strom unterwegs sind.
Als wir in Koriome am Buschtaxi ankommen, sagt der Chauffeur: toute de suite – sofort. Auf dem Dach noch kein Gepäckstück und niemand auf den Bänken? Musa lädt mich auf einen Drink ein, für den er den 5000-er Schein, den ich ihm gegeben habe, gleich anbricht. Er will nichts trinken, aber wenn er neben mir sitzen will, muss er auch etwas nehmen – so verstehe ich die kurze Verhandlung mit dem Wirt. Ein Fanta, ein Cola. Ein Mädchen kommt mit frittierten Fischen vorbei, gleich liegt einer auf dem Tisch und wir sollen zugreifen. Mache ich gerne, die Fische sind fein. Dieser ist schnell weg. Der Wirt schiebt einen Eimer mit ziemlich dunklem Wasser unter dem Tisch durch zum Händewaschen. Darauf verzichte ich lieber und ziehe ein feuchtes Tuch aus dem Rucksack.
Musa ist froh. Über das Trinkgeld und überhaupt. Es waren gute Tage auf dem Fluss und wunderbare Nächte unter der Milchstraße und neben ihm. Tu es tres joli – sagt er zu mir. Ich glaube, auf Französisch hat er nur ein Adjektiv für eine Frau. Hübsch.
Nach dem Cola und dem Fisch begleitet er mich zu dem Buschtaxi zurück und bezahlt für einen zweiten Platz, damit ich in der Kabine – vorne allein neben dem Chauffeur sitzen darf. Ich hätte das nicht gemacht. Besinne mich aber darauf, dass ich für Musa eine weiße Tanti bin.
In diesem Jahr steht am letzten Tag in meinem TB:
21.2.2006Ich bin so sehr da, dass es manchmal fast weh tut. Wenn ich dieses Land in meinem Körper aufsteigen fühle, verbindet mich ein Strom von Kraft und Leben mit der Welt.
Das macht nur Afrika mit mir. Überall wo ich hinkam, konnte ich mich hinsetzen hinlegen und sein. Auf diesem Boden, im Sand, auf dieser offenen Erde. Sie gibt mir Weltvertrauen. Im Wind, im Sand, auf dem Wasser falle ich in Afrikas offene Arme.
Geborgenheit ist auch im Dunkel, im Netz der Stimmen, das sich über die Stadt legt und in den ersten Sanddünen festgesteckt ist.
Ich krieg die Augen nicht mehr zu. Fast unmöglich, die Augen über dem Gesehenen zu schließen.
Mein Staunen ist unendlich viel größer als ich. Es stieg auf aus dem Boden unter den Füßen, aus dem wie von selbst die Häuser wachsen. Aus dem offenen Schoß der Erde.
Die Sterne haben sich im Niger gespiegelt. Die Grillen und die Vögel ließen die Ohren überlaufen. Der lauteste Vogel am Fluss kam zu mir in der Nacht, wo ich am glücklichsten war, als ich einschlief. So tief war ich noch nie in der Welt.
Aus Heide Tarnowski: überallundnirgends. 2017 mit 74 – Ein Tagebuchroman. Sonderausgabe von literaturkritik.de im Verlag LiteraturWissenschaft.de