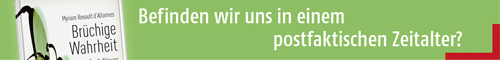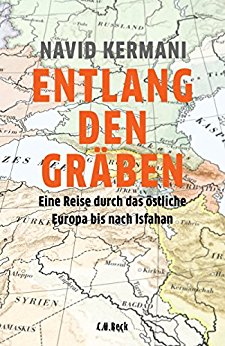24.5.2017 – Taba
Eine feine kleine Starenstimme ist zu hören. Dieser ziehende Ton von unten nach oben und wieder zurück, nur viel leiser, zarter, wie zögernd. Wo ist er, der Star?
Er sitzt seinem Häuschen gegenüber auf der alten Leitung und schaukelt in dem weichen warmen Südwind, der uns heute verwöhnt. Er ist noch nicht ganz ausgewachsen, seine hintere Hälfte ist grau. Noch einmal pfeift er, dann fliegt er los, ziemlich tief über dem Acker.
Wir machen uns auf den Weg den Berg hinauf, wo der Ginster blüht. Der hat sich inzwischen zusammen mit dem Bergahorn den Hang genommen, den der Tornado vor vier Jahren plattgemacht hat. Bis dahin war es ein dichter deutscher Tannenwald gewesen. Jetzt ist der Ginster da. Als wäre hier Kreta.
Soviel Ginster habe ich dort Ostern 1983 erlebt, als ich zu Fuß die Berge hinauf und hinunter von Dorf zu Dorf gelaufen bin. Von einem kleinen Hafen wollte ich nach oben, um dort weiterzulaufen, ich sollte den Steinen mit dem Farbklecks folgen, hat man mir gesagt, damit ich nicht ins Tal der toten Ziegen gerate. Das sei gefährlich. Habe ich so gemacht, bis ganz unerwartet ein Mann auf mich zukam, dem ich ausweichen wollte. Dabei habe ich die Farbkleckse verloren und nicht wiedergefunden. Nach längerem Suchen habe ich die Hoffnung auf ein Dorf für mich hier oben aufgegeben und wollte wieder ans Meer hinunter. War ziemlich steil, ich habe meinen Rucksack mit dem Ärmel eines Sweatshirts festgebunden und vor mir hinuntergelassen und bin auf dem Hintern und allen Vieren hinterher, vorbei an Ziegen und Ziegenschädeln mit Hörnern und ohne Hörner. Unten angekommen werde ich wiedererkannt: wo kommst du denn her? … Es ist das Dorf, wo ich morgens aufgebrochen bin und mein Weg war das Tal der toten Ziegen.
Zwei Köpfe habe ich mitgenommen und auch bei meinem Umzug nicht zurückgelassen. Sie liegen noch immer ganz oben im Regal.
Ein paar Tage später wollte ich durch die Samaria Schlucht hinauf. Es war schon Mittag vorbei, da ging keiner mehr los, man musste die Herberge oben vor dem Abend erreichen. Trotzdem wollte ich noch hinauf, ich würde überall schlafen können. Auf halber Strecke kam mir ein Esel entgegen, über seinen Rücken hing eine Last nach beiden Seiten herunter. Es war ein Mensch, ein Mann, ein Deutscher, den ein Stein erschlagen hatte. Ich musste zur Seite gehen, damit sie an mir vorbeilaufen konnten. Frau und Kinder würden auch noch kommen.
Ich habe es dann noch bis ganz oben geschafft.
In der griechischen Osternacht war ich dann auf dem Schiff zurück nach Piräus. Mitten in der Auferstehung. Das Schiff hatte seine festlich geschmückte Kirche dabei und überall dufteten die blühenden Zitronenzweige. Am Morgen dann Athen, die Ankommenden verliefen sich schnell, aber dann sah ich ein vertrocknetes hutzeliges Männlein noch ganz allein dastehen neben einem alten Koffer und einem zusammengeschnürten Bündel, aus dem die Beine eines Schafes herausstanden. Ich konnte nicht weg, blieb auf einer Bank sitzen, bis – endlich ! – ein flotter mittelalter Mann angerannt kam und den Alten in die Arme nahm.
Trump in Israel. Trump mit Kippa an der Klagemauer. Er berührt sie, hat kein Papier in der Hand. Trump bei Nethanjaus. Trump mit Abbas. Will er sich auch einen Friedensnobelpreis verdienen?
Mit den Saudi-Milliarden für Waffen in der Tasche?
Ich saß auf dem Balkon des Hostels am Jaffator, als Baker, Bushs Aussenminister, streng bewacht unten in die Altstadt lief.
Am nächsten Tag wollte ich nach Jordanien und musste den Weg über Ägypten nehmen. Ans Rote Meer.
Ägypten 1993Tabadie Zeit des Reísens ist gekommen
der Wind trägt meine Augen fortGestern Abend bin ich gelandet und heute morgen, beim Frühstück, habe ich erfahren, wo ich bin.
Ich bin bei Dunkelheit hier angekommen, nein: ausgesetzt worden. Mit ein paar jungen Israelis hatte ich in Taba gewartet, dass ein Taxi nach Nuweiba voll besetzt würde. Als niemand mehr über die Grenze kam, haben wir uns entschlossen, auch mit einer Person weniger loszufahren, eben wegen der bevorstehenden Dunkelheit. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, wo noch jemand hätte Platz finden sollen, musste ich mich doch selber am Gepäck festhalten, um nicht die Türe aufzudrücken, was immer wieder passieren könne, hat der Ägypter gesagt, und ein Israeli hat es übersetzt, der einzige von den vieren, der arabisch verstand und selbst sprach.
So klammerte ich mich, so gut ich konnte, an die Rucksäcke und in dieser fast liegenden Haltung hoffte ich, noch etwas davon zu sehen, wo wir waren: rechts die schwarze Wüste des Sinai, hinter dem gerade die Sonne untergegangen war, und links das Rote Meer, über dem der Mond – zu allem Überfluss noch ein Vollmond – aufging. So würde es eine Reise von Vollmond zu Vollmond werden – gut, dann weiß ich immer, woran ich bin.
Die Dunkelheit kam schneller als wir an unser Ziel, das Letzte, was ich erkennen konnte, war der helle aufgedunsene Kadaver eines Kamels rechts am Straßenrand, an dieser Stelle – ich dachte: die muss ich mir merken, damit ich zurückfinde – bog der Fahrer von der asphaltierten Straße ab und folgte einem unbefestigten Weg, der sich zwischen Palmen und Hütten und schwarzen Hügeln hindurchwand – nach der dritten Biegung gab ich es auf, mir den Rückweg zu merken –, um schließlich für mich völlig unvermittelt zu halten. Ich konnte gar nichts erkennen, keinen Ort, keine Häuser, also auch kein Hotel, nur wenig Licht in den Hütten, die in einiger Entfernung sichtbar wurden, nachdem sich das Auge an die Dunkelheit gewöhnt hatte, die nun eine vollkommene war. Der Mond noch zu schwach so tief unten.
Da hielt das Taxi, die anderen stiegen aus, sie waren am Ziel, Nuweiba hatten sie gesagt und bezahlten. Was sollte ich tun, ich bezahlte auch, versuchte dabei zu fragen „Nuweiba? Nuweiba?“ Dem leeren Gesichtsausdruck des Ägypters konnte ich entnehmen, dass ich mein Wort noch hundertmal würde wiederholen können, ohne dass ein erhellendes Verstehen über sein dunkles Gesicht streifen würde. So gab ich es bereits beim dritten oder vierten Mal auf, reichte ihm das Geld, das ich nicht kannte, und nahm meinen Rucksack aus dem Auto, alles sehr langsam, als hätte ich unbedingt Zeit zu gewinnen, so dass die anderen schon verschwunden waren, bevor ich mich umgesehen hatte. Ich konnte gerade noch erkennen, in welcher Richtung sie verschwanden, sie schienen zu wissen wohin.
Ich nahm die andere Richtung und war immer noch der Meinung, in Nuweiba oder Nuweiba ganz nahe zu sein, es lag nur noch an mir, es zu finden. Aber wie, wenn kein Licht aus Häusern zu sehen war. Nach welcher Seite sollte ich gehen. Einen fragen, dessen Gesicht ich erst erkennen würde, wenn er einen halben Meter vor mir stand, das wollte ich nicht. So ging ich ans Wasser, setzte mich in einen nach zwei Seiten mit Bambusmatten abgegrenzten und überdachten Verschlag, überlegte. Brauchte ich Wände? Es war warm, es würde die ganze Nacht warm bleiben. Der Sand war weich, da genügte das Handtuch für den Kopf. Ich hatte noch Trauben aus Jerusalem, deren Saft schon aus der Tüte tropfte, und Nüsse, auch Wasser genug. Ich würde die Nacht abwarten können, um am nächsten Tag zu sehen, wo ich war. So wollte ich bleiben.
Ich wurde ruhig.freedom is just another word for nothing left to loose
Ich richtete mich ein für diese erste Nacht.
Die Ruhe breitete sich aus, ohne an eine Grenze zu stoßen, eingebettet in das Staunen, dass man so in seinen Träumen landen kann.
Frei. Ich weiß nicht, wo ich bin.
So schnell nun auf einmal? Von einer Minute auf die andere? Ich hatte nur meine Füße auf diesen Boden stellen müssen? Diese Grenze lag hinter mir.
Und die Mühe, sie zu erreichen. Die Entscheidung für den vorletzten Bus aus Jerusalem, bevor die Sabbatruhe mich zwei weitere Tage in Unbeweglichkeit festhalten würde, um genügend Zeit für den Weg von Elat bis Taba zu haben. Die Entscheidung, nach Süden zu fahren und nicht nach Osten, schien sicherer ohne jordanisches Visum, konnte man doch nicht wissen, wie lange die Veränderungen oben brauchten, bis sie unten ankamen. Jedenfalls wollte ich sicher sein, dass ich heute meine Beweglichkeit wiedergewinnen und die Welt offen finden würde. Das Anrollen des Busses versprach es, dieser Augenblick des Loslassens ist allein schon eine Glücksverheißung.
Der Bus war überfüllt, wie fast alle Busse vor Beginn des Sabbat, die Leute stehen und sitzen in den Gängen, keine Möglichkeit, einmal die Haltung zu ändern, sich zurückzulehnen oder die Beine auszustrecken. Umso größer die Dankbarkeit für die Pause bei Masada und schon mitten in der Wüste, mittags um zwei Uhr. Schnell die Wasserflasche aufgefüllt und einen Stein im Schatten gesucht, um mich darauf hinzulegen, „twenty minutes“ hatte der Fahrer gesagt, das reichte für eine kleine Pause und um die Augen zuzumachen. Hupen. Das konnte mein Bus nicht sein, ich sah auf die Uhr: 10 Minuten waren erst vorbei. Ich machte die Augen wieder zu. Noch einmal Hupen, dann fährt ein Bus ab.
Im Augenwinkel lese ich gerade noch: 444.
Das ist meiner! Aufspringen, losrennen, rufen, winken, schreien – das ist alles eins, ein paar Motoradfahrer, die sich gerade abwechseln – „is it your bus?“ – schreien und winken mit. Es nützt nichts, der Bus fährt weiter, ich renne noch ein Stück, bis ich nicht mehr kann, das Stechen im Kopf, das Klopfen in den Ohren und in der Brust, dann kriege ich keine Luft mehr und muss stehenbleiben.
Das Ende. Und ich habe die Grenze noch gar nicht gesehen.
Neben mir hält ein Egged-Bus, der 39er, was los sei, fragt mich der Fahrer, mein Bus sei weggefahren, ich zeige nach Süden, und mit ihm mein Gepäck, ob ich mitfahren wolle, er nehme den gleichen Weg, ich steige ein. Don‘t worry, be happy, sit down. Don‘t worry, das wiederholt er jedes Mal wieder, wenn er mich nach Luft schnappen hört. Eine Unterhaltung ist im Gange zwischen den Frauen auf den vorderen Plätzen und dem Busfahrer, sie kommen aus Tel Aviv, fahren auch nach Elat, die eine versorgt den Fahrer mit Kakao aus einer Tüte, die andere schält ihm eine Orange.
Bequem ist es hier, viel Platz mit guter Aussicht. Aber wütend bin ich, der Fahrer hätte doch umschauen und den leeren Platz in der dritten Reihe sehen müssen, die anderen, die neben mir saßen, hätten sagen können, dass da noch jemand fehlt. So ist es, wenn man allein reist, da vermißt einen keiner. Das fing ja gut an. Bald ist der 444er mit meinem Gepäck vor uns, immer ein paar hundert Meter und gut zu sehen, als er an einer Haltestelle langsamer wird, fragt mich der Fahrer, ob er überholen solle, damit ich umsteigen kann, ja, sage ich, bitte, – dabei hatte ich gerade angefangen, mich hier wohlzufühlen – er beschleunigt und hupt und hält vor dem anderen. Ich solle schauen, ob es mein Bus sei, 444, ja, ich nicke, aber ich erkenne den Fahrer nicht wieder, es ist nicht derselbe. Trotzdem steige ich hier aus und dort ein, gebe dem anderen Bus ein Zeichen weiterzufahren, und zeige dem unbekannten Fahrer mein Ticket. „Dies ist nicht der Bus, es gibt zwei 444er. Deiner kommt 10 Minuten später, der macht immer eine längere Pause, und es ist ein langsamer Fahrer“. Ich könne hier mitfahren, don‘t worry, sit down, ob mein Freund in dem anderen Bus sei, nein, nur mein Gepäck, so solle ich hier bleiben, sie kämen alle an derselben Stelle an, don‘t worry. Draußen die Wüste, sonst noch immer nichts. Wir nähern uns Elat, mein Gepäck habe ich jetzt hinter mir. Angekommen an der Central Busstation bringt mich der Fahrer in einen Dienstraum und befiehlt mir zu warten, man würde mir Bescheid sagen, wenn mein Bus da sei, das sagt er auch zu den anderen, so warte ich. Alle sind beschäftigt mit Berichten und Abrechnungen, der Sabbat wirkt voraus, da vergessen sie mich. Nach einer Viertelstunde vergesse ich den Befehl und gehe selber nachsehen, ohne dass mich jemand beachtet. Natürlich ist mein Bus schon da und mein Rucksack das einzige Gepäckstück in seinem Bauch. Der Fahrer hat es noch nicht bemerkt, er räumt gerade seinen Fahrersitz, so nahm ich meine Dinge und ging.
Halb vier Uhr. Die meisten Geschäfte waren schon geschlossen, wann wird es hier dunkel, ich musste nun den Bus suchen, der mich zur Grenze brachte, aber davor noch einen Briefkasten für die Karten aus Israel. Auch die Post war schon zu und still war es um den Kasten, das machte mich unruhig, ich musste meinen Bus finden, ich wusste ja nicht, wann hier die Sonne unterging. So lief ich los in eine Richtung, die ich für die wahrscheinliche hielt, warum, das wusste ich auch nicht, bis ich einen traf, den ich fragen konnte. Ich musste umkehren, hatte mich getäuscht, aber es war gar nicht weit, ich fragte, wie lange der Bus heute noch fahren würde, das wusste der Mann auch nicht, er lief herum, um Hotelzimmer in Elat anzubieten für die, die nicht mehr über die Grenze gekommen sind. Kein Mensch an der Haltestelle, dann eine Frau. Gott sei Dank. Und dann kam die englische Familie, die Eltern mit ihren drei kleinen Kindern und ihren vielen Rucksäcken und Taschen, die ich schon in meinem ersten Bus gesehen hatte, sie hatten zwei Reihen neben mir auf der anderen Seite des Ganges besetzt. Sie fragten mich, wo ich denn gewesen sei, man hätte sich Sorgen gemacht, mich gesucht, der Fahrer sei noch einmal umgekehrt, ich hätte doch etwas sagen müssen. Ich fange an zu erklären, höre aber mit einigen Sätzen wieder auf, es sieht so aus, als verstünden sie mich nicht oder als könnten sie mir nicht glauben, sorry. Ein Bus – es ist ein kleiner, wir steigen ein, er macht eine Runde durch Elat, bevor er es verläßt, um zur Grenze zu fahren.
Nicht ganz, das letzte Stück war zu Fuß zurückzulegen.
Ausgestiegen konnte mich nun nichts mehr aufhalten. Da ließ ich mir Zeit. Ging langsam – wie es die Hitze verlangte – auf die Grenze zu, an den Autos vorbei, die auf ihre Abfertigung warteten. Es waren viele, denn diesem Sabbat würde das Laubhüttenfest folgen, das nutzten die Israelis für ein langes Wochenende in Ägypten am Roten Meer.
Ja, da bin ich wieder in der Sonne gelaufen, ohne Kopfbedeckung, ohne Schatten. Gewöhnte mich an das Gehen mit dem Rucksack, das zog das sowieso nicht kurze Stück noch in die Länge. – Warum fährt der Bus eigentlich nicht näher an die Grenze heran? – Im Zweifelsfall: Sicherheitsgründe, wie immer. – Den ersten Schatten gab das Kontrollhäuschen, wo nach der Bezahlung der Ausreisegebühren der Pass untersucht werden würde. Werden sie wieder fragen? Eigentlich müßten sie ja froh sein, wenn ich aus dem Land gehe, dann ist die Gefahr, die ich bedeutete, vorbei. Ich merkte, wie das Herzklopfen wiederkam, wenn ich an den Anfang dachte. Aber jetzt wollte ich ja nur hinaus, und das zu Fuß. Die Beamtin las eine Weile abwechselnd in meinem grünen Pass und in ihrem Computer, bevor sie mir den Pass zurückgab und mich verabschiedete.
Ich blieb im Schatten stehen, bis die Frau hinter mir, neben der ich schon das Stück hierher gegangen war, fertig war, ihr folgte ich, bis ich sie wieder aus den Augen verlor, man begrüßte sie hier und dort, man schien sie zu kennen, auch die Ägypter, auf deren Seite ich mich schon befand, ohne dass ich es eigentlich gemerkt hätte, ich musste mich noch ein paarmal umschauen, um zu sehen, dass wir durch eine Türe in einem Zaun gegangen waren. Das war alles. Dann warteten wir in einer Baracke zur Erledigung der Grenzformalitäten.
Jetzt hatte ich es gar nicht mehr eilig, im Gegenteil. Ich musste mich umsehen. So stellte ich erst einmal meinen Rucksack ab und versuchte herauszufinden, welchen Zeichen ich zu folgen hätte. Zuerst hatte ich den Eindruck, in dieser Baracke und überall, wo ich hinsehen konnte, gebe es kein einziges Zeichen. Ein Raum völlig leer von Informationen für meine Augen. Nur undeutbare Bilder, die mir gefielen. Der Klang der Worte meinem Ohr vertraut, doch unverständlich. Ein neues Land. Ohne Sprache, ohne Schrift.
Ich hing in der Luft.
Auch das Englisch, das zwischendurch zu hören war, hatte nicht mehr den Klang, an den ich mich inzwischen gewöhnt hatte, und gab mir Rätsel auf. Trotzdem hatte ich begonnen, die Karte für die Einreise, deren linke Hälfte englisch gedruckt war, mit schönen großen Buchstaben auszufüllen. Dazu habe ich den Pass genommen, der eben auf der anderen Seite gestempelt worden war. Dann kam mir der Gedanke, der – was ich nicht wusste – in diesem Augenblick der Reise ihr Ende setzen konnte: Ich würde jetzt mit dem anderen Paß beginnen, dann hätte ich alle arabischen Stempel in demselben, den ägyptischen neben dem syrischen Visum.
Das macht man nur einmal.
Ich zerriß die halb ausgefüllte Karte, nahm eine neue und begann das Ganze noch einmal von vorne, mit dem einzigen Unterschied: der Nummer des Passes. Ich wurde nicht viel gefragt, weniger als alle die anderen, die Israelis, die über das Wochenende kamen, und die wenigen Fragen – wohin ich denn wolle – Jordanien – schienen mehr aus Interesse und Neugier als aus Sicherheitsgründen gestellt. Noch eine Kontrolle. Eine auch bei Wiederholung unverständliche Frage. Ich wurde zurückgeschickt, eine andere Hütte sollte ich aufsuchen, um die Gebühr zu bezahlen, die mir einen gelben Schein verschaffte, ohne den es nicht weiterging. Dann war ich entlassen, konnte gehen, mußte gehen, mich umsehen wohin.
Zeichen? Keine.
Auf diese Leere war ich nicht vorbereitet. Hier schien mich nichts mehr zu erwarten.
Die Leute, die wie ich über die Grenze kamen, interessierten mich nicht.
TAXI. HOTEL? Nichts zu sehen. CAFE? Zuerst auch nicht, erst als ich meinen Blick auf Handschrift in geringer Größe umgestellt hatte, konnte ich an einer Hütte dieses Wort erkennen. Also ging ich dorthin.
Ein junger Mann und ein Fernsehapparat. Ein ägyptischer Spielfilm, der das immer schönere Leben versprach. Ich bekam Kaffee, ich bekam Wasser, ich bekam Auskunft. Über die Entfernung und die Preise von Hotels und wo sie liegen. 5 Minuten, 10 Minuten entfernt. Am Meer? Nein, auf der anderen Seite. Er könne mich hinbringen. Dem Preis nach zu schließen waren es Luxushotels. Ich sagte, dass ich überlegen wolle. Ein Zweiter kam herein, setzte sich zu dem anderen vor den Fernseher, als ich noch weitere Fragen stellte, antwortete er mit dem Jüngeren, indem er sich von dem Fortgang der Handlung auf das gute Ende hin ablenken ließ. Bot eine neue Variante an: Er habe ein Zimmer, das koste nichts, ich sei eingeladen. Wie alt ich sei. Wir hatten das gleiche Alter.
Das treffe sich gut. Ich bedankte mich, ich wollte ans Wasser. Er sah aus wie mein Vater.
Bis Nuweiba, meinem Ziel in Ägypten, um von dort aus nach Jordanien zu kommen, ist es eine halbe Autostunde. Der nächste Bus kommt erst abends, bis dahin müßte man ein Taxi nehmen.
Ich ging zu der Sammelstelle hinter dem Cafe, wo die Taxis mit ihren Fahrern auf Fahrgäste warteten, und sah mich um, ob es Mitfahrer nach Nuweiba gab. Gruppen von Deutschen, die ich zuerst fragte, wollten zum Katharinenkloster. Ach so, da bin ich also. Nein, dorthin will ich nicht, danke. Vielleicht ein andermal. Nuweiba. Nuweiba? Niemand reagierte. Komisch, ich hatte nicht erwartet, mich mit diesem Wunsch allein zu finden. Eine Weile jedenfalls.
Dann kamen die beiden Pärchen aus Israel, sehr jung, Freaks, ungekämmt und ununterbrochen rauchend. Sie waren froh um jeden, der mit ihnen fuhr, wurde es doch billiger und man kam eher fort, nun wartete man nur noch auf einen sechsten Mann. Wir redeten ein bisschen, einer fragte mich, was Surabaya bedeute, wegen Surabaya-Jonny, Brecht, Dreigroschenoper. Ich summe die Melodie. – Woher wissen die bloß schon wieder, dass ich Deutsche bin –
Nach einer halben Stunde entschlossen wir uns, nicht länger zu warten, eben wegen der Dunkelheit.
Jetzt liege ich in diesem Sand von Ich-weiß-nicht-wo-ich-bin am Roten Meer, falle in einen leichten, dämmernden Schlaf, in dem ich nach Jerusalem am Morgen zurückkehre, nach Masada am Mittag, Elat am Nachmittag, Taba, Taba, Taba, bei dem Kamelkadaver habe ich die Spur verloren, zurückfinden würde ich nicht mehr.
Mein Schlaf bleibt leicht, mitten in der Nacht dann die Übelkeit, es muss zuviel Sonne auf dem Kopf gewesen sein und dann der Hundertmeterlauf. Schmerzen, Stiche in der Brust und Angst, Wenn ich krank werde – daran hatte ich noch gar nicht gedacht, dass ich krank werden könnte – wenn ich so krank werde, dass ich mich nicht mehr bewegen kann, wann wird man mich finden.
Das Flirren bleibt hinter den Augen und im ganzen Kopf, wenn ich die Augen schließe. Die Schmerzen würden mich auf diesen Boden werfen, wenn ich nicht schon dort läge. Ich rolle mich weiter ans Wasser, als hätte ich hier noch nicht Luft genug. Dann kommen die Bilder und die Angst, von der mich schließlich das Eindämmern befreit.
Als ich die Augen wieder aufmache und auf das Wasser schaue und in den Mond, ist es ruhig, und ich denke: Wenn es Morgen wird und ich aufstehen
kann, werde ich mich ausziehen und nach ein paar Schritten in das Wasser fallen lassen.ich habe keine Angst vor dem Leben
ich habe keine Angst vor dem Tod
denn ich bin freiund dass Freiheit immer auch Einsamkeit ist
Doch ich bin in der Nacht nicht alleine geblieben, immer mehr meist junge Leute kamen, um sich am Wasser zum Schlafen zu legen. Ganz nah neben mir schlief ein Pärchen, das sich fest umschlungen hielt, erst als es hell wurde und die Fliegen kamen, machten sie Bewegungen mit den Händen, um diese zu verscheuchen. Sie stöhnte leise, er brummte etwas, und sie umschlangen sich fester.
Sie schliefen noch, als ich aufstand. Die Sonne war über den jordanischen Bergen aufgegangen und schien voll unter das Bastdach, unter das ich gegen Morgen zurückgekehrt war. Und sofort war es heiß geworden, ich konnte mich ausziehen und ins Wasser gehen. Vielleicht würde ich dort einen Überblick gewinnen. Jetzt erkannte ich zwischen den Palmen die kleinen Hütten um ein größeres Haus, das ein Restaurant sein musste, nur 20, 30 Meter entfernt. Rechts und links in größerer Entfernung ähnliche Arrangements. Kamele, die von Männern in langen weißen Kleidern geritten oder geführt wurden. Autos. Am Wasser entlang zusammengerollte Menschenhäufchen, schlafend. Nur hier und dort bewegte sich eines, stand auf, nahm Decke und Matratze und ging auf die Hütten zu. In dem Restaurant sah ich Bewegung, vielleicht gab es dort schon Kaffee, ich würde fragen.
Es gab nicht nur Kaffee. Es gab auch die Auskunft.
Nach meiner zweiten Tasse fragten mich drei Studenten, ob sie sich an meinen Tisch setzen dürften, was ich natürlich dankbar bejahte, jetzt würde ich endlich zu wissen bekommen, wo ich war und wohin ich mich zu wenden hatte. Höflich waren sie, begannen das Gespräch, auf das ich so brannte, mit aufmerksamen Fragen und Erläuterungen, warum es hier und gerade heute so viele Israelis gebe. Es stellte sich heraus, dass zwei von den dreien aus Brasilien kamen und Israel besuchen, was öfter geschah.
Ihre Eltern sind 1939 aus Deutschland geflohen. Ja. Wo bin ich.
Der Sonnenschirm wird nach jeder halben Stunde ein Stück weitergedreht und die Boys verschwinden von Zeit zu Zeit ins Wasser. Sie kommen naß wieder, wir frühstücken zusammen, reden weiter.
Wie es denn wirklich sei, jetzt, in Deutschland. Die brennenden Häuser der Türken, fragt einer der beiden aus Brasilien, deren Väter Deutsche sind.
Wo ist meine Freiheit.
Der letzte und freundlichste von den Dreien ist in Israel geboren und lebt in Jerusalem. Er kommt oft hierher und kennt sich aus. Der Sinai sei von 1967 bis 1979 israelisch gewesen, erzählt er. Und am Ende des Krieges hätten sie dann alles zerstört, kein einziges Haus hätten sie stehen lassen. – Die Araber? fragt ein Brasilianer, – nein, antwortet der andere, die Israelis.
Er gibt mir den Rat, zum Katharinenkloster zu fahren, es gäbe nichts Schöneres, er nennt auch den Preis, der zu akzeptieren sei.
Aber ich will doch nur nach Nuweiba.
Bis Nuweiba sei es noch eine halbe Stunde am Strand zu Fuß oder auf dem Rücken eines wankenden Kamels. Nach Süden, nicht in der Richtung, wo ich in der Ferne Licht gesehen habe.
Bis Nuweiba-Port, wo die Fähre nach Aqaba ausläuft, sei es noch einmal so weit wie von hier nach Nuweiba.
Wir verabschieden uns. Der Schatten ist aufgebraucht. Ich muss einen anderen suchen.
Gleichgültig wanken die Kamele vorüber. Aller Anfang ist leer.
Ich kann mich überall eingeschlafen wiederfinden, nur nicht an dem Ort, der dafür vorgesehen ist.
Das zeigt mir, dass ich auf der Reise bin.© H. Tarnowski
Aus Heide Tarnowski: überallundnirgends. 2017 mit 74 – Ein Tagebuchroman. Sonderausgabe von literaturkritik.de im Verlag LiteraturWissenschaft.de