
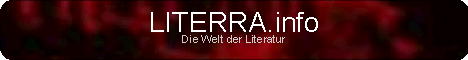
|
|
Startseite > Bücher > Dark Fantasy > Fabylon > Marc-Alastor E.-E. > DIE CHRONIKEN - WIDERPARTE UND GEFOLGE I ( 1984 - 1996 ) > Leseproben > Ausschnitt aus "Zeuge der Säugung (1990)" |
Ausschnitt aus "Zeuge der Säugung (1990)"
| DIE CHRONIKEN - WIDERPARTE UND GEFOLGE I ( 1984 - 1996 )
Marc-Alastor E.-E. ARS LITTERAE: Band 2 |
I
Wahrlich golden war der Herbst zu jenen Zeiten, lauter und makellos wie ein geschliffener Bernstein, und dabei zugleich wie ein einschließender Zauber für Pflanze oder Getier. Seit Wochen schon kam die goldene Helle, breitete weite Tücher über die erstarrten Länder und reichte, bis der Tag zur Neige ging, nicht aus, um die stille Kälte mit ihrer verhaltenen Wärme zu lindern. Der Frost überzog das Land mit einer glitzernden Gaze aus fortwährendem Raureif.
Atuach stapfte mit steifem Schritt über lange, erdige Plateaus, die zuweilen von winzigen Tümpeln und knochigen kleinen Bäumen unterbrochen wurden, bis er zu den Ebenen gelangte, die von goldgelben Gräsern bedeckt und sein eigentliches Ziel gewesen waren. Seine Arme hielt er dabei eng um seinen Körper geschlungen und blickte mit glasigen Augen, die stets nach dem richtigen Pfad suchten. Es war nicht einfach, ihn zu finden, denn das letzte Mal war er den Weg mit seinem Vater gegangen. Das lag nun viele Jahre zurück. Es gab hier keine Bresche, die sich durch die erstarrte Halmlandschaft wand und anzeigte, dass hier so mancher den Weg seiner Vorfahren gegangen sein mochte. Da war keine bloße, hart gefrorene Erde, die wie ein kristallisierter Bach, der noch immer an seinem Lauf durch die Graslandschaft festzuhalten im Stande war, verriet, dass hier aus Ehrfurcht vor des Menschen Schritt keine Gräser wuchsen. Man konnte den Pfad nur finden, wenn man die Zeichen zu lesen vermochte. Das war es, was der Vater dem Sohn vererbte. Das war es, was einstmals Gevatter Reguagah seinem Jüngling Atuach gelehrt hatte. Das vielleicht ärgste aller sterblichen Vermächtnisse.
Natürlich beunruhigte es Atuach, seinen Hof, seine Familie und vor allen Dingen seine junge Frau hinter sich lassen zu müssen, nur um wie ein verschrobener Abenteurer hinaus in die Wildnis zu gehen, wo es vor Schwarzbären und Amphicyoniden nur so wimmelte. Die Schwarzbären sah man zumeist nur aus der Ferne, denn sie zogen es vor, sich aus der Reichweite der Menschen zu bringen. Ihre Anverwandten aber, die Amphicyoniden, hatten sich in den vergangenen Jahrzehnten dramatisch verändert. Nicht nur, dass die Bärenhunde in größeren Rudeln zu jagen pflegten und sich dabei längst nicht mehr nur mit Kleintieren zufriedengaben, sie lernten auch im Kampf auf zwei Beinen zu gehen. Diese Veränderung machte die Amphicyoniden zu einer echten Gefahr für jedwedes Lebewesen. Und manch unbedarfter Jäger, der bei seiner Pirsch auf ein Rudel Bärenhunde gestoßen war, hatte sein Leben auf blutige Weise verloren.
Atuach war auf der Hut und verhielt sich während seines Marsches immer wieder ruhig. Dann lauschte er, ob er irgendwo verräterische Geräusche vernehmen konnte. Doch die Wildnis verriet niemanden. Zwar konnte er es überall rascheln, knirschen oder knacken hören, untermalt vom leisen Raunen des Windes. Aber es waren keine beunruhigenden Geräusche, da sie zumeist nur auf kleine Tiere hinwiesen, die während der drohenden Kälte ihre letzten Vorräte zu sammeln pflegten. In einiger Entfernung hatte Atuach am Morgen einen Riesenhirsch gesehen, und das war das letzte, größere Wild gewesen. Dabei fiel ihm ohnehin auf, dass die Wildnis ruhiger und verhaltener wurde, je näher er dem Ziel seiner unbehaglichen Wanderung kam.
Atuach blieb stehen, stützte sich auf seinen Stecken und strich sich die gefrierende Feuchtigkeit aus seinem Schnauzbart. Danach angelte er sich ein Stück Trockenobst aus seinem Beutel und begann darauf herumzukauen. Weit konnte es nicht mehr sein. Und er würde froh sein, wenn er den vermaledeiten Ort erst erreicht hatte, denn die Spannung stieg in ihm stetig, schnürte ihm die Kehle zu oder sank wie ein schwerer Braten in die Kuhle seines Magens. Atuach wusste nur leidlich, was ihn erwarten mochte. Vielleicht ein Kampf, der Kampf mit einem überirdischen Wesen, vielleicht nur die Erkenntnis, nichts ausrichten zu können, und vielleicht auch nur der sichere Tod.
Er war Kerzenmacher und verstand alles über Talgkerzen, die Herstellung von Binsenlichtern oder den guten Lichtern aus Bienenwachs. Seine Finger konnten den Binsen vorsichtig spalten, damit das Mark unverletzt blieb; jenes wurde in flüssiges Fett getaucht und ausgehärtet; Atuach vermochte Talg zu verarbeiten, obschon die Kerzen wenig Licht abgaben und schlecht rochen. Und wenn er an Bienenwachs kam, dann war er sogar im Stande, gute Kerzen zu ziehen, die selbst die Tempeldiener kauften. Mit einer Waffe konnte Atuach aber nur leidlich umgehen, und jegliche Form des Kampfes war ihm ohnehin zuwider.
Als Atuach nun in der kalten Luft stand und die stille Landschaft betrachtete, da ward im mulmig zumute. Er entsann sich des Tages, da sein Vater ihn mit glasigen Augen angesehen hatte, mit den letzten Atemzügen sein Erbe verkündend: »Achte immer auf Haus, Hof und Familie. Bringe ein jedes Jahr dem Patrongott M’Zaarox ein Opfer. Und wenn der Tag naht, an dem die Geburt des Blinden Wüterichs bevorsteht, erinnere dich, dass er nicht sein darf, und gehe hin und verhindere es, ganz gleich, was es dich kosten mag. Denn mit diesem Dienst erfüllst du auch die ersten beiden. Beherzige dies. Und füge dich.«
Atuach tat, wie ihm geheißen worden war, gab Acht auf Haus, Hof und Familie, opferte dem Patrongott willfährig und wartete auf den Tag, da die Vorzeichen von der Ankunft des Blinden Wüterichs sprachen. Bis dahin war alles ein allzu gewöhnliches Leben geblieben. Als ihn aber die üblen Prophezeiungen erreichten, wusste er, was zu tun war. Er machte sich auf.
Itzt, da er in der Wildnis stand und auf einer Dörr-Persunus herumkaute – einer Frucht aus diesen nördlichen Gefilden, die der Dattel ähnelte –, vermochte er zu ahnen, was ihn erwartete. Etwas, dem er nicht gewachsen sein würde; etwas, auf das man ihn nur leidlich vorbereitet hatte; etwas, das eher einen großen Helden bedurft hätte.
Irgendwo hier in der Wildnis stand ein sagenumwobener Baum, der einen unheiligen Gott gebären sollte. Atuach erschauerte.
Denn die Vorsehung schickte, um dies Unheil abzuwenden, einen einfachen Kerzenmacher.
II
Im schlichten Erinnerungsmuster des Baumes lag die Erkenntnis, dass sich mit ihm ein weiteres Mal die Geschichte wiederholen würde. Er besaß kein Wissen darüber, wie alt er schon war, und wann er das letzte Mal dieses Ereignis erfahren hatte. Es musste sehr lange her sein, denn in ihm hatte sich die Gelassenheit und Muße der vergangenen Jahrhunderte eingenistet.
Dennoch begannen sich Energieströme in ihm zu regen. Langsam krochen sie gleich den Säften, die über das Astwerk den Wipfeln entgegenstrebten, hinab an sein Wurzelwerk. Es waren Kräfte, die aus fremdartigen Erinnerungen und dunklen Einflüssen entstanden. Der Baum ahnte, dass die Kräfte zum Teil aus ihm kamen, sich aber auch von außen an ihn gaben. Er mutmaßte, dass sie Bestandteil des Lichtes oder des Regens sein mochten. Da sie jedoch nicht sonderlich beunruhigend waren, nahm er sie hin.
Nach einer Mondwende bildete sich an einem breiten Wurzelspalt, der noch über der Erde lag, und in dem sich gewöhnlich zum Herbst hin eine kleine Gruppe aufsässiger Stockschwämmchen zu versammeln pflegte, ein kleiner, purpurfarbener Knoten. Dieser erschien dem Baum nach einiger Zeit eher wie ein Sack, und im Inneren bildeten sich drei Keimblätter in einer heißen Flüssigkeit, die von den Energieströmen genährt zu werden schien. Schon während der nächsten Mondphase entfalteten sich die Keimblätter und wurden länglich. Aus ihnen gingen langsam Muskeln und Knochen, Bindegewebe und Gefäße hervor; es erwuchsen Schleimhäute und Innenwände des Atmungs- und Verdauungstrakts; Sinnesorgane, Nervensystem und Haut bildeten sich unter ersten unheiligen Pulsationen; ein zweiter Kreislauf, von weitaus primitiverer Form als der des Baumes, entstand und mischte seine Einflüsse mit denen des Baumes, der sich mittlerweile wie in einem Rausch befand.
Der pulsierende, mit feinen Äderchen durchzogene Beutel nahm nun den gesamten Raum zwischen den Wurzelschenkeln ein, und in ihm zeichnete sich der gekrümmte Embryo eines Lebewesens ab, von dem niemand hätte sagen können, was daraus werden mochte. Unter den hell schimmernden Hautpartien begann sich ein dunkles Skelett zu formen.
An einem Tag aber, an dem der Baum döste und die Entwicklung der Leibesfrucht nur durch die Einlagerung von Pigmenten unterstützte, kam ein hungriger Andrewsarchus des Weges, auf der Suche nach leichter Beute. Seine scharfen Raubtiersinne warnten ihn, dass selbst für ihn, der sonst kaum Feinde zu fürchten hatte, eine Gefahr drohte. Er witterte jedoch auch das Fleisch in dem werdenden Spross des Baumes, welches ihn einstweilen sättigen würde. Seit Tagen hatte er keine Nahrung mehr bekommen, denn in den kalten Monaten zogen viele Herdentiere in wärmere Gefilde.
Noch immer wagte sich der Andrewsarchus nicht näher. Der gewaltige Körper des Raubtieres bebte vor Erregung. Er schnaubte und knurrte den Baum an, doch nichts offenbarte eine erkennbare Gefahr. Allein seine Sinne warnten ihn. Doch als der Hunger obsiegte, stürzte sich der Andrewsarchus auf den purpurnen Beutel, der aus dem Baum zu wachsen schien. Sein Schädel, der eine Schwertlänge maß, schüttelte sich und sein riesiger Kiefer öffnete sich, um das werdende Leben zu verschlingen. Da sprühte unerwartet eine dampfende Flüssigkeit aus einer winzigen Öffnung des Beutels direkt auf den Kopf des Raubtiers, der laut zu schreien begann. Der Andrewsarchus versuchte sich zur Flucht zu wenden, schaffte dabei jedoch nicht einmal die Drehung vollends, als sein Körper, der die Länge von drei Menschen besaß, mit einem lauten Krachen zu Boden schlug, zappelte, trat und ohne einen weiteren Laut mit einem Mal erschlaffte. Die Flüssigkeit versickerte in dem dichten Fell, verklebte es und verschmolz die Zotte an einigen Stellen zu feisten Strängen. Der gefährliche Räuber blieb liegen und rührte sich nicht mehr.
Der Baum nahm dies Ereignis um das Raubtier nicht ohne eine gewisse, verhohlene Belustigung zur Kenntnis, denn schließlich war ein Andrewsarchus ein erbarmungsloser Mörder.
III
Was Atuach aber weitaus mehr ängstigte als die Tatsache, dass man einen einfachen Kerzenmacher schickte, um die Geburt eines dämonischen Abgottes zu verhindern, das war die Gegebenheit, keine richtige Waffe zu besitzen. Er hatte einen Stab bei sich, den er schon in manch einer Bedrohung als Waffe genutzt hatte. Er entsann sich nur mit großem Unbehagen an jene Nacht, als er den Weg von der abseits gelegenen Hufe, die einem Freund gehörte, zu seinem Dorf hatte zurücklegen müssen. Nicht allzu weit entfernt von der Siedlung war er auf einen Horeeper gestoßen, der mit der Schnelligkeit einer Schlange aus seinem Erdloch geschossen war und sich auf ihn gestürzt hatte.
Horeeper, entfernt artgleich mit ihren kleinen Anverwandten, den Hundertfüßlern, brachten es immerhin auf zwei bis drei Manneslängen, waren mit schwer gepanzerten Körpergliedern ausgestattet und einem Paar gefährlicher Zangen, die ein lähmendes Gift absonderten.
Ein solches Ungetüm hatte ihn angegriffen. Es hatte versucht, Atuach einen Fuß abzutrennen, denn aufrichten konnte sich ein Horeeper ob seiner schweren Panzerung nicht, und dem jungen Kerzenmacher war kaum etwas anderes geblieben, als sich irgendwie zur Wehr zu setzen. Er hatte dabei mit seinem Stab auf den flinken Räuber eingedroschen und gehofft, er könne das Untier auf diese Weise davon abbringen, ihn zu attackieren. Jedoch war Atuach bei den Schlägen aufgefallen, wie hart die Panzerung des Tieres war. Sein Stab hatte sich bei jedem Aufprall gebogen, und der junge Mann, vollkommen verängstigt und verzweifelt, war sich sicher gewesen, dass seine Waffe früher oder später brechen mochte.
Atuach erinnerte sich auch daran, dass er sich nicht aus dem Kampf hatte zurückziehen können, denn der riesige Hundertfüßler hatte ihm stets den Weg abgeschnitten, wand sich wurmgleich um sein Opfer, damit es stürzen mochte, und versuchte unablässig nach den Füßen zu schnappen. Die Mandibeln hatten gefährlich klingende Geräusche verursacht, wenn sie ins Leere schnappten. Atuach war um den Horeeper herum gehüpft, verführt von dem Gedanken, sich mit einem Sprung aus der nächsten Reichweite zu bringen und sich eiligst von dannen zu machen. Doch Atuach hatte aus Erzählungen entnommen, dass Horeeper zu schnell waren, und wenn das Opfer zu flüchten trachtete, sie es zumeist von hinten erwischten. Eisern hatte er gehofft, sein Stab mochte halten und dem Horeeper verdeutlichen, dass er sich nicht geschlagen geben und eine schlechte Beute sein würde. Sehr bald aber waren seine Kräfte erlahmt. Mit letzter Hoffnung und letztem Mut hatte er zugeschlagen. Und da war der Stab schließlich gebrochen. Atuach konnte sich noch allzu gut an das Knacken entsinnen. Es war ein grauenhafteres Geräusch gewesen als jeder Laut, den der Horeeper erzeugt hatte.
Schwächlich und den Tod erwartend hatte Atuach einen letzten Sprung gewagt, war bei der Landung unglücklich zur Seite gesackt und hatte sich mit einem Mal in Kopfhöhe mit dem Untier befunden. Instinktiv hatte er das Bruchstück seines Steckens erhoben und zugestoßen. Das Glück war ihm hold gewesen, denn die Spitze war genau zwischen die Mandibeln geraten und hatte sich in den Kopf des Horeepers gebohrt, da sich dieser in jenem Moment nach vorn gestürzt hatte. Nahezu lautlos war der Hundertfüßler gestorben. Zwar hatte er sich noch im Todeskampf gewunden, doch bald war er zusammengesunken wie ein rotierender Ring auf einer Tischplatte.
Seit jenem Tag trug Atuach immer einen Stecken bei sich, wenn er in die Wildnis ging. Er hatte sich einen aus Hartholz anfertigen lassen, der an seinen Enden mit polierten Metallhülsen versehen worden war. Der junge Mann fühlte sich wohler, seitdem er diese provisorische Waffe bei sich hatte.
Itzt war Atuach nicht wohl zumute. Er spürte, dass der Stecken ihm keine verlässliche Hilfe sein würde.
»Und wenn der Tag naht, an dem die Geburt des Blinden Wüterichs bevorsteht, erinnere dich, dass er nicht sein darf, und gehe hin und verhindere es, ganz gleich, was es dich kosten mag«, so war ihm gesagt worden. Und er hatte sogar noch drei Ratschläge zu diesem Erbe bekommen, bei dem er lieber Verzicht getan hätte. Drei unbegreifliche, nahezu unklare Ratschläge, die er bislang immer abgetan hatte, denn selbst die Geburt des Blinden Wüterichs war ihm stets unwirklich vorgekommen. Wie das unsinnige Kribskrabs eines Sterbenden eben. Doch keiner dieser Ratschläge hatte auch nur entfernt dazu geraten, eine Waffe mit sich zu führen. Natürlich hatte er sie mitgenommen, als er sich der Herausforderung gestellt hatte, doch derart sicher, wie ihm bis dahin all jener Teil des Erbes unglaubwürdig erschienen war, so wirklich war unversehens seine Aufgabe und das Wissen, dass der Stecken nichts anderes war als eine Stütze.
Und diese erschütternde Erkenntnis – bestürzend deshalb, alldieweil sie auf so schlichte Weise aus ihm selbst erwachsen war – wurde innerhalb eines Momentes zu einer ungefügigen Angst. Um ihn herum begann es im hohen Gras zu rascheln. Leise und zaghaft nur, als schleiche sich ein Raubtier an ihn heran, doch von nahezu grausamer Sicherheit, dass es sich nicht um Geräusche handelte, die der Wind oder ein kleines Tierchen verursacht hatte.
Etwas oder jemand pirschte sich an Atuach heran. Und das mulmige Gefühl, welches ihn seit Beginn seines Weges begleitet hatte, wandelte sich in Panik und Entsetzen.
IV
Ab einem bestimmten Abschnitt in der Entwicklung des unnatürlichen Lebewesens wusste der Baum, dass es an ihm war, sein Leben für das heranreifende Dasein an seinem Wurzelwerk zu geben. Es beunruhigte ihn. Und auch wenn es für einen Baum kaum so etwas wie Panik gab, so wurde sein Bewusstsein dennoch von der Erkenntnis geschüttelt, nicht länger dem Auf und Ab der Sonne und des Mondes folgen zu können.
Tief in seinem Geist gab es eine unumstößliche Gewissheit, dass er für die Ewigkeit bestimmt war. Doch darüber erhob sich mit einem Male der Schatten eines Endes. Und da er sich das Ende nicht vorstellen konnte, suchte er nach dem, was danach kommen musste. Irgendetwas musste ja danach geschehen.
Vielleicht, so dachte sich der Baum, würde er ja wiedergeboren. Und er fragte sich, was er dann wohl werden mochte? Möglicherweise wurde er ein unruhiger Geist, solch ein flatteriger Vogel oder eine quirlige Maus. Was für ein reizvoller Gedanke das war, nicht länger bestehen und betrachten und bedenken zu müssen, sondern vollkommen unbeschwert über Wiesen und Auen tollen zu können. Zwar war dies eine anziehende Vorstellung, jedoch entsann sich der Baum daran, dass diese Geschöpfe nur kurz im Leben weilten. Da die Länge des Daseins für ihn zugleich das Maß seines Stellenwertes in der natürlichen Rangordnung darstellte, ward im bewusst, dass er bereits über diesen Rang hinaus war. Tief eingebettet in die engsten und ältesten Jahresringe gab es noch ein Bildnis, von dem er nicht so recht zu sagen wusste, ob es einer Erinnerung oder einem verblichenen Traum seiner Jugendzeit entstammte. Nach diesem wurde aus einem Baum, der zu Fall kam, ein junger Trieb am Baum des Lebens, an dem alle Welten und Sphären wie Früchte wuchsen, aus dem jedwedes Leben hervorging. Ein gefallener Baum der niederen Sphären stieg zu einem Trieb am Lebensbaum auf und erreichte auf diese Weise nicht nur die Ewigkeit, sondern wurde für die guten Dienste seines Daseins entlohnt, indem er Bestandteil einer höheren Quelle wurde. Wenn der Baum jedoch verdorben, faul und bösartig gewesen war, so wurde er in die Dunkelheit des Erdreiches verbannt, dazu verdammt, ein Wurzeltrieb im großen, dunklen Kosmos zu sein, danieden, wo der Weltenbaum fußte.
Dieses Bildnis des ewigen Lebens erschien dem Baum jedoch derart entfernt und unwirklich, dass er seine Wipfel im Wind schwang, um sich dieses Sprösslingstraumes zu entledigen.
Nun besann er sich abermals darauf, dass in ihm das Versprechen auf Ewigkeit angelegt worden war. Was konnte also für eine solche Existenz wie die Seinige kommen, wenn die Ewigkeit ihr Ende gefunden hatte? Was war die Ewigkeit eigentlich für eine seltsame Zusicherung, wenn sie doch endete? Gab es neben den Lebens- auch Existenzabschnitte und man durfte die Ewigkeit immer nur auf einen Abschnitt angewandt wissen? Der Baum sann darüber nach.
Seine Energien und Säfte flossen ungewöhnlich schnell, während er brütete. Aber er kam zu keinem rechten Schluss. Und in ihm bildeten sich düstere Zweifel über jeden Wert, den er kannte. Bei all der Ewigkeit, die er genossen hatte, bei all den Jahreszeiten, die er hatte kommen und gehen sehen, und bei all den Veränderungen, die durch die Jahrhunderte auf alles um ihn herum eingewirkt hatten, war er doch immer derselbe geblieben – ein klein wenig größer, ein klein wenig fester im Stand vielleicht, doch in seinem Inneren derselbe.
Schon bald mochte aber genau das aus dem Weltenplan getilgt werden. Er würde vergehen, ohne wirklich etwas zu hinterlassen, das für ihn greifbar gewesen wäre. Er gab sein Leben an das Ding zu seinen Wurzeln ab, was auch immer es werden mochte. Nach dieser Erkenntnis versank er in bitteren Gram, und mit einer Mischung aus Abscheu und Huld betrachtete er es verzweifelt.
Weitere Leseproben
| Ausschnitt aus "Es gibt Spaltung hier im Inneren (1985)" |
| Der Drang nach innen, nicht außen (1986) |
[Zurück zum Buch]
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info





