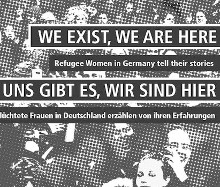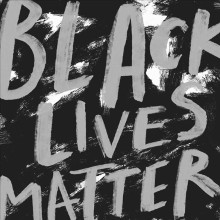Bis zum vergangenen Donnerstag sagte mir >Vanity Fair< nichts. Zwar hatte ich von William Makepeace Thackerays Satire auf die Londoner Gesellschaft des 19. Jahrhunderts gehoert. Dass aber in den USA auch ein Hochglanzmagazin unter diesem Titel erscheint, war mir neu. Die englischsprachige Ausgabe verbindet Promiklatsch mit Politik und wird vor allem von gut verdienenden Amerikanerinnen gelesen. An diesem Format orientiert sich auch die neue deutsche Ausgabe eine Art Mischung aus Gala und Spiegel.
Ich verbringe zu wenig Zeit in Wartezimmern, um eine fundierte Meinung zu Magazinen wie Gala zu haben. Meine Grosseltern sind zu alt, um Gala zu lesen, und meine Freundinnen zu geizig. Maenner, die sich fuer solche Themen interessieren, waren mir immer suspekt. Wozu also ein neues Magazin kaufen, das ganz offensichtlich Klatsch und Tratsch mit farbigen Anzeigen aufpeppt? Dennoch war ich neugierig auf das erste Heft, hatte ich doch lange Rezensionen und Verrisse gefunden. >Vanity Fair< sei als >Wochenmagazin fuer die junge, gutverdienende, gebildete Elite< konzipiert, schrieb etwa der >Tagesspiegel<. Spaetestens seit dem Hype der Unterschichten-Debatte zieht das gegengerichtete Etikett >Elite<. Wer dazugehoeren will, kauft >Vanity Fair< zum Kampfpreis von einem Euro. Du bist, was Du liest – und elitaer zu sein, ist neuerdings angesagt.
Der Chefredakteur von >Vanity Fair<, Ulf Poschardt, hat offenbar angekuendigt, die folgenden Ausgaben wuerden teurer. Nachdem aber auch die >Zeit< der neuen Publikation eine ganze Seite gewidmet hatte, stand fest: Ich muss >Vanity Fair< kaufen und zwar sofort. Ich – Opfer der Schleichwerbekampagne. >Vanity Fair< wird massiv beworben. Nicht nur in Mitte haengen riesige schwarze Plakate an Haeuserfassaden – auch in Friedrichshain und Kreuzberg. Selbst in Neukoelln prangt der goldene Schriftzug >Vanity Fair< auf allen Werbetafeln.
Beim Zeitungskiosk in der Oranienstrasse war das Heft ausverkauft. Das hatte ich befuerchtet. Ein zweiter Versuch am Samstag in Neukoelln bei drei weiteren Kiosken verlief ebenfalls erfolglos. >Keine Chance Madame, Sie sind zu spaet dran<, sagte der erste Haendler. Der zweite gab mir zu verstehen, er verkaufe keine Hefte pornografischen Inhalts und ein nackter Til Schweiger mit Ziegenbaby im Arm sei eine Zumutung. Dem war nur zuzustimmen. Neugierig war ich trotzdem. Karstadt am Hermannplatz war meine letzte Hoffnung. Auch dort nichts – >80 Magazine haben wir allein am Donnerstag verkauft, dann am Freitag gleich alle sechzig Nachbestellungen<, hiess es dort. Die naechste Ausgabe werde am Donnerstag erscheinen, ich solle Montag in aller Fruehe wiederkommen und mir ein Heft der letzten Lieferung von Ausgabe eins sichern. >Sichern?< Sicherlich nicht. Ich will nicht mehr.



 MORE WORLD
MORE WORLD